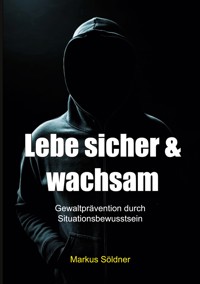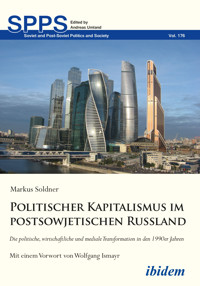
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Soviet and Post-Soviet Politics and Society
- Sprache: Deutsch
Wie und warum entstand nach dem Zerfall der Sowjetunion in Russland ein Regime des politischen Kapitalismus? Unter dem ersten Staatspräsidenten Boris Jelzin bildete sich im Ergebnis intransparenter Transformationsprozesse ein neues sozio-politisches System heraus. Stürmische Entwicklungen in den Transformationsfeldern Politik, Ökonomie und Massenmedien waren eng miteinander verknüpft. Markus Soldner setzt sie in seiner sowohl theoretisch-konzeptionell fundierten als auch akribisch recherchierten empirischen Studie mit Hilfe des an Max Weber angelehnten Begriffs des politischen Kapitalismus systematisch zueinander in Beziehung. In einem politischen System mit starker Exekutivgewalt, mangelnden legislativen und öffentlichen Kontrollmöglichkeiten sowie unterentwickelten Parteien zielte das Lobbying ökonomischer Akteure weniger auf die parlamentarische Arena als auf die informellen Räume und Zirkel in Präsidialverwaltung und Regierung. Die Kontrolle über Massenmedien gab einigen zentralen ökonomischen Akteuren zusätzliche Macht, je nach temporärer Interessenlage bestimmte Teile der politischen Elite zu unterstützen oder zu schwächen, um ihre eigenen Interessen zu befördern und denen ihrer Konkurrenten zu schaden. Dabei strebten die exponiertesten der neuen Akteure keinen umfassenden Eliten‑, System- oder Machtwechsel an, sondern die Erhöhung der eigenen Rentenzugriffschancen. Sie blieben so der (Funktions‑)Logik des politischen Kapitalismus treu und stabilisierten durch ihr Verhalten das neu entstandene semidemokratische Regime. Die Studie zeichnet sich besonders durch die interdisziplinäre und systematisch-verknüpfende Herangehensweise aus sowie ihre ungemein breite Datengrundlage. Zahlreiche illustrative Fallbeispiele machen das Buch auch für ein an den Entwicklungen in Russland interessiertes allgemeines Publikum lesenswert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 751
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abstract in English Language
Zum Autor
Zum Vorwortautor
Danksagung
Vorwort
1. Einleitung
1.1 Gegenstand und Zielsetzung
1.2 Forschungsstand und Quellenlage
1.3 Der Aufbau der Arbeit
2. Theoretisch-konzeptioneller Rahmen
3. Die Transformation des politischen Systems: Zentrale Institutionen nach der neuen Verfassung
3.1 Vorgeschichte und Kontext der Verfassungsgebung
3.2 Stellung und Kompetenzen des Staatspräsidenten
3.3 Stellung und Kompetenzen der Regierung
3.4 Stellung und Kompetenzen des Parlamentes
3.5 Zusammenfassung und Überleitung
4. Die Verfassungsrealität in der Ära El’cin
4.1 Die duale Exekutive
4.1.1 Die Organisation des Amtes des Staatspräsidenten
4.1.2 Die Organisation der Regierung
4.1.3 Die Interaktion von Staatspräsidentschaft und Regierung
4.2 Die Duma
4.2.1 Die Auflösung der Duma
4.2.2 Misstrauensvotum und Vertrauensfrage
4.2.3 Das Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatspräsidenten
4.2.4 Die Bestätigung des Ministerpräsidenten durch die Duma
4.2.5 Zwischenfazit zum Verhältnis Duma-Exekutive unter dem Aspekt Regierungsbildung bzw. -kontrolle
Exkurs zur Haushaltsgesetzgebung
4.2.7 Zwischenfazit zur Rechtsetzung durch Parlament und Staatspräsident
4.3 Zusammenfassung und Überleitung
5. Die Transformation der Ökonomie
5.1 Der Kontext nach der Perestrojka: Liberalisierung und Massenprivatisierung
5.2 Besonderheiten und Probleme der ökonomischen Transformation
5.3 Stagnierende Wirtschaftsreform und rent seeking unter El’cin
5.4 Der Finanzsektor
5.4.1 Inflations- und Spekulationsgewinne
5.4.2 Autorisierte Banken
5.4.3 Staatsanleihen
5.5 Die zweite Phase der Unternehmensprivatisierung: Bargeld-Privatisierung
5.5.1 Die Pfandauktionen
5.5.1.1 Die Vorgeschichte
5.5.1.2 Die rechtliche Ausgestaltung
5.5.1.3 Durchführung und Ergebnisse
5.5.2 Die zweite Runde der Pfandauktionen und weitere Großprivatisierungen
5.6 Konglomerate: Die Konzentration ökonomischer Macht
5.6.1 Finanz-Industrie-Gruppen als politisch gewünschte Verbindungen
5.6.2 Die Bildung großer, informeller Unternehmenskonglomerate
5.6.2.1 Terminologie und Akteurskreis
5.6.2.2 Die großen Unternehmenskonglomerate
5.7 Zusammenfassung und Überleitung
6. Die Transformation des Mediensektors
6.1 Der Kontext der Transformation des Mediensektors
6.1.1 Die Ausgangslage in der Endphase der Sowjetunion: Glasnost’
6.1.2 Die Umbruchsjahre in Russland: „Zeitungs-Boom“ und (wirtschaftliche) Ernüchterung
6.2 Das Politikfeld Massenmedien
6.2.1 Gesetzliche (Nicht-)Regelungen und untergesetzliche Normen
6.2.1.1 Das russländische Gesetz „Über die Massenmedien“
6.2.1.2 Gesetzgebungsblockade
6.2.1.3 Rechtsetzung und -umsetzung durch die Exekutive
6.2.2 Medien in zentralstaatlichem Besitz
6.2.3 Der Fall ORT
6.3 Nichtstaatliche Akteure auf dem Feld der Massenmedien
6.3.1 Ökonomische Probleme: Subventionen und Sponsoren
6.3.2 Die „Aufteilung“ der überregionalen Massenmedien
6.3.3 Die Unternehmenskonglomerate und der Mediensektor
6.3.3.1 MOST
6.3.3.2 Berezovskijs Gruppe
6.3.3.3 Die Moskauer Gruppe
6.3.3.4 Gazprom
6.3.3.5 ONĖKSIM
6.4 „Medienkriege“
6.4.1 Massenmedien als politische Ressource in wechselnden Allianzen
6.4.2 Präsidentschaftswahl 1996
6.4.3 Privatisierung von Svjaz’invest
6.4.4 Duma- und Präsidentschaftswahlen 1999/2000
6.5 Zusammenfassung
7. Schlussbetrachtung
7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
7.2 Ausblick: Russland unter Putin – bringing „the state“ back in
8. Literatur- und Quellenverzeichnis
8.1 Monographien, Sammelbände, Aufsätze und Artikel
8.2 Berücksichtigte Printmedien und Informationsdienste
8.3 Rechtsakte und andere offizielle Quellen
8.3.1 Gesetze
8.3.2 Akte des Staatspräsidenten
8.3.3 Akte der Regierung und der Regierungsbehörden
8.3.4 Parlamentsakte
8.3.5 Entscheidungen des Verfassungsgerichts
8.3.6 Sonstige Quellen
Soviet and Post-Soviet Politics and Society
Impressum
Abkürzungsverzeichnis
BIP Bruttoinlandsprodukt
EBRD European Bank for Reconstruction and Development
EIM European Institute for the Media/Europäisches Medieninstitut
EPTK Edinyj proizvodstvenno-technologičeskij kompleks gosudarstvennych ėlektronnych sredstv massovoj informacii(Einheitlicher produktions-technologischer Komplex der staatlichen elektronischen Massenmedien)
FIC Federal’nyj informacionnyj centr(Föderales Informationszentrum)
FIG financial-industrial groups
FPG finansovo-promyšlennye gruppy(Finanz-industrielle Gruppen)
FSTR Federal’naja služba Rossii po televideniju i radioveščaniju(Föderaler Dienst Russlands für Fernsehen und Rundfunk)
GAK Gosudarstvennyj antimonopol’nyj komitet(Staatliches Antimonopol-Komitee)
GAO Gosudarstvennoe akcionernoe obščestvo(Staatliche Aktiengesellschaft)
GKI Gosudarstvennyj komitet po upravleniju gosudarstvennym imuščestvom(Staatliches Komitee zur Verwaltung des Staatsvermögens)
GKO Gosudarstvennye kratkosročnye obligacii(Kurzfristige Staatsobligationen)
GPU Gosudarstvenno-pravovoe upravlenie(Staats- und Rechtsabteilung)
GTK Gosudarstvennyj tamožennyj komitet(Staatliches Zollkomitee)
IBG Integrirovannye biznes-gruppy(Integrierte Businessgruppen)
IPI International Press Institute
IREX International Research & Exchanges Board
KPRF Kommunističeskaja partija Rossijskoj Federacii(Kommunistische Partei der Russländischen Föderation)
LDPR Liberal’no-demokratičeskaja partija Rossii(Liberaldemokratische Partei Russlands)
MFK Moskovskaja finansovaja kompanija(Moskauer Finanzgesellschaft)
MKNT Moskovskij komitet po nauke i technologijam(Moskauer Komitee für Wissenschaft und Technologie)
MKS Mežbankovskij kreditnyj sojuz(Interbank-Kreditunion)
MPTR Ministerstvo Rossijskoj Federacii po delam pečati, teleradioveščanija i sredstv massovych kommunikacij(Ministerium für Angelegenheiten der Presse, des Hörfunks und Fernsehens sowie der Massenkommunikationsmittel)
MTK Moskovskaja telekompanija(Moskauer Fernsehgesellschaft)
NFS Nacional’nyj Fond Sporta(Nationaler Sportfonds)
NDR Naš dom – Rossija(Unser Haus – Russland)
NFK Neftjanaja-finansovaja kompanija(Erdöl-Finanzgesellschaft)
NLMK Novolipeckij Metallkombinat(Novolipecker Metallkombinat)
OAO Otkrytoeakcionernoe obščestvo(Offene Aktiengesellschaft)
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
OFZ Obligacii federal’nogo zajma(Föderale Anleihepapiere)
ORT Obščestvennoe rossijskoe televidenie(Öffentliches Russländisches Fernsehen)
OSCE Organisation for Security and Co-operation in Europe
OVR Otečestvo – Vsja Rossija(Vaterland – Ganz Russland)
RAO Rossijskoe akcionernoe obščestvo(Russländische Aktiengesellschaft)
RECĖP Rossijsko-Evropejskij centr ėkonomičeskoj politiki(Russländisch-europäisches Zentrum für Wirtschaftspolitik)
RCĖR Rabočij centr ėkonomičeskich reform pri Pravitel’stve(Arbeitszentrum für ökonomische Reformen bei der Regierung)
RFFI Rossijskij fond federal’nogo imuščestva(Russländischer Fond Föderalen Eigentums)
RSF Reporters sans frontières
RSFSR Rossijskaja Sovetskaja Federativnaja Socialističeskaja Respublika(Russländische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik)
RTR Rossijskoe televidenie i radio(Russländisches Fernsehen und Radio)
SAPiP Sobranie aktov Prezidenta i Pravitel’stva Rossijskoj Federacii(Sammlung der Akte des Präsidenten und der Regierung der Russländischen Föderation)
SBS Stoličnyj bank sbereženij(Hauptstädtische Sparbank)
SMM Sistema Mass-Media(Sistema Massenmedien)
SND S‘‘ezd narodnych deputatov(Kongress der Volksdeputierten)
SPS Sojuz pravych sil(Union der rechten Kräfte)
SZRF Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii(Sammlung der Gesetzgebung der Russländischen Föderation)
TNK Tjumenskaja neftjanaja kompanija(Tjumen’er Erdölgesellschaft)
TVC TV Centr(TV Zentrum)
UDP Upravlenie delami Prezidenta(Verwaltungsabteilung des Staatspräsidenten)
VCIOM Vserossijskij centr izučenija obščestvennogo mnenija(Gesamtrussländisches Zentrum zur Erforschung der öffentlichen Meinung)
VČK Vremennaja črezvyčajnaja komissija pri Prezidente RossijskojFederacii po ukrepleniju nalogovoj i bjudžetnoj discipliny(Temporäre außerordentliche Kommission beim Präsidenten der Russländischen Föderation zur Stärkung der Steuer und Haushaltsdisziplin)
VGTRK Vserossijskaja gosudarstvennaja televizionnaja i radioveščatel’naja kompanija(Gesamtrussländische staatliche Fernseh- und Hörfunkgesellschaft)
VNK Vostočnaja neftjanaja kompanija(Östliche Erdölgesellschaft)
VSND Vedomosti S’’ezda narodnych deputatov Rossijskoj Federacii i Verchovnogo Soveta Rossijskoj Federacii(Anzeiger des Kongresses der Volksdeputierten der Russländischen Föderation und des Obersten Sowjet der Russländischen Föderation)
ZAO Zakrytoe akcionernoe obščestvo(Geschlossene Aktiengesellschaft)
Abstract in English Language
Political Capitalism in post-Soviet Russia. The Political, Economic and Mass Media Transformation Processes in the 1990s.
Why and how did a regime of political capitalism emerge after the collapse of the Soviet Union in Russia?
Under the first President El’cin, informal and opaque political processes shaped the transformation of the political system. Few actors with vested interests benefited from the economic transformation, political counterweights remained weak. The mass media were not able to distinguish themselves as a fourth estate, but suffered from exploitation by political and economic actors.
The developments in the fields of political, economic and mass media transformation were closely interrelated and are systematically linked by this study for the first time.With the help of a concept of political capitalism, inspired by Max Weber, it is possible to chart the specific interdependencies between the fields of the Russian transformational process of the 1990s more precisely and to explain their interrelations.
In a political system with a strong executive, insufficient legislative and public control and an underdeveloped party system, the lobbying of the economic actors did not aim at the parliamentary arena, but at the informal spaces and circles of the presidential administration and government. There, important decisions were made, privileging individual industries and enterprises.
Their control over the mass media gave central economic actors additional power to support or weaken, depending on temporary interests, certain parts of the political elite in order to promote their own interests. Simultaneously, the most exposed actors did not aspire to a comprehensive change of the regime or the political elites, but wanted to increase their own chances of collecting rents. In doing so, they remained faithful to the (functional) logic of political capitalism and stabilised the political regime with their own behaviour.
The author:
Dr. Markus Soldner is a freelance political scientist. He studied political science, Slavonic studies and philosophy in Tübingen, Moscow and Hamburg. He holds a PhD from Dresden University of Technology, where he worked as a research fellow at the Institute of Political Science. Among his publications is a monograph on Russia’s policy towards Chechnya (Russlands Čečnja-Politik seit 1993; Lit) and a volume on comparative analysis of democratic government, co-edited with Klemens H. Schrenk (Analyse demokratischer Regierungssysteme; VS). With Kerstin Pohl, he co-authored a study of direct democracy and civic education in Germany (Die Talkshow im Politikunterricht; Wochenschau).
The foreword author:
Dr. Wolfgang Ismayr is Professor Emeritus of Political Science at Dresden University of Technology.
Danksagung
Wissenschaftliche Arbeit bedarf nicht nur der Lektüre zahlreicher Beiträge und Quellen zum jeweiligen Thema, sondern auch der permanenten Auseinandersetzung mit Kolleginnen und Kollegen über den eigenen Text. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Besonderen Dank schulde ich Prof. Dr. Wolfgang Ismayr für seine anhaltende Unterstützung. Ohne seine zuverlässige Begleitung und zahlreichen kritischen Fragen im Rahmen intensiver Diskussionen hätte ich diese Arbeit nicht schreiben können. Prof. Dr. Karl-Heinz Schlarp danke ich für viele Gespräche voller Hinweise, Fragen und Anregungen sowie die Übernahme des Zweitgutachtens.
Von der produktiven Arbeitsatmosphäre am Institut für Politikwissenschaft der TU Dresden und von zahlreichen Diskussionen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums von Wolfgang Ismayr profitierte auch diese Arbeit. Aus dem Kreis vieler Kolleginnen und Kollegen besonders hervorheben möchte ich Jörg Bohnefeld, Dr. André Fleck und den leider viel zu früh verstorbenen Klemens Schrenk. Sie diskutierten mit mir Teile der Arbeit und gaben mir wertvolle Anregungen.
Viele Freundinnen und Freunde, darunter vor allem Matthias Bertsch, Petra Köhler, Sven Reichenbächer und Marc Stephan, trugen dazu bei, dass ich in allen Arbeitsphasen die Dissertation bei diversen sportlichen und anderen Freizeitaktivitäten auch einmal vergessen konnte.
Kerstin Pohl unterstützte mich unermüdlich. Ihre Durchsicht des Manuskripts, ihre kritischen Fragen und unsere Gespräche über die Arbeit brachten das Projekt inhaltlich immer wieder weiter voran. Auch ihr moralischer Beistand verdient meinen ausdrücklichen Dank.
Vorwort
Der Systemwechsel in Osteuropa unterscheidet sich von vorausgegangenen Demokratisierungswellen besonders dadurch, dass die politische und die wirtschaftliche Transformation gleichzeitig stattfanden und sich eine Reihe neuer Staaten bildete. Dem überaus komplexen Transformationsprozess in der Russländischen Föderation der 1990er Jahre von der Verfassungsgebung 1993 bis zum Ende der „Ära El’cin“ 1999 ist die vorliegende Arbeit gewidmet, die auf einer Dissertation an der Technischen Universität Dresden basiert.
Im Unterschied zu anderen Forschungsarbeiten werden mit Politik, Ökonomie und Massenmedien gleich drei Transformationsfelder verknüpfend untersucht, sodass ihre Interdependenzen deutlich werden können. Die Arbeit erklärt, wie und warum es zu Koalitionen zwischen politischen Akteuren und Vertretern partikularer ökonomischer Interessen kam und wie Massenmedien für die Beförderung privilegierter Interessen instrumentalisiert wurden.
Der Autor hat eine eindrucksvolle Fülle vor allem russisch- und englischsprachiger Literatur und russischer Quellen, darunter zahlreiche Rechtsakte unterschiedlichster Urheber genutzt und akribisch ausgewertet. Angesichts einer mitunter disparaten Materiallage besteht eine besondere Leistung darin, dass die jeweiligen Informationen mit mehreren, voneinander unabhängigen Quellen belegt werden. Die Zuverlässigkeit der Quellen wird vom Autor kritisch reflektiert.
In seiner Untersuchung stützt Markus Soldner sich auf die Konzeption des „politischen Kapitalismus“, die er im Anschluss an Max Weber systematisch und überzeugend entfaltet. Die Kernidee bildet der privilegierte Zugang partikularer Akteure zu staatlichen Institutionen und Ressourcen und die Möglichkeit, dadurch politische Renten zu erzielen. Neben dem Grundcharakteristikum des rent seeking werden fünf Faktoren als weitere Analysekategorien vorgestellt: Die Bedeutung informeller Politik, das Interesse privilegierter Akteure an der Aufrechterhaltung des Status quo sowie am Ausbau der je eigenen ökonomischen und/oder politischen Position, die Konzentration ökonomischer Macht, die teilweise Privatisierung des Staates und schließlich der Einsatz der Massenmedien als politische Ressource. Die Bedeutung dieser Aspekte für die Transformation von Politik, Ökonomie und Massenmedien wird in den nachfolgenden Kapiteln differenziert herausgearbeitet.
Die Untersuchung der Transformation des politischen Systems bildet den ersten Hauptteil des Buches. Es wird detailliert entfaltet, dass der Staatspräsident im formal präsidentiell-parlamentarischen System mit seiner doppelten Exekutive aus Präsident und Regierung schon gemäß der Verfassungsnorm eine außergewöhnlich starke Stellung besitzt. Falls der Präsident seine Vollmachten extensiv nutzt, kann das Parlament nur eine relativ geringe Rolle spielen. Nach Einschätzung des Autors wird schon durch die Verfassungsnorm eine erste Grundlage für eine Umgehung demokratisch legitimierter Institutionen durch informelle Verfahren gelegt.
In der Folge untersucht Markus Soldner eingehend, welche Auswirkungen die im Verfassungstext angelegte starke Exekutivlastigkeit in der Verfassungsrealität hatte. Die empirische Analyse der Interaktionen von Staatspräsident und Regierung belegt eindrucksvoll die starke Abhängigkeit der russländischen Regierung vom Staatspräsidenten, wobei es immer wieder zu intraexekutiven Machtkämpfen kam, in denen sich El’cin auch über rechtliche Einschränkungen hinwegsetzte. Die Exekutive und vor allem der Staatspräsident waren im Rahmen der Interaktion mit der Duma zumeist deutlich durchsetzungsfähiger als die Erste Kammer.
Der Autor kann zeigen, wie umfangreich der Präsident sein (nur selten überstimmtes) Veto bei der Gesetzgebung eingelegt und mittels Dekreten regiert hat, ohne Einschränkungen durch das Verfassungsgericht unterworfen zu sein. Vor allem die Bereiche Wirtschaft, Privatisierung und Massenmedien wurden fast ausschließlich durch untergesetzliche Normsetzungen reguliert, und es waren auch diese Bereiche, in denen sich – begünstigt durch die Intransparenz solcher Normsetzungsprozesse – die informelle Einflussnahme privilegierter ökonomischer Akteure auf die Exekutive besonders gravierend auswirkte.
Der zweite Hauptteil ist der Transformation der Ökonomie gewidmet. Auch hier destilliert der Autor überzeugend Prozesse des rent seeking heraus und zeigt, auf welchen Gebieten, mit welchen Strategien und in welch erheblichen Umfang Privilegien eingeräumt wurden. Er zeigt dies exemplarisch und überaus anschaulich an den Beispielen der Inflations- und Spekulationsgewinne, dem System autorisierter Banken, dem Bereich der Staatsanleihen sowie der Privatisierung von Großunternehmen. Die Gewährung ökonomischer Vorzugskonditionen war demnach für bestimmte Branchen bzw. Unternehmen ein Grundcharakteristikum des Systems während der 1990er Jahre. Besonders Großkonzerne aus dem Banken- und Rohstoffsektor, die teilweise zu Konglomeraten heranwuchsen, profitierten von dieser selektiven Privilegierung durch staatliche Akteure und den entstehenden Marktverzerrungen.
Typische Begünstigungen wie der privilegierte Zugang zu Informationen, die Befreiung von staatlichen Auflagen und Vorschriften, die selektive Gewährung von Lizenzen, der Zugriff auf Eigentum in staatlichem Besitz und der Ausschluss von Konkurrenz werden vielfältig nachgewiesen. Es gelingt dem Autor, auch im Bereich der Wirtschaft herauszuarbeiten, dass eine Reihe von Elementen des politischen Kapitalismus erhebliches Gewicht hatten – bis hin zu Tendenzen einer Ausbeutung staatlicher Institutionen zugunsten partikularer Interessen, mithin einer „Privatisierung des Staates“.
Der dritte Hauptteil behandelt eingehend die Transformation des Mediensektors, die im Kontext der vorausgegangenen Ausführungen zur Politik und Ökonomie analysiert wird. Der Autor kann nachweisen, dass sich auch auf diesem Gebiet die Exekutive weitgehend gegenüber dem Parlament durchsetzen konnte. Auch das Politikfeld der Massenmedien wurde nur in geringem Maße durch Gesetzgebung und stattdessen durch eine Vielzahl untergesetzlicher Normen reguliert. Eingehend wird dargestellt, wie bei diesem intransparenten Vorgehen einzelne partikulare Akteure durch die Exekutive bevorzugt wurden und wie dadurch schwer durchschaubare wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse entstanden.
Die finanzielle Unterstützung der Printmedien und audiovisuellen Medien durch zahlreiche medienexterne Wirtschaftsakteure und zusätzlich ab Mitte der 1990er Jahre massive Investitionen durch die Konglomerate führten zu einer politisch und ökonomisch höchst bedeutsamen Aufteilung der überregionalen Massenmedien unter wenigen Beteiligten. Der Autor attestiert diesen Akteuren ein instrumentelles Verständnis der von ihnen kontrollierten Massenmedien als spezifische Ressource, die sie in politischen Konflikten wie auch in ökonomischen Verteilungskämpfen – exemplarisch behandelt in den drei „Medienkriegen“ der Jahre 1996, 1997 und 1999 – umfassend einsetzten.
Markus Soldner hat eine theoretisch und empirisch überaus anspruchsvolle Untersuchung vorgelegt, die wesentlich zu einem erweiterten und vertieften Verständnis politischer, ökonomischer und medialer Transformationsprozesse beiträgt. Auf der Basis einer beeindruckenden Fülle empirischen Materials, das er sachkundig ermittelt und theoriegeleitet ausgewertet hat, ist es ihm überzeugend gelungen, die überaus komplexen Strukturen, Interaktionen und Interdependenzen zwischen den Bereichen Politik, Ökonomie und Massenmedien im russländischen Transformationsprozess herauszuarbeiten und deren Besonderheiten zu charakterisieren. Dabei erweist sich die eigenständig fortentwickelte Konzeption des „politischen Kapitalismus“ als ausgesprochen fruchtbar. Sie könnte auch bei der Analyse anderer politischer Systeme gewinnbringend eingesetzt werden.
Wolfgang Ismayr
1. Einleitung
1.1 Gegenstand und Zielsetzung
Zwei Jahre nach dem Ende der Sowjetunion und langen, auch gewaltsamen innenpolitischen Auseinandersetzungen trat in der Russländischen Föderation als Rechtsnachfolgerin eine neue Verfassung in Kraft. Darin kommt dem Staatspräsidenten eine herausgehobene Stellung zu. Sowohl journalistische als auch wissenschaftliche Analysen kamen (und kommen) seitdem mehrheitlich zu dem Schluss, dass der russländische Staatspräsident weltweit eines der mächtigsten Staatsoberhäupter sei, mächtiger jedenfalls als der US-Präsident. Mitte der 1990er Jahre zeichneten dann Medienberichte ein Bild von der Russländischen Föderation, in der eine Handvoll kapitalstarker Akteure des Big Business („Oligarchen“) nicht nur Staatspräsident El’cin, sondern ein ganzes politisches System zum eigenen Vorteil manipulierten und korrumpierten. Entscheidungen von Exekutive und Legislative würden so gefällt, dass sie den Wünschen dieser Wirtschaftsmagnaten entsprechen. Gegen den Willen dieser „Königsmacher“ könne sich kein hochrangiger Politiker lange im Amt halten.
Diese beiden Phänomene – die große Machtfülle des russländischen Staatspräsidenten einerseits und die signifikant privilegierte und machtvolle Position einiger herausgehobener wirtschaftlicher Akteure andererseits – existierten im Russland der 1990er Jahre gleichzeitig und nebeneinander, und sie lassen sich in gewisser Weise auch unter El’cins Amtsnachfolgern beobachten. Wie passt das in einem zumindest formal demokratischen System zusammen? Welche Faktoren waren dafür (mit)verantwortlich, dass Staatspräsident El’cin seine Macht häufig zugunsten partikularer Interessen einsetzte? Auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln geschah dies? Warum hatten potentielle politische und gesellschaftliche Gegengewichte in der Summe nur geringen Einfluss?
Mächtige Wirtschaftsakteure verfügen in bestimmten politischen Kontexten über bedeutend größere Durchsetzungschancen als in anderen; spezifische institutionelle Konfigurationen begünstigen bestimmte Strukturen, Kanäle, Strategien und Erfolgschancen der Einflussnahme. In Russland werden einzelne partikulare Interessen durch die konkrete Konstruktion des politischen Institutionengefüges und die formell und informell ablaufenden Politikprozesse stark begünstigt. Es steht zu vermuten, dass ein in der Verfassungsnorm exekutivlastiges Institutionensystem nicht automatisch zu einem „starken Staat“ führt, in dem Staatspräsident und Regierung am Gemeinwohl orientiert „durchregieren“ können. Statt dessen, so eine zentrale Hypothese, könnte sich die Wahrscheinlichkeit erheblich erhöhen, dass es zu interdependenten Koalitionen zwischen Vertretern partikularer, insbesondere ökonomischer Interessen und politischen Akteuren, vorwiegend aus dem Bereich der Exekutive, kommt.
Im Grundsatz sind zwar auch in allen etablierten europäischen Demokratien die jeweilige Exekutive und ihr Apparat primäre Adressaten bei der Einflussnahme auf den Gesetzgebungsprozess,1 doch zeigt sich dieses Phänomen in Russland nicht nur ausgeprägter, sondern auch in anderer Qualität. Wenn wichtige Rechtsetzungen nicht in Form von Gesetzen, sondern durch Präsidialerlasse vorgenommen werden, reduzieren sich die parlamentarischen Kontrollmöglichkeiten. Im Extremfall werden bestimmte Erlasse nicht veröffentlicht, und „nichtnormative“ Erlasse werden vom Verfassungsgericht nicht geprüft.
Zeiten umfassender und paralleler politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Transformationen sind mehr als „normale“ Reformphasen, die es in jedem System immer wieder gibt. In ungleich größerem Maße stehen für zahlreiche Akteure Startchancen, Positionsvorteile, Ressourcenausstattung und dergleichen mehr zur Disposition. Vor diesem Hintergrund, verstärkt noch durch den oben beschriebenen strukturell-prozessualen Kontext, ist zu vermuten – so eine weitere Hypothese –, dass den Massenmedien eine veränderte Bedeutung zukommt. Vor allem, wenn sich eine Zeitung oder ein Fernsehsender im Besitz eines ökonomischen Akteurs befindet, dessen Hauptgeschäftsfeld gerade nicht der Mediensektor ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass der – zumindest kurz- bis mittelfristige – Nutzen des Besitzes von Massenmedien nicht in der unmittelbaren Erzielung finanziellen Gewinns aus regulärer Geschäftstätigkeit (Ressource erster Ordnung) besteht. Im Vordergrund stünde in diesem Fall die mittelbare Funktion von Medien, nämlich die Option auf instrumentellen Einsatz derselben für andere Ziele. In einem so verstandenen Sinne stellen Massenmedien für den jeweiligen Akteur, der sie besitzt, subventioniert oder auf anderem Wege kontrolliert, eine Ressource zweiter Ordnung dar.
Wenn man den Fokus auf das unmittelbare Objekt legt, lassen sich zwei Arten eines instrumentellen Einsatzes von Massenmedien analytisch unterscheiden: Einerseits können Massenmedien als politische Ressource dienen, die es einem Akteur ermöglicht, seine politischen Interessen publizistisch zu befördern, indem Einfluss auf politische Entscheidungsträger zum Zweck der Erzielung wirtschaftlicher Vorteile ausgeübt wird; andererseits können Massenmedien eine ökonomische Ressourcedarstellen, wenn mit gezielten Veröffentlichungen versucht wird, wirtschaftliche Konkurrenten zu schwächen. Auf einer eher reaktiven Ebene beinhaltet die Kontrolle über Massenmedien in gewissem Maße auch eine Schutzfunktion in Konflikten mit anderen politischen oder ökonomischen Akteuren. Die übergeordneten Ziele sind vor allem die Absicherung, idealerweise sogar der Ausbau der eigenen wirtschaftlichen und politischen Stellung. Die Macht wirtschaftlicher Konglomerate wird somit durch Medienmacht weiter verfestigt – und gleichzeitig trägt dies dazu bei, dass die realiter ablaufenden politischen Entscheidungs- und Implementierungsprozesse informell, intransparent und schwer kontrollierbar bleiben.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Transformationsprozess in der Russländischen Föderation mit dem Fokus auf die Interdependenzen zwischen den Bereichen Politik, Ökonomie und Massenmedien zu analysieren. Durch die Verknüpfung dieser drei Transformationsfelder soll die Entwicklung von Strukturen und Prozessen während der Amtszeit von Staatspräsident El’cin miteinander in Beziehung gesetzt und erklärt werden, wie und warum sich ein Regime herausbildete, das in hohem Maße informelle und intransparente Züge aufweist, in dem eine relativ geringe Zahl partikularer Akteure überproportional profitiert und potentielle Gegengewichte schwach sind und in dem Massenmedien von politischen und ökonomischen Akteuren zuvorderst als Instrument zur Beförderung eigener Interessen gesehen werden. In konzeptioneller Hinsicht wird der Arbeit ein auf Max Webers Begriff des politischen Kapitalismus aufbauendes Modell zugrunde gelegt, um dieses Ineinandergreifen unterschiedlicher Strukturen und Prozesse zu analysieren und zu erklären, inwiefern diese Interdependenzen einer bestimmten Logik folgen.
1.2 Forschungsstand und Quellenlage
Die Literatur zur Transformation Russlands ist ausgesprochen umfangreich. Dabei zeigen sich einige Besonderheiten. So sticht insbesondere bei einem Teil der Überblicksliteratur eine Zweiteilung ins Auge: Der Übergang der Präsidentschaft von El’cin auf Putin wird als einschneidende Zäsur begriffen, und teilweise wird insinuiert, der jeweilige Staatspräsident drücke dem ganzen politischen System seinen jeweiligen Stempel auf.2 Andere Darstellungen mit weniger personalisierter Herangehensweise gehen davon aus, dass das institutionelle und strukturelle Gefüge, wie es sich in den 1990er Jahren herausgebildet hat, auch die politischen Entwicklungen in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts prägte, wenn nicht gar determinierte.3
Ein bedeutender Teil der umfangreicheren Studien zur politischen Transformation der Russländischen Föderation stellt Fragen der Demokratisierung in den Mittelpunkt. Ihnen liegt – zumindest implizit – das normativ grundierte teleologische Moment der Transitionsforschung zugrunde, wonach sich die mittelost- und osteuropäischen sowie die Nachfolgestaaten der Sowjetunion auf den Weg zu Demokratie (und Marktwirtschaft) gemacht hätten. Nachdem Ende der 1990er Jahre immer deutlicher wurde, dass das optimistische Post-1989-Paradigma fortschreitender Demokratisierung keinesfalls universelle Gültigkeit beanspruchen konnte,4 entstanden Forschungszweige, die sich der „Demokratie mit Adjektiven“ widmeten.5 Innerhalb kurzer Zeit entstanden Arbeiten, die sich mit „Grauzonen“, „hybriden Systemen“, „defekter Demokratie“, „competitive authoritarianism“ und ähnlichem beschäftigten – häufig auch und gerade unter Bezugnahme auf die Nachfolgestaaten der Sowjetunion.6 Bei diesen Untersuchungen fällt auf, dass Fragen der wirtschaftlichen Transformation und der Massenmedien in aller Regel nur am Rande behandelt und nicht systematisch mit der politischen Transformation verknüpft werden.
Da das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit kein normatives ist, setzt sie sich nicht mit den konzeptionellen Überlegungen der Literatur aus diesem Forschungsstrang auseinander. Gleichwohl werden bestimmte Ergebnisse in die Diskussion mit einbezogen – insbesondere dann, wenn es um strukturelle, institutionelle und funktionelle Merkmale des politischen Systems der Russländischen Föderation geht.
Neben diesen übergreifenden Studien zur politischen Transformation liegen eine Reihe von politikwissenschaftlichen Arbeiten vor, die sich mit einzelnen Aspekten, Institutionen, Prozessen und Interaktionen im politischen System Russlands befassen. Dazu gehören in Bezug auf das Regierungssystem etwa Monographien zum Staatspräsidenten, zur Staatsduma und zum Föderationsrat, zur Regierung, zur Gesetzgebung, zum Dekretrecht des Staatspräsidenten, zum Parteiensystem und zum Föderalismus.7 Unabhängig von ihrem jeweils spezifischen theoretischen Ansatz konzentrieren sich diese Arbeiten weitgehend auf die Sphäre der Politik und gehen höchstens am Rande auf die Bereiche Ökonomie und Medien ein. Dessen ungeachtet beinhalten sie wichtige Ergebnisse, mit denen sich diese Arbeit in den entsprechenden Abschnitten auseinandersetzt.
Die Literatur zur ökonomischen Transformation der Russländischen Föderation ist sehr umfangreich. Sie reicht von breit angelegten und vergleichenden Arbeiten8 bis hin zu Untersuchungen von einzelnen Wirtschaftssektoren oder Feldern der Wirtschaftspolitik9. Diese Studien beziehen – in unterschiedlich starkem Maße – die entsprechenden politischen Prozesse mit ein, bieten aber meist keine elaborierte Verknüpfung zwischen beiden Sphären.
Sowohl Wirtschaft als auch Politik stehen bei einigen Studien gemeinsam im Fokus, die sich mit der Interaktion politischer und wirtschaftlicher Akteure in Russland beschäftigen. Hierzu gehören Arbeiten, die sich mit dem Einfluss kollektiver ökonomischer Akteure und mit Fragen des Korporatismus beschäftigen,10 vor allem jedoch Studien zur Rolle von Wirtschaftseliten und ihrer Verflechtung mit der politischen Sphäre in Russland während der Präsidentschaft El’cins.11 Bei allen Unterschieden in Bezug auf den jeweils verfolgten Ansatz und auf das Gewicht, das Fragen der politischen Transformation jeweils beigemessen wird, bieten diese Untersuchungen einige wichtige Anknüpfungspunkte für die vorliegende Arbeit und werden in den entsprechenden Abschnitten in die Diskussion einbezogen. Gleichzeitig eint diese Forschungen, dass der Medienbereich allenfalls ganz am Rande berücksichtigt wird.
Umfangreichere Studien zur Transformation des Mediensystems in Russland gibt es verhältnismäßig wenige. Sie decken allerdings ein breites Spektrum an Schwerpunkten ab. Die meisten von ihnen sind – explizit oder implizit – normativ orientiert und stellen die Frage nach der Medienfreiheit in den Mittelpunkt. Bei einigen Arbeiten handelt es sich eher um Überblicksdarstellungen ohne weitergehenden Anspruch.12 Zahlreiche Untersuchungen konzentrieren sich auf bestimmte Medienformen,13 Wandel in Journalismus und Rezipientenverhalten14 oder (verfassungs)rechtliche Fragen zu Pressefreiheit und Zensurverbot15. Fragen der politischen Transformation spielen in diesen Studien häufig nur eine untergeordnete, jedenfalls wenig systematisierte Rolle,16 die ökonomische Transformation behandeln sie in der Regel nur am Rande.
Über die genannten Arbeiten hinaus liegt eine kleine Zahl an Untersuchungen vor, die die Analyse der Medientransformation stärker mit der politischen Transformation verbinden. Bei der Mehrheit von ihnen fällt auf, dass die politischen Strukturen und Prozesse nur als Begleitrahmen der jeweiligen Untersuchung zur Sprache kommen, dass aber die Wechselwirkungen nicht systematisch erforscht werden.17 Enger ist die Verbindung in den breit rezipierten Untersuchungen von Sarah Oates, Laura Belin und Ivan Zasurskij.
Oates’ umfassende Studie18 widmet sich der zentralen Rolle des Fernsehens bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Russland zwischen 1993 und 2004 und kommt zu dem Ergebnis, dass das Fernsehen in vielfacher Hinsicht die Rolle übernommen habe, die klassischerweise politischen Parteien zukommt („broadcast party“). Belins Untersuchung19 interpretiert die Entwicklung der russländischen Massenmedien in den 1990er Jahren als Vorgeschichte der Wiedererlangung staatlicher Kontrolle über die Massenmedien während der Präsidentschaft Putins. Sowohl für Oates als auch für Belin kommt dabei den negativen Auswirkungen in Bezug auf die Demokratie große Bedeutung zu. Welche politischen und ökonomischen Strukturen und Prozesse wie auf die Entwicklung der Massenmedien einwirkten, wird dagegen in beiden Arbeiten nicht vertieft analysiert.
Zasurskijs Arbeiten20 schließlich bieten eine materialreiche Geschichte der Medienentwicklung seit Mitte der 1980er Jahre mit dem Anspruch, die beiden Sphären Politik und Medien zu verbinden. Dabei vertritt Zasurskij die These, dass es Mitte der 1990er Jahre zu einer Medialisierung der Politik, „das heißt zu einer Verlagerung des politischen Prozesses in den symbolischen Raum der Massenmedien“21 gekommen sei. Durch die Institutionalisierung neuer Machtzentren innerhalb der Medien habe sich in der Folge ein „medien-politisches System“ (media-političeskaja sistema) herausgebildet. Bei aller Detailfülle und einer Vielzahl an Thesen unterbleibt in Zasurskijs Arbeiten gleichwohl eine systematisierende Engführung der politischen und der Medientransformation.
Darüber hinaus blenden auch Oates, Belin und Zasurskij in ihren medienzentrierten Untersuchungen Fragen der ökonomischen Transformation weitgehend aus. Die Interdependenz des russländischen Transformationsprozesses in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien wird bei ihnen nicht eingehend untersucht. Somit bleiben entscheidende Fragen zur Genese der spezifischen Regimekonfiguration während der Amtszeit El’cins und den dafür verantwortlichen Faktoren unbeantwortet.
Die Quellenlage für eine Arbeit, die sich mit Interdependenzen zwischen Politik, Ökonomie und Massenmedien in Russland beschäftigt, ist nicht ganz einfach. Der Grund dafür ist der Tatsache geschuldet, dass ein Teil der Daten und Informationen nicht offiziell veröffentlicht wurden (und werden). Auch staatliche Statistiken sind teilweise widersprüchlich und können keine uneingeschränkte Zuverlässigkeit beanspruchen. Veröffentlichungen von Nichtregierungsorganisationen, Forschungs- und Politikberatungsinstituten und dergleichen können undeklariert die Interessen eines politischen oder ökonomischen Akteurs befördern. Ähnlich verhält es sich bei journalistischen Publikationen, die ebenfalls die Interessen eines bestimmten Akteurs bedienen können (was wiederum Teil der Analyse im Medienkapitel sein wird). Gleichzeitig kann auf diese Quellen nicht komplett verzichtet werden, weil sie häufig wichtige, offiziell nicht veröffentlichte Informationen enthalten.
Um die Einschränkungen, die aus dieser disparaten Materiallage erwachsen, so weit wie möglich zu reduzieren, geht diese Arbeit mehrgleisig vor. So wurde eine Vielfalt an Quellen ausgewertet und gegeneinander abgewogen. Dabei war darauf zu achten, dass die jeweiligen Informationen bei mehreren, voneinander unabhängigen Quellen zu finden sind. Darüber hinaus fand eine Analyse der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur statt. Diese Vorgehensweise hat auch zur Folge, dass in einigen Fällen Plausibilitätsannahmen gemacht werden und in anderen Fällen divergierende Informationen gegenübergestellt und diskutiert werden müssen, ohne letzte Zweifel ausräumen zu können.
Eine Vielzahl an Quellen liegt elektronisch vor und ist auf diesem Wege auch am leichtesten greifbar. Dazu gehören unter anderem Datenbanken mit den Rechtsakten der Russländischen Föderation und die Volltextdatenbank Integrum, die nahezu alle in Russland herausgegebenen Tages- und Wochenzeitungen sowie Meldungen von Nachrichtenagenturen, eine große Zahl an Zeitschriften und eine Vielzahl weiterer Informationsquellen enthält. Des weiteren wurden viele Publikationen von Nichtregierungsorganisationen sowie Forschungs- und Politikberatungsinstituten nur in sehr geringer Stückzahl tatsächlich gedruckt und sind dementsprechend nicht leicht greifbar; vielfach wurden sie jedoch – parallel oder nachträglich – im Internet zugänglich gemacht. Ähnliches gilt für einzelne russländische wissenschaftliche Arbeiten.22 Dies hat zur Folge, dass in dieser Arbeit bei bestimmten Nachweisen auf die Angabe einer Seitenzahl verzichtet werden muss. Falls es sich um längere, jedoch gegliederte Texte handelt, werden das Kapitel oder der Abschnitt der Fundstelle angegeben.
Jede Arbeit, die sich mit einem Land beschäftigt, in dem nicht das lateinische Alphabet gilt, steht vor der Frage, welche Art der Umschrift angewandt werden soll. In der vorliegenden Arbeit findet die wissenschaftliche Transliteration Anwendung, weil sie den Vorteil größtmöglicher Eindeutigkeit besitzt. Das bedeutet, dass außer Personen- auch andere Eigennamen transliteriert werden. Die einzigen Ausnahmen von dieser Regel bilden „Sowjet“/„sowjetisch“, „Moskau“ und „St. Petersburg“. Bei wörtlichen Zitaten wird jeweils die dort verwendete Umschrift beibehalten. Deshalb lässt es sich leider nicht vermeiden, dass im Einzelfall verschiedene Schreibweisen eines identischen Ausdrucks nebeneinander vorkommen können. Dies gilt auch für Personennamen im Literaturverzeichnis, da russische Autoren je nach Publikationsort teilweise unterschiedlich geschrieben werden. Abkürzungen werden – sofern es standardisierte Formen gibt – nach der russischen Bezeichnung transliteriert. Ausnahmen von dieser Regel sind „UdSSR“ und „KPdSU“. Details finden sich im Abkürzungsverzeichnis.
Im Russischen wird zwischen den Adjektiven „rossijskij“ und „russkij“ unterschieden. Ersteres bezeichnet die Zugehörigkeit zum Staat Russland, Letzteres bezieht sich auf die ethnische bzw. sprachliche Dimension. Da diese Unterscheidung in einem multinationalen Staat wie Russland große Bedeutung gewinnt, wird in der vorliegenden Arbeit „rossijskij“ mit „russländisch“ und „russkij“ mit „russisch“ wiedergegeben. Die offizielle Staatsbezeichnung lautet seit dem Beschluss des Volksdeputiertenkongresses vom 17.04.1992 „Rossijskaja Federacija – Rossija“. Die Verfassung von 1993 übernimmt diese Bezeichnung. In Analogie dazu werden „Russland“ und „Russländische Föderation“ in der Folge synonym gebraucht und als Abkürzung „RF“ verwendet. Bei wörtlichen Zitaten wird jedoch der Originalwortlaut beibehalten.
Alle Zitate aus dem Russischen wurden übersetzt. Soweit nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen vom Verfasser.
1.3 Der Aufbau der Arbeit
Um das beschriebene Phänomen zu analysieren, geht die Arbeit in fünf Schritten vor. Nachdem in Kapitel 2 der theoretische Analyserahmen entfaltet wurde, widmet sich das 3. Kapitel kurz der Verfassungsnorm auf der Grundlage der russländischen Verfassung von 1993. Kapitel 4 analysiert ausführlich die Verfassungsrealität in der Ära El’cin (1993-1999). Im 5. Kapitel stehen die ökonomische Transformation und die Herausbildung mächtiger Wirtschaftskonglomerate im Vordergrund. In Kapitel 6 schließlich werden die politischen und ökonomischen Prozesse mit dem Feld der Massenmedien in Beziehung gesetzt und deren hohe Interdependenz herausgearbeitet.
Kapitel 2 entwickelt den theoretisch-analytischen Rahmen der Arbeit. Er basiert auf der Grundkonzeption des „politischen Kapitalismus“, der auf Max Weber zurückgeht und dessen Grundcharakteristikum im Phänomen des rent seeking besteht. Darauf aufbauend werden aktuelle theoretische Ergebnisse der Transformationsforschung mit dieser Konzeption verknüpft. Die zentralen weiteren theoretischen Bausteine behandeln die möglichen Ursachen und Folgen des politischen Kapitalismus. Sie gruppieren sich um informelle politische Entscheidungsprozesse und die Stärkung der Exekutive; das Interesse privilegierter partikularer Akteure an der Bewahrung des Status quo; die Konzentration politischer und ökonomischer Macht mit der inhärenten Tendenz zur Privatisierung des Staates; sowie den daraus folgenden Bedeutungszuwachs von Massenmedien als politische Ressource.
Die Analyse der Verfassungsnorm in Kapitel 3 zeigt, dass die Russländische Föderation nach der seit Ende 1993 geltenden Verfassung formal ein präsidentiell-parlamentarisches System besitzt. In präsidentiell-parlamentarischen Systemen verfügt der Staatspräsident üblicherweise über eine starke Stellung. In Russland jedoch ist die Machtposition des Staatspräsidenten im Vergleich mit anderen präsidentiell-parlamentarischen Systemen noch stärker ausgeprägt, so dass manche Autoren sogar von „Superpräsidentialismus“23 sprechen.
Die praktischen Folgen des strukturellen Ungleichgewichts zugunsten des Staatspräsidenten bzw. der Exekutive sind das zentrale Thema des 4. Kapitels. Durch die Analyse der politischen Prozesse zwischen 1993 und 1999 soll geprüft werden, welche Auswirkungen die in der Verfassungsnorm angelegte starke Exekutivlastigkeit und das damit verbundene Defizit an Verantwortlichkeit gegenüber Legislative und Öffentlichkeit in der Verfassungsrealität hatten. Schwerpunkte der Analyse bilden dabei die Interaktion von Exekutive und Legislative, innerexekutive Strukturen und Prozesse und verbunden damit Fragen der Informalität und Intransparenz von Entscheidungsprozessen sowie Politikgestaltung im Spannungsfeld zwischen Gesetzgebung und „untergesetzlicher Rechtsetzung“. Dabei zeigt sich, dass Staatspräsident El’cin schwerpunktmäßig in den Bereichen Wirtschaftspolitik, Privatisierung und Massenmedien sehr häufig von seinem Vetorecht gegenüber der parlamentarischen Gesetzgebung Gebrauch machte und dass diese Politikfelder im Gegenzug in hohem Maße durch untergesetzliche Normsetzung (vor allem Präsidentendekrete) reguliert wurden. Mit den beiden Politikfeldern Wirtschaftspolitik/Unternehmensprivatisierung respektive Massenmedien beschäftigen sich deshalb die folgenden Kapitel 5 und 6 eingehender.
Kapitel 5 widmet sich der ökonomischen Transformation. Der Schwerpunkt liegt dabei auf wichtigen (wirtschafts-)politischen Entscheidungen. Vor dem Hintergrund der schon im vorangehenden Kapitel herausgearbeiteten untergeordneten Rolle des Parlaments und der Dominanz der Exekutive ist dabei insbesondere von Interesse, ob und in welchem Umfang bestimmte Weichenstellungen zu Wettbewerbsverzerrungen und zur Begünstigung partikularer Akteure führten, wie diese mit der Exekutive interagierten und welche Rolle untergesetzliche Normsetzung dabei spielte. Es kann gezeigt werden, dass Strategien des rent seeking für bestimmte Wirtschaftsakteure erheblich lukrativer waren als die des profit seeking und dass gerade von diesem eher kleinen Kreis von Profiteuren unüberschaubare und intransparente Unternehmenskonglomerate aufgebaut wurden, die über erhebliche wirtschaftliche und politische Macht verfügten. Diesen Akteuren wird im Zeitverlauf auch auf dem Feld der Massenmedien eine wichtige Rolle zukommen.
Das 6. Kapitel untersucht den Mediensektor in Russland. Auch hier wird der Faden der herausgehobenen Position der Exekutive in der Politikgestaltung wieder aufgenommen und das Politikfeld der Massenmedien daraufhin untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die Interaktion zwischen Legislative und Exekutive sowie Art, Umfang und Konsequenzen untergesetzlicher Rechtsetzung und -umsetzung. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird die Rolle nichtstaatlicher Akteure im Medienbereich – das heißt insbesondere der aus Kapitel 5 bekannten Konglomerate – am Beispiel von fünf unterschiedlichen Akteuren eingehend analysiert. Wann, in welchem Umfang und mit welchen Motiven engagierten sich diese auf dem Feld der Massenmedien? Ebendiese fünf Akteure stehen im letzten Teil des Kapitels exemplarisch für den instrumentellen Einsatz der von ihnen jeweils kontrollierten Medien zur Wahrung ihrer jeweiligen – politischen und ökonomischen – Interessen. Dies zeigt abschließend eine vertiefte Analyse dreier, gemeinhin als „Medienkriege“ bezeichneter medialer Kampagnen. Dabei werden auch die variable Allianzenbildung sowie die wechselnde Rolle staatlicher Medien herausgearbeitet.
1 Vgl. Ismayr 2008: 53-56.
2 Vgl. exemplarisch die Titelgebung bei Shevtsova 1999, 2003.
3 Vgl. bspw. Remington 1999, 2011; S. White 2000a, 2011.
4 Vgl. den programmatischen Beitrag von Carothers 2002.
5 Vgl. die Pionierarbeit von Collier/Levitsky 1997.
6 Konzeptionell möglicherweise am umfassendsten die Typologisierung „defekter Demokratie“ bei Merkel et al. (2003) und die darauf aufbauenden Regionalanalysen (2006) sowie der Ansatz des „competitive authoritarianism“ von Levitsky/Way (2002, 2010). Vgl. auch Beichelt 2004; Bos 2003; Bendel/Croissant/Rüb 2002; Erdmann/Kneuer 2011; Fish 2005; Mangott 2002a, b; McFaul 2001; Schedler 2006; Stewart et al. 2012 sowie die theoretisch-konzeptionell kritischen Beiträge von Bogaards 2009 und Morlino 2009.
7 Z. B. Huskey 1999, Nichols 2001; Remington 2001, Steinsdorf 2001, Wiest 2003, Troxel 2003; Shevchenko 2004; Chaisty 2006; Schaich 2004; Hale 2006, Legutke 2001, March 2002, D. White 2006; Ross 2002.
8 Exemplarisch seien genannt Åslund 2002; Granville/Oppenheimer 2001; Sutela 2004.
9 Breit rezipiert bspw. Adachi 2010; Barnes 2006; Fortescue 2006; Gaddy/Ickes 2002; Johnson 2000; Lane 1999, 2002; Shleifer/Treisman 2000.
10 Zu den umfangreicheren Arbeiten gehören z. B. Peregudov 2011; Peregudov/Lapina/Semenenko 1999; Stykow 2006.
11 Etwa Harter et al. 2003; Pleines 2003; Westphal 2000.
12 Bspw. Arutunyan 2009 sowie in Form von Länderberichten zu den osteuropäischen Mediensystemen im Transformationsprozess Stegherr/Liesem 2010.
13 Etwa Printmedien (Steinsdorff 1994), Fernsehen (Mickiewicz 1997, 1999b;Amelina 2006; mit Schwerpunkt auf Putins ersten beiden Amtszeiten Burrett 2011) oder Regionalzeitungen (Pietiläinen 2002).
14 Zur Professionalisierung und zum Selbstverständnis von Journalisten bspw. Pasti 2007 und zum Rezeptionsverhalten von Fernsehzuschauern Mickiewicz 2008. Kol’cova unternimmt den Versuch, die Nachrichtenproduktion in Russland als Manifestation von Machtbeziehungen im Foucaultschen Sinne zwischen einer Vielzahl von Akteuren zu rekonstruieren (Kol’cova 2001, Koltsova 2006).
15 Deppe 2000.
16 Ausnahmen sind Steinsdorff 1994 (für die Jahre 1985-1993) und Burrett 2011 (für die Jahre 2000-2008).
17 Dies gilt z. B. auch für empirisch sehr gehaltvolle Arbeiten, die ihren Schwerpunkt auf die 1990er Jahre legen, wie etwa Gladkov 2002 und Trautmann 2002.
18 Oates 2006.
19 Belin 2002c.
20 I. Zasurskij 1999b, 2001; I. Zassoursky 2004.
21 I. Zasurskij 1999b: 8.
22 In einigen Fällen sind die Publikationen inzwischen nicht mehr unter der angegebenen URL zu finden, teilweise auch komplett aus dem Internet verschwunden. Kopien liegen dem Verfasser dieser Arbeit jedoch vor.
23 Meines Wissens als erster Holmes (1993/94).
2. Theoretisch-konzeptioneller Rahmen
Der Begriff der „Transformation“ wird im Rahmen dieser Untersuchung als Oberbegriff für einen umfassenden (Sub-)Systemwandel und -wechsel benutzt, welcher weit über „Reform(en)“ hinausgeht:
„Reformen finden innerhalb eines gegebenen Systemparadigmas statt, das auf diesem Weg einer veränderten Umwelt angepasst, modernisiert oder effizienter gestaltet wird. Im Laufe der Zeit können zwar konsekutive Reformen evolutionär zu einem neuen Systemparadigma führen, das aber zu Beginn weder so gewollt, noch sprunghaft institutionalisiert wird.“1
Demgegenüber führt eine Transformation zur Ersetzung eines bestehenden Systemparadigmas durch ein neues. Dies geschieht im Rahmen von – teilweise abrupten, teilweise jahrelangen – Prozessen, die parallel, aber nicht notwendigerweise im Gleichschritt, alle gesellschaftlichen Bereiche erfassen: vom politischen über das ökonomische und das Rechtssystem bis zur Sozialstruktur.
Die Transformation in den ostmitteleuropäischen Staaten gilt im historischen Weltmaßstab als einzigartig2 – und manchem sogar als paradigmatisch, weil sich das Transformationsziel an westlichen Mustern orientierte, allen voran Demokratie und Kapitalismus. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Transformationsprozesse grundsätzlich offen und reversibel sind. Das von zentralen Akteuren proklamierte Ziel kann verfehlt werden. Ein roll back ist ebenso möglich wie ein Steckenbleiben, es kann aber auch zur Herausbildung und Stabilisierung eines neuen Systems jenseits von Ausgangs- und Zielparadigma kommen.
Wenn folglich in dieser Arbeit von Transformation in Russland gesprochen wird, bezieht sich dies zunächst nur auf die Ablösung der alten sozialistischen Ordnung durch grundlegend andere Institutionen- und Regelsysteme. Dies schließt nicht nur die politischen, sondern die Umbruchprozesse in der gesamten Gesellschaft mit ein, denn auch wenn eine neue Verfassung formal und vordergründig für eine tabula rasa zu sorgen scheint, ist mit ihrem Inkrafttreten der Transformationsprozess noch lange nicht beendet. Die Verfassung kann zwar einen wichtigen Rahmen vorgeben, die gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesse – sei es die Verfassungsrealität, die Umgestaltung der Wirtschaft, des Mediensystems etc. – jedoch nicht determinieren.
In den letzten Jahren etablierte sich nach und nach eine Forschungsrichtung, die häufig, dem Titel eines Pionierbandes folgend, mit dem Etikett „varieties of capitalism“ versehen wird und die große Spannbreite institutioneller Ausgestaltungen kapitalistischer Wirtschaftsordnungen (in politischer und ökonomischer Hinsicht) zum Gegenstand hat.3 Auffällig ist, dass sich die Arbeiten aus diesem Umfeld sowohl in theoretischer als auch in empirischer Hinsicht nahezu ausschließlich auf etablierte und stabile Industriestaaten beziehen. Die spezifischen Dynamiken in Transformationsstaaten können mit diesem Ansatz kaum erfasst werden.4 Der Grund dafür ist, dass dieser Ansatz von Voraussetzungen ausgeht, die im Laufe eines Systemwandels überhaupt erst geschaffen werden müssen. In besonderem Maße gilt dies dann, wenn Transformationsstaaten vor einem „Dilemma der Gleichzeitigkeit“ stehen, weil eine zumindest „doppelte Transformation“ mehr oder minder zeitgleich eingeleitet und bewältigt werden muss: Der Aufbau einer neuen politischen Ordnung und parallel eines neuen Wirtschaftssystems.5
Für diese Arbeit muss daher ein spezifisches Analyseinstrumentarium entwickelt werden. Dabei bietet es sich an, auf Max Webers Konzeption des politischen Kapitalismus zurückzugreifen und diese mit Hilfe weiterer theoretischer Bausteine, die in der Transformationsforschung entwickelt wurden, auszudifferenzieren. Dieser Rahmen soll den politischen und wirtschaftlichen Dynamiken im osteuropäischen und insbesondere russländischen Kontext gerecht werden.
In seinem Hauptwerk „Wirtschaft und Gesellschaft“ legt Max Weber eine Typologie kapitalistischer Wirtschaftsformen vor. Einer der von Weber identifizierten Typen lässt sich mit großem Gewinn auf die Umbruchsjahre am Ende der Sowjetunion und die erste Dekade der Eigenstaatlichkeit der Russländischen Föderation anwenden. Es handelt sich dabei um den Typus, der bei Weber „politisch orientierter Kapitalismus“6 heißt und der im weiteren Verlauf der Arbeit, wenn nicht unmittelbar auf Webers Konzeption Bezug genommen wird, „politischer Kapitalismus“ genannt werden soll.7
Weber kategorisiert insgesamt sechs „untereinander artverschiedene typische Richtungen ‚kapitalistischerʻ […] Orientierung des Erwerbs“8, das heißt der Generierung von Einnahmen und Gewinn durch ökonomische Akteure. Unter diesen sechs „Richtungen“ sind drei, die er unter den Oberbegriff „politisch orientierter Kapitalismus“ subsumiert:
„3. Orientierung an Chancen des aktuellen Beuteerwerbs von politischen oder politisch orientierten Verbänden oder Personen: Kriegsfinanzierung oder Revolutionsfinanzierung oder Finanzierung von Parteiführern durch Darlehen oder Lieferungen.
4. Orientierung an Chancen des kontinuierlichen Erwerbs kraft gewaltsamer, durch die politische Gewalt garantierter Herrschaft: a) kolonial (Erwerb durch Plantagen mit Zwangslieferung oder Zwangsarbeit, monopolistischer und Zwangshandel); b) fiskalisch (Erwerb durch Steuerpacht und Amtspacht, einerlei ob in der Heimat oder kolonial).
5. Orientierung an Chancen des Erwerbs durch außeralltägliche Lieferungen [an] politische Verbände.“9
Der fundamentale Unterschied zwischen dem „politisch orientierten Kapitalismus“ und dem „rationalen, marktorientierten Kapitalismus“, den Weber im „Okzident“ als vorherrschend ansieht,10 betrifft deren Organisations- und Funktionsprinzipien. Im Kern unterscheiden sie sich folgendermaßen: Der rationale Marktkapitalismus fußt auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Ökonomische Akteure akkumulieren ihre Profite durch „Orientierung an Marktchancen“11, sie stehen also untereinander in einem – idealtypisch freien und unbeschränkten – Wettbewerbsverhältnis. Im politischen Kapitalismus hingegen befinden sich die Produktionsmittel nicht notwendig in privatem Eigentum, und die erzielten Gewinne resultieren nicht aus dem Agieren auf einem Markt, sondern kommen durch die Ausnutzung unterschiedlicher Formen politischer Herrschaftsausübung sowie der daraus resultierenden gleichheitswidrigen Verzerrung der wirtschaftlichen Spielregeln zustande.
Weber analysierte in seiner Arbeit vor allem den politischen Kapitalismus in den historischen Gesellschaften der Antike, des Orients und in Fernost. Sein analytisches Unterscheidungsinstrumentarium lässt sich jedoch auch in der Gegenwart gewinnbringend nutzen – auch und gerade im Falle der Transformationsprozesse in Osteuropa und in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Dazu müssen seine zentralen Überlegungen weiterentwickelt und mit neueren wissenschaftlichen Ansätzen und Begrifflichkeiten verbunden werden.
Die polnische Soziologin Jadwiga Staniszkis entwickelte 1991 einen theoretisch-konzeptionellen Analyserahmen, dem sie die Bezeichnung „political capitalism“ gab.12 Am Beispiel Polens ab den 1980er Jahren untersuchte sie die sukzessive Transformation des wirtschaftlichen Systems sowie die Handlungen und Interaktionen politischer und ökonomischer Akteure. Staniszkis bleibt in ihrer frühen Arbeit leider eine umfassende Definition des Begriffs „politischer Kapitalismus“ schuldig, aber verstreut finden sich Attribute und Generalisierungen, aus denen sich die Kernpunkte und Funktionslogiken ableiten lassen.
Für Staniszkis ist im politischen Kapitalismus erstens die enge Verbindung von Macht und Kapital von zentraler Bedeutung.13 Sie bewegt sich zweitens auf den Bahnen des transformationstheoretischen Ansatzes der Pfadabhängigkeit mit elitentheoretischer Grundierung, wenn sie schreibt, der politische Kapitalismus sei „the result of actions from above initiated by the Communist power elite and not an expression of the economic expansion of the traditional private sector“14. Drittens schließlich ist der politische Kapitalismus für Staniszkis eine temporäre Organisationsform, das heißt eine Phase und ein bestimmter Modus auf dem Weg zu einem anderen Wirtschaftssystem. Damit ist bei Staniszkis jedoch – im Gegensatz etwa zu Fukuyama – keine teleologische Aussage verbunden, weil die weitere Entwicklung prinzipiell offen und unter Umständen auch umkehrbar ist.15
Basierend auf der Entwicklung in Polen Mitte bis Ende der 1980er Jahre destilliert Staniszkis zudem drei zentrale Merkmale des politischen Kapitalismus in der Endphase des Sozialismus heraus:
- the linkage of power over people and things in industry and the state administration with activity geared toward profit for certain individuals in a private company;
- the fact that the main customer of these companies is not the consumer market, but state industry and the structures of the empire in the broad sense. This form also maintains consumption by members of the apparatus as a social group on a relatively high level (such as, the exchange of favors between the apparatchiks of the various departments; services for their own use);
- the derivation of profits from the exclusive access reserved for ,owners of companiesʻ who have dual status to attractive markets and capital, decision-making centers, information, goods in short supply—that is, influence connected with a monopoly position in state industry.16
Aus dieser Aufzählung ergibt sich, dass in Staniszkis’ Konzeption die Umwandlung von politischem in ökonomisches Kapital eine gewichtige Rolle spielt. Dies bezieht sich nicht nur auf die formelle oder informelle Privatisierung von Unternehmen(steilen), sondern generell auf exklusiven Zugang zu sämtlichen staatlichen Institutionen und Ressourcen. Darunter fallen nicht nur Finanzmittel, sondern zum Beispiel auch Lizenzen und Genehmigungen oder (Insider-)Informationen. Daraus ergeben sich vielfache Möglichkeiten zur Externalisierung der eigenen Kosten bei gleichzeitiger Internalisierung der Gewinne. Mit anderen Worten: Den beteiligten Akteuren geht es um die Erzielung einer politischen Rente.17
Wenn man sich die eingangs dieses Abschnittes angeführten Ausführungen Max Webers noch einmal vergegenwärtigt, wird deutlich, dass auch bei ihm die Quintessenz des politisch orientierten Kapitalismus darin besteht, dass ein begrenzter Kreis von Akteuren privilegierten Zugang zu politischen bzw. staatlichen Institutionen, Akteuren und Ressourcen hat und auf diesem Weg politische Renten vereinnahmt. Es verwundert deshalb, dass sich Staniszkis bei ihrem Begriff des politischen Kapitalismus an keiner Stelle auf Weber beruft – weder positiv noch negativ.18
Eine mögliche Erklärung hierfür bieten Eyal, Szelényi und Townsley. Nach ihrer Interpretation zielt Webers politisch orientierter Kapitalismus auf die Logik des ökonomischen Systems, wohingegen Staniszkis’ politischer Kapitalismus das Personal und die Herausbildung einer kapitalistischen Klasse in den Blick nehme. Weiter heißt es:
„For Weber, political capitalism is capitalism in so far as it is oriented towards the rational acquisition of profits, but it is political because this happens under the tutelage of the state and/or under conditions of systematic political interference in the economic system.“19
Obige Beschreibung des jeweiligen Hauptfokus von Weber und Staniszkis ist zweifellos korrekt, aber dadurch wird meine These der gemeinsamen Quintessenz des Analysekonzepts politisch orientierter/politischer Kapitalismus nicht widerlegt. Und die Behauptung von Eyal, Szelényi und Townsley, wonach bei Weber auch im politisch orientierten Kapitalismus „rational acquisition of profits“ stattfinde, hält einer kritischen Prüfung nicht stand, denn Weber schreibt an einer Stelle explizit:
„Es ist von vornherein klar: dass jene politisch orientierten Ereignisse, welche diese Erwerbsmöglichkeiten bieten, ökonomisch: — von der Orientierung an Marktchancen (d. h. Konsumbedarf von Wirtschaftshaushaltungen) her gesehen, irrational sind.“20
Aus diesen Äußerungen lässt sich ableiten, dass in Webers politisch orientiertem Kapitalismus zwei Grundpostulate des „rationalen, marktorientierten Kapitalismus“ nicht erfüllt werden: Zum einen findet keine oder höchstens eine geringe gesamtstaatliche Wohlfahrtssteigerung statt, weil es nur geringe Anreize gibt, Gewinne mit dem Ziel der Effizienzsteigerung zu reinvestieren, und im Gegenzug die Anreize, vorhandene Ressourcen zur Pflege der Verbindungen zu staatlichen Akteuren einzusetzen, ungleich höher sind. Zum anderen herrschen gerade keine Marktbedingungen mit grundsätzlich gleichen Zutrittschancen für alle Teilnehmenden. Weber spricht deshalb im politisch orientierten Kapitalismus auch nicht von „Profit“, sondern von „Erwerbsmöglichkeiten“ – und meint damit das, was in der zeitgenössischen Wissenschaft als „(politische) Rente“ bezeichnet wird.21
Der Begriff des politischen Kapitalismus findet sich auch in der marxistischen Kapitalismustheorie. Wenn man mit Herbert Kitschelt versucht, unter Ausklammerung interner Kontroversen einen kleinsten gemeinsamen Nenner marxistischer Theorien zur Kapitalismusevolution herauszudestillieren, stellt der politische Kapitalismus die fünfte Entwicklungssequenz, beginnend mit der Auflösung des Feudalismus, dar. Zentral für diese Phase ist die „mikro- und makro-ökonomische Intervention des Staates in die Marktallokation“22. In diesem generellen Sinne fallen aber sämtliche westliche Marktwirtschaften unter die Rubrik „politischer Kapitalismus“. Der marxistisch verstandene politische Kapitalismus eignet sich folglich nicht zur Analyse post-sozialistischer Transformationsprozesse. Auch Staniszkis entwickelt ihren Begriff des politischen Kapitalismus augenscheinlich nicht in der Auseinandersetzung mit der marxistischen Kapitalismustheorie.
In einem ersten Zwischenschritt lässt sich somit feststellen, dass sich die Grundkonzeptionen von Weber und Staniszkis in sehr hohem Maße überschneiden. Gerade in Bezug auf das Organisationsprinzip und die Funktionslogik des politischen bzw. des politisch orientierten Kapitalismus liegt beiden eine identische Kernidee zugrunde: Ausgewählte Akteure verfügen über einen exklusiven Zugang zu staatlichen Institutionen und Ressourcen und können auf diesem Wege durch selektive politische Begünstigung politische Renten erzielen.
Weber konzipiert den politisch orientierten Kapitalismus, wie die meisten seiner Grundbegriffe, als Idealtypus. In der Realität werden sich somit Mischformen oder die parallele Existenz unterschiedlicher Sphären mit voneinander abweichenden Systemlogiken auffinden lassen. Im Folgenden findet die Bezeichnung „politischer Kapitalismus“ für diejenigen Fälle Verwendung, in denen sich seine grundlegenden Merkmale nicht nur peripher zeigen, sondern in Politik und Wirtschaft vorherrschend sind oder zumindest in Schlüsselbereichen dominieren.
In späteren Arbeiten zu den Transformationsprozessen in Osteuropa und insbesondere in Polen erweiterte Staniszkis ihren grundsätzlichen theoretischen Zugang und nahm auch die weitere Entwicklung bis Ende der 1990er Jahre in den Blick, behielt jedoch die Basiskategorie des politischen Kapitalismus bei. Zunächst hatte sie sich mit diesem Begriff in erster Linie auf die Umwandlung von politischem in ökonomisches Kapital durch die Eliten in den letzten Jahren vor und den ersten Jahren nach der Zäsur von 1989/90 sowie auf die informelle und formelle Privatisierung bezogen.23 Nun widmete sie sich verstärkt den Auswirkungen des politischen Kapitalismus auf die institutionellen Konfigurationen und Akteursinteraktionen in den Anfangsjahren des Post-Sozialismus.24
Aus Staniszkis’ späteren Arbeiten lassen sich eine Reihe von Phänomenen herausdestillieren, deren jeweiliges Auftreten wahrscheinlicher wird, wenn das politische und ökonomische System eines Staates stark von Zügen des politischen Kapitalismus geprägt werden. Da sich Staniszkis’ Erkenntnisinteresse auf Mittelosteuropa konzentriert, ihr Schwerpunkt auf den Jahren unmittelbar vor und nach der Zäsur von 1989/90 liegt und sie nur sporadisch die post-sozialistische russländische Entwicklung in den Blick nimmt, bildet ihre Konzeption eine solide Grundlage, muss jedoch erweitert und ergänzt werden.
Wie im Folgenden nachzuweisen sein wird, lassen sich im Russland der 1990er Jahre Strukturen und Prozesse beobachten, die bei Staniszkis – meist indirekt – als Aspekte und/oder Folgen des politischen Kapitalismus angedeutet werden. Sie nutzt dies jedoch nicht, um ihre Konzeption des politischen Kapitalismus weiter auszubuchstabieren. Einzelne der von ihr genannten Charakteristika werden auch von anderen Autoren untersucht, doch analysieren diese sie isoliert oder in anderen Zusammenhängen und nicht als Elemente des politischen Kapitalismus. Die Leistung dieser Arbeit besteht deshalb auch darin, induktiv – ausgehend von der Situation in Russland – und unter Rückgriff auf ganz unterschiedliche Ansätze, die ähnliche Phänomene untersuchen, die Konzeption des politischen Kapitalismus auszudifferenzieren und zu systematisieren.
Den folgenden sechs Phänomenen dürfte in Russland eine wesentliche Rolle zukommen. Die einzelnen Aspekte sind nicht zwangsläufig im Sinne einer notwendigen Bedingung für das Vorliegen von politischem Kapitalismus zu verstehen. Sehr wohl aber handelt es sich um Elemente, deren empirische Manifestation in signifikantem Umfang unter gegebenen Umständen erheblich wahrscheinlicher wird. Im einzelnen sind dies:
Rent seeking als bedeutende Form der Generierung von Einnahmen für gewichtige Akteure mit privilegierten Zugängen zur politischen Sphäre;
eine hohe Bedeutung informeller Politik, insbesondere die Umgehungdemokratisch legitimierter Institutionen und Verfahren, zum Beispiel durch exekutive Rechtsetzung;
ein von privilegierten Akteuren gemeinsam geteiltes Interesse an der Aufrechterhaltung des Status quo, insbesondere an der Bewahrung der eigenen Vergünstigungen und des Schutzes vor Konkurrenz, sowie das Bestreben, die je eigene ökonomische Position auszubauen, wodurch
die Tendenz zur Konzentration ökonomischer Macht zunehmen und
sich im Extremfall Tendenzen hin zur teilweisen Privatisierung des Staates im Sinne der Ausbeutung staatlicher Institutionen zugunsten partikularer Interessen ausbilden dürften.
Wenn die obigen Phänomene gegeben sind, kommt Massenmedien – im Vergleich mit anderen Kontexten – eine größere und zusätzliche Bedeutung zu. Gewichtige ökonomische Akteure entdecken ihren Nutzen im Rahmen politischer und wirtschaftlicher Konflikte und haben ein Interesse, sie als politische Ressource einzusetzen.
Auch wenn Max Weber den Begriff rent seeking nicht verwendet, ist klar erkennbar, dass er das Streben nach Erzielung von (politischen) Renten als zentrales Merkmal des politisch orientierten Kapitalismus sieht (siehe S. here). Auch Staniszkis folgt in ihren Arbeiten dessen grundsätzlichem Verständnis von durch politische Entscheidungen erzielten Mittelzuflüssen. Sie erläutert das Konzept der Rente aber in keiner ihrer Arbeiten systematisch, sondern beleuchtet es nur schlaglichtartig. Andere zeitgenössische Arbeiten widmen ihm mehr Aufmerksamkeit.
Historisch betrachtet, ist der Begriff der Rente eng mit David Ricardo und der Theorie der Bodenrente verbunden. Später fand er in einem breiteren Verständnis Anwendung und bezog sich auf Einkünfte, die aus der Verfügungsgewalt über Produktionsfaktoren resultieren.25 In den 1960er und 1970er Jahren entstanden im Kontext der Neuen Politischen Ökonomie zunächst das Konzept und dann der Begriff des rent seeking.26 Den in dieser Tradition stehenden Arbeiten ist gemein, dass unter rent seeking der (erfolgreiche) Versuch individueller oder kollektiver Akteure verstanden wird, die je eigenen Einkommenserzielungschancen zu bewahren, zu verbessern oder neue zu eröffnen, und zwar basierend auf individuellen Vergünstigungen, die von Akteuren des politischen Systems gewährt werden. Die Akteure des politischen Systems werden hier in einem umfassenden Sinne verstanden: Dazu gehören nicht nur die Legislative und die Exekutive, sondern ebenso die weitere Verwaltung und die Justiz – mithin alle Organe, die mit der Setzung, Ausgestaltung, Umsetzung und Interpretation von staatlicherseits zu verantwortenden Regeln befasst sind.27 In diesem Sinne wird im Folgenden von rent seeking gesprochen, wenn durch politische Entscheidungen gewährte selektive ökonomische Vorteile gemeint sind.
Wenn sich Russland in den 1990er Jahren mit dem Konzept des politischen Kapitalismus erfassen lassen soll, muss sich rent seeking als verbreiteter Bestandteil der Interaktion zwischen Wirtschaft und Politik identifizieren lassen. Dazu ist es nicht unbedingt notwendig, „economics of total rent-seeking“28 nachzuweisen. Hinreichend ist, dass dieses Phänomen ein wichtiges Strukturmerkmal ist und ökonomische Akteure beteiligt sind, die zusammengenommen einen signifikanten Anteil der Wirtschaftskraft auf sich vereinen.
Akteure, die partikulare Interessen verfolgen, erhöhen ihre Erfolgschancen umgekehrt proportional zur Bedeutung von Gegengewichten, die die Durchsetzung partikularer Interessen hemmen können. Als klassische Gegenspieler gelten parlamentarische Kräfte und die demokratische Öffentlichkeit, aber auch konkurrierende ökonomische oder gesellschaftliche Akteure können eine Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass das Interesse von Akteuren, die von der politisch induzierten Einräumung von Sonderkonditionen in signifikantem Umfang profitieren können, an der Transparenz und somit Kontrollierbarkeit dieser politischen Entscheidungsprozesse im je eigenen Fall nicht besonders ausgeprägt sein dürfte. Unterstellt werden kann hingegen ein Interesse an informellen Entscheidungsprozessen – vorausgesetzt, der eigene Einfluss auf diese Verfahren ist gewährleistet.
Wolfgang Merkel und andere haben völlig zurecht die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass Elemente des Informellen keine Besonderheit der Politikprozesse in Transformationsgesellschaften sind. Sie finden sich nicht nur in allen etablierten demokratischen Systemen, sie sind für diese auch essentiell:
„[F]ormale (politische) Institutionen [können sich] nur dann stabil reproduzieren, wenn sie auf komplementäre informelle Arrangements gestützt sind. Zentral für die Stabilität formaler Institutionen […] ist also die Frage, mit welchem Arrangement informeller Regeln das Gerüst formeller Regeln verwachsen ist und ob sich ein komplementäres institutionelles Gleichgewicht aus formalen und informalen Regeln herausbildet.“29
Merkel und seine Co-Autoren stützen sich hier auf einen neoinstitutionalistischen Institutionenbegriff in der Tradition von Douglass North und haben bei ihren Überlegungen vor allem die Frage der demokratischen (Nicht-)Konsolidierung von politischen Systemen in Transformationsländern bzw. ihre normativ grundierte Typologie „defekter Demokratien“ im Blick. Die konzeptionelle Frage nach dem Zusammenspiel oder dem Gegeneinander formaler politischer Institutionen und informeller Arrangements und Prozesse lässt sich jedoch auch losgelöst von diesem spezifischen normativen Erkenntniszusammenhang nutzen, indem man sie für die Zwecke der vorliegenden Arbeit reformuliert: Welche Faktoren sind daran beteiligt, dass sich ein Gegeneinander und kein Zusammenspiel formaler und informaler Regeln herausbildet, und welche Folgen hat es, wenn informelle Arrangements formale politische Verfahren und Entscheidungsprozesse überlagern?
Zahlreiche Arbeiten der vergleichenden Transformationsforschung der 1990er Jahre betonen die zentrale Bedeutung einer starken Exekutive für den Reformprozess. Sie sollte in möglichst hohem Maße vom Druck durch Parteien und Interessengruppen abgeschirmt sein, um ihr Reformprogramm umsetzen zu können.30 Daraus ergibt sich jedoch ein doppeltes Dilemma. Erstens sind Stärkung und Isolierung der Exekutive grundsätzlich nur um den Preis der Verringerung (demokratischer) Partizipations- und Kontrollmöglichkeiten zu haben. Und zweitens führt dies – im Vergleich mit Einflussnahme im parlamentarischen Raum – zu einer ungleich höheren Bedeutung informeller Verfahren und größerer Intransparenz bei abnehmenden Kontrollmöglichkeiten. Das bietet größere Chancen für rent seeker, weil diese vorzugsweise mit dem Teil der politischen und staatlichen Akteure interagieren, die über den größten Einfluss auf die Verteilung von Ressourcen verfügen: die Exekutive.31 Wenn Akteure starke Anreize haben, zur Interessendurchsetzung auf informelle Arrangements abseits formaler Verfahren zurückzugreifen, kann ein sich selbst verstärkender Prozess die Folge sein: Je zahlreicher, intensiver, weitgreifender und verfestigter informelle Verfahren dieser Art werden, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Überlagerung und Untergrabung formaler durch informale Institutionen kommt.
Die Folge einer derartigen, sich verstetigenden Konstellation kann zum einen sein, dass abseits der vorgesehenen formalen Institutionen „exklusive Verteilungskoalitionen zwischen einflussreichen gesellschaftlichen Akteuren und politischen Entscheidungsträgern einen Markt [bilden], in dem politische Unterstützung gegen wirtschaftliche Renten getauscht werden“32. Zum anderen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Machtposition der Exekutive im Institutionengefüge zunehmend stärker wird. Im Extremfall kann dies zu „Dekretismus als Imperialisierung der Legislative und Verfassungsbeugung“33 führen. In Bezug auf die Russländische Föderation ergibt sich aus diesen Überlegungen folgende Vermutung: Gerade in einem politischen System, in dem – wie noch zu zeigen sein wird – bereits das formale Institutionengefüge dem Staatspräsidenten eine herausgehobene Stellung mit eigenständigem Dekretrecht einräumt und in dem das Parteiensystem außerordentlich unterentwickelt ist, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass informelle Arrangements die formalen Institutionen unterlaufen und sich Transparenz und Kontrollmöglichkeiten politischer Entscheidungen verringern. Davon profitieren partikulare Interessen, deren rent seeking-Strategien Erfolg versprechen.
Akteure, die von einer gegebenen institutionellen Konfiguration profitieren, haben ein Interesse an der Aufrechterhaltung desStatus quo. Dies gilt zumindest so lange, wie sie damit rechnen, bei einer Veränderung Einbußen hinnehmen zu müssen. Staniszkis kann deshalb mit Recht davon ausgehen, dass diese Akteure im politischen Kapitalismus – bei allen individuellen Interessendivergenzen – zwei gemeinsame Interessen haben: Einerseits „a common interest in preserving the institutional and ownership formulae of ,political capitalismʻ“; andererseits „a common interest in the existence of a state strong enough to be able to defend the interests of domestic capital against pressure from outside players. And at the same time weak enough that it will be dependent on the maintenance of corporate bonds with the ,nomenklatura capitalistsʻ“.34
Zwei Elemente von Staniszkis’ Konzeption bedürfen an dieser Stelle der Präzisierung bzw. Verallgemeinerung. Zum einen ist das Interesse am Ausschluss ausländischer Konkurrenz zwar wichtig, muss jedoch um das Interesse am Schutz vor aufkommenden inländischen Akteuren ergänzt werden. Zum anderen ist der Begriff „nomenklatura capitalists“ zu eng bzw. irreführend. Dass Staniszkis ihn an dieser Stelle wählt, liegt an ihrem Schwerpunkt Polen und ihrer These der hohen Kontinuität ökonomischer Eliten bzw. dem häufigen Wechsel der ehemaligen politischen Elite in wirtschaftliche Spitzenpositionen.35 Der Kerngedanke ist jedoch unabhängig von der Frage der Elitenkontinuität: Im Rahmen ihres Bestrebens zur Bewahrung des Status quo haben die ökonomischen Akteure ein Interesse daran, dass die politischen und administrativen Akteure auf die Beziehung mit ihnen und die damit verbundenen informellen Prozesse angewiesen bleiben.
In einem politischen und wirtschaftlichen Transformationsprozess ergeben sich aus diesem Set an Interessen spezifische Konflikte und Dilemmata, die Joel Hellman in einem Modell zusammengefasst hat, das er „partial reform model“ nennt. Die lange Zeit vieldiskutierten Differenzen zwischen Befürwortern einer „Schocktherapie“ und Anhängern eines gradualistischen Vorgehens sowie die Diskussion um die Priorisierung politischer versus ökonomischer Reformen verdecken das grundsätzliche Faktum, dass grundstürzende Reformen notwendigerweise inkrementell sind. Das hat zur Folge, dass für eine gewisse Zeit des Übergangs alte und neue Regeln parallel existieren. Im ökonomischen Bereich resultieren daraus zahlreiche Marktverzerrungen (market distortions), die potentiell Grundlage für große Renteneinkommen sind.
Hellmans Konzeption geht davon aus, dass alle ökonomischen Reformprozesse – unabhängig von der Implementierungsgeschwindigkeit – notwendigerweise „produce winners in the short term, with gains partly or wholly determined by rents generated by the existence of distortions in the developing market economy. Moreover, these rents are highly concentrated, benefiting those in a position to arbitrage between the reformed and unreformed sectors of the economy“36. Mit fortschreitendem Reformprozess steht zu erwarten, dass mit abnehmenden Marktverzerrungen auch der Umfang potentieller Renteneinkommen sinkt und im Gegenzug die gesamtwirtschaftlichen Effizienzgewinne steigen.37
Vor dem Hintergrund dieser Erwartung haben die „earliest and biggest winners“38 Hellmans Modell zufolge ein Interesse daran, „to block further advances in reform that would correct the very distortions on which their initial gains were based. In effect, they seek to prolong the period of partial reforms to preserve their initial flow of rents, though at a considerable social cost“39. Dabei geht es ihnen, wohlgemerkt, gerade nicht darum, den gesamten Transformationsprozess anzuhalten oder gar umzukehren. Ziel ist vielmehr, diejenigen Reformvorhaben zu verhindern, deren Umsetzung den je eigenen Rentenzustrom zum Versiegen bringen würde.40
Die „Gewinner“ verfügen über zwei strategische Vorteile: Da die Renteneinkommen eine starke Konzentration aufweisen, ist die Gesamtzahl der profitierenden Akteure relativ klein und die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen sind vergleichsweise groß.41 Dies verbessert die Durchsetzungschancen ihrer Interessen erheblich.