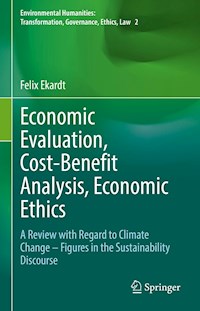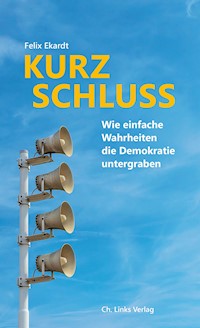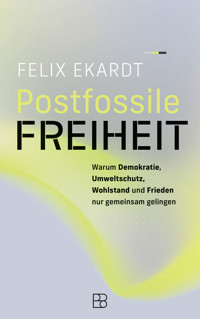
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonifatius Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratie, Klima und Frieden stehen unter Druck – und das nicht zufällig. Wir leben in einer Zeit multipler existenzieller Krisen, die tief miteinander verflochten sind. Die Abhängigkeit von fossilen Energien befeuert autoritäre Regime, untergräbt Demokratien und gefährdet den Frieden – in Europa wie global. Gleichzeitig scheitert die Menschheit am dringend nötigen ökologischen Wandel. Felix Ekardt – Jurist, Philosoph, Soziologe und Initiator der weltweit erfolgreichsten Verfassungsklage auf mehr Klimaschutz – analysiert, wie dieselben menschlichen Triebkräfte unsere Lebensgrundlagen bedrohen. Er zeigt, warum wir Freiheit und Demokratie neu denken müssen – und wie ein modernes, postfossiles Leben gelingen kann. Das Buch ist philosophische Tiefenanalyse, politischer Weckruf und konstruktiver Ausblick zugleich. Es stellt unbequeme Fragen und bietet konkrete Antworten: Gibt es objektiv gerechte Gesellschaftsordnungen? Was bedeutet Freiheit im 21. Jahrhundert? Und warum gibt es keine Alternative zu radikaler Nachhaltigkeit – wenn wir Demokratie und Frieden bewahren wollen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix Ekardt
Postfossile Freiheit
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden, denn es ist urheberrechtlich geschützt. Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Links im Buch zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat der Verlag keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich der Verlag hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden, und übernimmt für diese keine Haftung. Alle Internetlinks zuletzt abgerufen am 24.4.2025.
Klimaneutrale Produktion.
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier.
1. Auflage 2025
Copyright © 2025Bonifatius GmbH Druck | Buch | Verlag Karl-Schurz-Str. 26 | 33100 Paderborn | Tel. 05251 153-171 | [email protected]
Umschlaggestaltung: spoon design, www.spoondesign.de, Langgöns
Satz: Bonifatius GmbH, Paderborn
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
eISBN: 978-3-98790-954-2
www.bonifatius-verlag.de
Inhalt
Kerngedanken und Vorwort des Buches
I. Demokratie, Frieden, Umwelt, Wohlstand: nur gemeinsam zu retten – radikalere Postfossilität ist nötig und nicht „grün“
1. Wie wir den multiplen Weltuntergang verpennen
2. Jetzt bin ich mal dran: Wie Individuen, soziale Milieus und Staaten die Kompromissfähigkeit verlieren
3. Weltweiter Trend zur autoritären statt offenen Gesellschaft – nicht allein erklärbar durch Globalisierung, Digitalisierung, Pluralisierung, Pandemie
4. Fossile Brennstoffe: Umwelt-, Demokratie-, Friedenskiller – warum die Grünen zu wenig radikal sind
5. Postfossilität beschleunigen statt bremsen: Chance, nicht Risiko für den Wohlstand
6. Wie postfossile Demokratie, Frieden, Umweltschutz mit KI und Digitalisierung verknüpft sind
II. Wie Wandel gelingt oder scheitert: Der Mensch als Herausforderung für Demokratie, Frieden, Umwelt
7. Demokratie, Umwelt, Frieden: abhängig vom Wechselspiel sehr vieler Akteure
8. Verhaltensantriebe: mehr als Befragungen oder Laborexperimente erzählt das reale Verhalten
9. Hängt unser Verhalten primär von Faktenwissen und Werten, also Bewusstsein, ab?
10. Eigennutzen: Scheitern Demokratie, Frieden, Umwelt nur an Profit- und Machtstreben?
11. Evolution, Hirnforschung, Kindheit: wichtig, aber überschätzt
12. Normalitätsvorstellungen: anfällig für Autoritarismus, Krieg und Klimazerstörung
13. Gefühle gegen Demokratie, Frieden, Klimaschutz: von Gewohnheit, Verdrängung, Sündenbockdenken, Unterkomplexität, Ausreden – und unserer Sterblichkeit
14. Pfadabhängigkeiten und Kollektivgutprobleme: wie wir feststecken
15. Natur und Kultur in allen Motiven: interdependente Entstehung von Kapitalismus, Demokratie, Umweltzerstörung – und von autoritärer Herrschaft als Regelfall
16. Wie kooperativ sind wir – und heißt das: altruistisch? Warum Kapitalismuskritik Demokratie, Umwelt und Frieden nicht rettet
III. Demokratie und Freiheit – universal richtig, aber radikal postfossil neu interpretiert
17. Hyperindividualistische Freiheit versus illiberale Pseudo-Demokratie als drohende Alternative
18. Ist Wahrheit nur subjektiv – und erledigt das den Kampf um Demokratie, Frieden und Klima?
19. Können Autokratie und liberale Demokratie richtig oder falsch sein – sogar universal?
20. Freiheit oder Demokratie? Ein neues postfossiles Freiheitsverständnis – und warum bei Umwelt wenig und bei Migration viel demokratischer Spielraum besteht
21. Liberale Demokraten als „Volksfeinde“? Illiberale Demokratie, Autokratie und russisch-chinesische Anleihen beim Nazi-Cheftheoretiker
IV. Schritte und Mehrheiten zur Rettung von Demokratie, Umwelt, Frieden, Wohlstand
22. Wie Wandel nur im Wechselspiel von Politik, Unternehmen und Bürgern gelingt
23. Gegen die falsche Alternative „Konsum- oder Politikwandel“: Wie viel Einhegung Kapitalismus und Konzerne brauchen
24. Jenseits der falschen Alternative „Schulden oder Marktradikalität“: Postfossile Politik für Demokratie, Frieden, Umwelt, Wohlstand
25. Demokratie weiterentwickeln, transnationalisieren – und so wachsende Ungleichheit bremsen
26. Verbleibende Umwelt-Demokratie-Konflikte versöhnen – soziale Postfossilität ohne „sozial-ökologische Transformation“ und Identitätspolitik
27. Können postfossile Demokratie, Umwelt, Frieden, Wohlstand von der EU aus global werden? Warum Renationalisierung und Autarkie schädlich sind
28. Warum liberale Demokratien Atomwaffen brauchen, aber Atomenergie oder Geoengineering keine postfossile Hilfe sind
29. Grenzen des Wachstums und der Digitalisierung – und nötige komplexe Antworten darauf
30. Glückliches Leben in Zeiten des Weltuntergangs
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Register
Über den Autor
Kerngedanken und Vorwort des Buches
Hauskatzen sind kuschelig, ein bisschen majestätisch und extrem beliebt. Viele Menschen finden: Es gibt kaum etwas Süßeres. Zugleich sind Katzen mit die größten Feinde der Artenvielfalt in Städten, wenn sie Freigänger sind. Fängt man an, über solche Dinge nachzudenken, kann einem das moderne Leben schon mal erschlagend komplex vorkommen. Ja, der Tag ist voll, und es kann einem mitunter alles zu viel werden. Es ist Krieg in Europa, Putin könnte ihn bald ausweiten, die Energiepreise steigen, das Rad der Veränderung dreht sich gefühlt schneller und schneller. Autoritäre Mächte wie China, Russland und zunehmend nun auch die USA drohen die Welt unter sich aufzuteilen, während wir Europäer uns weiter eine Normalität vorgaukeln, die es zunehmend nicht mehr gibt. Ich hätte vielleicht gern einfach mal meine Ruhe vor all diesen Problemen, doch stattdessen kommt es irgendwie immer dicker. Da kann man sich schon mal spontan angesprochen fühlen, wenn manche Stimmen in der Politik vermeintliche Rezepte präsentieren für ein Zurück in eine gefühlt stressfreiere Vergangenheit. Wenn Wutbürger oder protestierende Bauern weniger Umweltschutz oder einen Frieden mit Putin um jeden Preis einfordern, klingt das denn auch für viele erstmal naheliegend. Weg mit jeder zusätzlichen Bedrohung unseres Wohlstands! Und wenn sich schon die Weltlage so dramatisch entwickelt, kann ich dann nicht wenigstens gemütlich weiter meinen Benziner nutzen und meine zwei, drei, vier Flüge im Jahr genießen – und wie früher schön billig mit russischem Gas heizen? Und ruiniert nicht gerade die Umweltpolitik am Ende die Demokratie, weil sie die allgemeine Wut aufstachelt?
Man kann das alles sehr gut verstehen. Nur werden in solchen sehr menschlichen Reflexen einige Probleme dramatisch unterschätzt, und es werden riesige Chancen unterschätzt, wenn man die Probleme zusammen betrachtet und gemeinsame Lösungspfade sucht. Die Zukunft von Demokratie und freiheitlicher Gesellschaft steht auf des Messers Schneide. Ebenso bedroht ist der Frieden in Europa, der eng mit offenen Gesellschaften verknüpft ist – die ihrerseits zunehmend mit der chinesischen Alternative „Frieden und Wohlstand statt Freiheit“ konfrontiert werden. Besonders dann, wenn die neuerliche Präsidentschaft Donald Trumps die US-Demokratie kollabieren lässt, Marine Le Pen die nächsten französischen Wahlen gewinnt, die EU all das nicht überlebt – und die Demokratie in Kernländern einem autoritären Populismus zu weichen droht. Spätestens wenn Trump wie angekündigt Europa den militärischen Beistand aufkündigt und offen ins autoritär-imperialistische Lager wechselt, öffnet sich das Tor weit für Wladimir Putins ebenso offenkundige wie fatal ignorierte Vision einer autoritären russischen Oberherrschaft über Europa.
Gegenwärtig finanzieren wir Europäer den russische Expansionismus gar noch aktiv, indem wir insbesondere fossile Brennstoffe weiter fleißig verbrauchen, teilweise weiterhin direkt aus Russland und teilweise auf Umwegen. Und selbst mit fossilen Verbräuchen aus anderen Herkunftsländern halten wir die Weltmarktpreise hoch und nützen damit Putin. Werden wir nicht viel schneller postfossil, als es selbst die meisten Ökos in Parteien, Verbänden und Wissenschaft wollen, droht Putin bald der Oberherr über Europa zu sein. Allein die (bitter nötige) Aufrüstungsdiskussion dieser Tage wird ihn nicht stoppen können. Dazu ist der Weg zu verteidigungstüchtigen Armeen zu weit. Deshalb ist es maximal fatal, dass die Postfossilität in diesen Tagen vollständig aus dem Blick zu geraten droht, zumal auch Donald Trump mit Vollgas zurück ins fossile Zeitalter steuert. Drill, baby, drill.
All das rollt existenziell auf uns zu, und doch reagieren wir allenfalls träge. Noch die greifbarste Reaktion auf die Herausforderungen für Frieden und Demokratie ist es, dass wir trotz aller Bekundungen und Maßnahmen sehr langsam agieren bei den anderen existenziellen Herausforderungen in der Hoffnung, die populistischen Ränder nicht noch mehr zu stärken: beim Umweltschutz und speziell bei der Energie- und Klimawende. Und übrigens auch bei den Herausforderungen der digitalen Transformation, die wie die Energie- und Klimawende riesige Chancen, aber auch Abgründe aufgehen lässt, wenn man nicht entschlossen handelt. Genau dort setzen zwei Kernthesen an, die seit langem meine Arbeit und mein öffentliches Wirken als Nachhaltigkeitsforscher bestimmen:
Demokratie, Frieden, Umweltschutz und Wohlstand gelingen nur gemeinsam. Und sie gelingen nur, wenn unser Leben und Wirtschaften rasch und radikal postfossil wird. Postfossilität ist also nicht öko. Sie ist erst recht nicht „nur Klima“. Denn es gibt größere Umweltprobleme als den Klimawandel.
Die liberale Demokratie droht eine historische Ausnahme zu bleiben, letztlich nicht primär wegen aktueller Entwicklungen, sondern aufgrund bestimmter menschlicher Grundeigenschaften. Nämlich den gleichen, die auch Frieden und Umweltschutz oft im Weg stehen. Soll Demokratie von Dauer sein, erfordert dies nicht nur, dass Deutschland und die EU sich trauen, die Rolle der zunehmend autokratischen USA als globaler Leitstern der liberalen Demokratie zu übernehmen. Es erfordert auch Postfossilität. Und es erfordert menschliche Lernprozesse, ein ganz neues Freiheitsverständnis – und neue, nicht zuletzt stärker transnationale Wege zur Demokratie und zur Globalisierung der Postfossilität. Als deutscher Sonderweg würde sie dagegen wenig erreichen.
Dieses Buch ist mein Manifest gegen das, was sich zusammenbraut. Und für das, was mit einem postfossilen Leben und Wirtschaften möglich wäre. Postfossilität ist der Schlüssel zur Lösung aller Umweltprobleme, nicht nur des Klimathemas. Und sie ist eine – natürlich nicht die einzige – Grundbedingung für Demokratie, Frieden und Wohlstand. Entgegen landläufigen politischen Frontlinien – etwa beim Bruch der deutschen Ampel-Regierungskoalition – geht es mit radikaler Postfossilität nicht um die falsche Alternative, ob man riesige Schuldenberge für eine inhaltlich diffuse sozial-ökologische Transformation anhäufen muss oder ob man alles „allein dem Markt überlassen kann“. Es geht vielmehr um neue Wege zur Postfossilität. Und es geht um neue Mehrheiten jenseits eines Lagerdenkens.
Die EU und die Zivilgesellschaft werden den eingefahrenen politischen Klassen und Gesellschaften der Nationalstaaten dabei Beine machen müssen. Und wenn es um ein neues Freiheitsverständnis und damit um eine neue Menschenrechtsinterpretation geht, kommen auch Klagen vor Verfassungsgerichten ins Spiel, um den demokratie- und lebensgrundlagengefährdend agierenden politischen Mehrheiten Grenzen zu setzen. Letzteres kulminierte beispielsweise in unserer langjährig vorbereiteten, weltweit fortwirkenden Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht und jetzt weiteren Klagen und Urteilen, auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der eine Art Oberverfassungsgericht für das gesamte geographische Europa ist. 2024 haben wir Bundestag und Bundesregierung erneut zum Klima und nunmehr auch zum mangelnden Naturschutz verklagt. Beim Naturschutz ist das eine Weltpremiere. Alle drei Klagen zielen auf radikale Postfossilität. Und auf neue Wege zu ihr.
Dieses Buch ist eine Einladung, die Welt und unser aller Situation genauer anzuschauen und neu zu entdecken, was möglich ist. Es stellt diese Herausforderungen in einen umfassenden Zusammenhang und weist über tagespolitische Diskussionen zu Aufrüstung und fossilem Rollback hinaus. Es analysiert, wie ähnliche menschliche Triebkräfte Demokratie, Klima und Frieden gleichermaßen bedrohen. Es formuliert ein neues normatives Konzept postfossiler Demokratie und Freiheit. Und es zeigt die konkret nötigen Schritte auf, um Demokratie und Lebensgrundlagen zu bewahren, und zwar in Verbindung mit Wohlstand und Frieden – mitunter auch aus meiner autobiographischen Perspektive. Wir wollen also verstehen, warum sowohl der ökologische Wandel als auch dauerhafte Demokratie und Frieden uns Menschen so schwer fallen. Wir müssen die normativen Argumente verstehen, warum es keine gute Alternative zur offenen Gesellschaft – und zu radikaler Nachhaltigkeit – gibt. Und wir müssen konkrete Wege raus aus den Bedrohungslagen und weg von den fossilen Brennstoffen entwerfen.
Bei alledem kann man einigen Grundfragen nicht ausweichen, die fundamentaler kaum sein könnten. Wollen und können wir uns wirklich kurzfristig von den fossilen Brennstoffen, der jahrhundertelangen Quelle unseres Wohlstandes, verabschieden? Und, wenn man die existenzielle Herausforderung für Demokratie, Umwelt und Frieden begreifen will: Was treibt uns Menschen grundlegend an? Gibt es objektiv gerechte und objektiv ungerechte Gesellschaftsordnungen im pluralistischen 21. Jahrhundert? Was ist überhaupt Demokratie – und wie könnte ein neues, postfossiles Freiheitsverständnis aussehen? Wie kann das überhaupt gehen: modernes postfossiles Leben? Und wie kann all dies zu einer neuen, weder naiven noch modernitätsfeindlichen Fortschrittserzählung zusammenfließen in einer Zeit, in der schon umstritten ist, ob es überhaupt noch so etwas wie Fakten gibt?
Dieses Buch ist die Summe meiner Arbeit in der Leipziger Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik und an den Universitäten Bremen, Rostock, Halle und Erfurt. Ich verbinde seit 30 Jahren das Nachdenken über Nachhaltigkeit, also zum Ideal dauerhaft und global durchhaltbarer Lebens- und Wirtschaftsweisen, mit Analysen zur normativen Grundordnung der Gesellschaftsform, die wir als liberale Demokratie kennen. Das hat mich zu einer übergreifenden Theorie sozialen Wandels, zu einer normativen – ethischen und rechtlichen – Theorie und Neuinterpretation der liberalen Demokratie und zu einem Konzept wirksamer Nachhaltigkeits-Politikinstrumente geführt. Meinen Instituts-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bin ich herzlich dankbar, dass sie insbesondere zu den vielen Details wirksamer Politikinstrumente den langen Weg mit mir gegangen sind, ursprünglich oft in vielen internationalen Fachartikeln. Vorliegend wende ich mich mit alledem an eine breite Öffentlichkeit in Vertiefung und Verbreiterung einiger meiner früheren Sachbücher. In aller wissenschaftlichen Exaktheit und mit breiten Referenzen ist es in der neuesten Auflage meiner Habilschrift nachlesbar (4. Auflage 2021 auf Deutsch bei Nomos, gekürzt und deutlich stärker aktualisiert in der 2. Auflage 2024 auf Englisch bei Springer Nature). Hier wie dort sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn ich zugunsten einer leichteren Lesbarkeit teilweise das generische Maskulinum verwende.
Mein Vater ist 1960, kurz vor dem Mauerbau, aus der DDR geflüchtet, weil er als Pastorinnen-Sohn nicht studieren durfte. Mein Onkel hat das gleiche zwei Jahre vorher getan. Beide waren Wissenschaftler wie ich. Mein Opa, 1944 im Zweiten Weltkrieg geblieben, war umgekehrt selbst glühender Anhänger eines noch schlimmeren totalitären Regimes: Er war schon 1923 beim Hitler-Putsch in München dabei, als Nazi der ersten Stunde. Ich persönlich verspüre keinerlei Lust auf weitere autoritäre Regierungen. Ich will frei reden können, was und mit wem ich möchte, und meine Kinder sollen ohne Rücksicht auf einen Oberherrn etwa in Moskau ihr Leben autonom so planen können, wie es sie glücklich macht. In den Grenzen der Autonomie aller anderen.
Ich suche mit diesem Buch Wege zur Transformation, die den meisten Menschen mehr Vorteile als Nachteile bringen. Dennoch mag es sein, dass ich mich mit diesem Buch bei einigen unbeliebt mache – bei Freunden und Feinden der Demokratie wie auch der Nachhaltigkeit gleichermaßen. Man könnte auch sagen: Ich lege mich mit einigen unserer menschlichen Grundtendenzen an. Etwa denen zur Bequemlichkeit, Gewohnheit, Verdrängung, zu Ausreden und zu Gruppengefühlen und eher kurzfristigen, (allzu) handfesten Blickwinkeln auf die Dinge. Eindimensionale Analysen und vorschnelle Lösungen werde ich nicht versprechen – ich werde mich nicht einreihen in die vielen Transformations- und Demokratie-Bücher, die allzu leichtgängig daherkommen mit Ansagen wie der, alle Menschen wollten doch das Gute, oder bequeme Sündenböcke präsentieren: die Politiker, die Kapitalisten, die Konsumentinnen. Ich meine demgegenüber: Wir sind alle Teil des Problems, aber auch der möglichen Lösung. Es droht das letzte Gefecht zwischen historisch-biologischen Normalitäten und der menschlichen Lernfähigkeit, wenn wir nicht radikal umdenken. Solange wir noch frei reden können – historisch eher die Ausnahme –, sollten wir es tun.
Felix Ekardt
Leipzig, im Frühjahr 2025
I. Demokratie, Frieden, Umwelt, Wohlstand: nur gemeinsam zu retten – radikalere Postfossilität ist nötig und nicht „grün“
1. Wie wir den multiplen Weltuntergang verpennen
Mit Frieden in Europa, billigem russischem Gas und einer sich mehr oder minder einfach und klar anfühlenden Welt war das Leben irgendwie entspannter. So oder so ähnlich fühlt es sich für viele von uns an, wenn wir heute immer mehr Komplexität, immer größere Herausforderungen und schlimmstenfalls den buchstäblichen Weltuntergang vor unseren Augen aufziehen sehen. Wir haben uns angenehm eingerichtet in einer Welt mit jährlich mehreren Flugreisen in den Urlaub, täglichen Autofahrten zur Arbeit, immer größeren Wohnungen, immer größerem und von weiter her importiertem Lebensmittelangebot. Und häufig auch in einer immer unpolitischeren Grundhaltung – wer ist schon noch in Parteien oder Verbänden, wer will sich schon mehr antun, als dem politischen Geschehen mäßig interessiert und leicht arrogant aus sicherer Distanz zu folgen. Wir waren noch nie so reich und frei wie heute. Jedenfalls in westlichen Ländern und speziell Europa. Zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg schien der Wohlstand unendlich zu wachsen. Die Demokratie schien sich mit dem Ende des Kalten Krieges und dem vermeintlichen Ende der Geschichte weltweit durchzusetzen. Und damit auch der Frieden: Offene Gesellschaften führen nicht gegeneinander Krieg. Das Paradies auf Erden – allerdings vor allem im Hier und Heute. Auch im Globalen Süden nimmt der Wohlstand seit Jahrzehnten zu, aber langsamer als im Okzident und nicht durchgängig.
Seien wir ehrlich: Geht es uns gut, wünschen wir uns im Leben manchmal, dass alles einfach immer so weiter geht. Oder dass wir uns zumindest nicht ständig neu orientieren müssen – oder existenzielle Bedrohungen fürchten müssen. Gerade in westlichen Ländern haben höhere Energiepreise, eine zeitweise steigende Inflation und erst recht der nach Europa zurückgekehrte Krieg die Menschen in Angst versetzt. Bauernproteste oder Gelbwesten-Bewegungen sind dabei nur die symbolische Spitze eines weit verbreiteten Unbehagens. Sie richten sich gegen die um sich greifende Unsicherheit und suchen oft recht einfache Lösungen, zurück zu einer liebgewonnenen früheren Normalität. Und sie richten sich oft massiv gegen die, die noch mehr Veränderung verlangen. Diejenigen etwa, die mehr Klimaschutz fordern.
Verständlich ist das alles. Nur: Manchmal muss man im Leben wesentliche Dinge ändern, um einige wichtige Dinge zu bewahren – und nicht alles zu verlieren. Und man muss manchmal auch massiv umdenken. Tief im Westen, in Europa und Nordamerika, ist der Untergang der Demokratie ein überaus reales Szenario geworden. Autokratien sind auf dem Vormarsch. Frieden, Demokratie und natürliche Lebensgrundlagen sind existenziell bedroht. In einer immer wohlhabenderen Welt dachte man nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1990, der Autoritarismus sei am Ende. Doch die liberale Demokratie, ohnehin eine Ausnahme in historischer und globaler Perspektive, steht immer mehr auf des Messers Schneide. Ebenso bedroht ist der Frieden in Europa, der eng mit offenen Gesellschaften verknüpft ist. Demokratie und Frieden geraten in diesen Tagen gar aus dem Mutterland der modernen liberalen Demokratie unter Beschuss: aus den USA unter Donald Trump.
Noch die greifbarste Reaktion darauf ist, dass wir uns relative Untätigkeit bei der anderen existenziellen Herausforderung auferlegen in der Hoffnung, die populistischen Ränder nicht noch mehr zu stärken: bei der Energie- und Klimawende mit ihrem sukzessiven Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Postfossilität, das heißt für die meisten einfach: Klimaschutz. Und es heißt, dass alles irgendwie noch teurer wird und wir als Gesellschaften und Individuen alles noch komplizierter machen, obwohl sich die Welt nicht so anfühlt, als bestünde da dringender Handlungsdruck. Es gefährdet doch unseren Wohlstand, so hört man von den allerorten wachsenden und in die Regierung drängenden Links- und Rechtspopulisten, wenn man nicht weiter billiges Gas aus Russland bezieht und damit ein vorgeblich abstraktes Problem wie den Klimawandel angeht. Donald Trumps fossiler Rollback verleiht alledem gerade paradigmatisch Ausdruck. Doch könnte es sein, dass daran fast alles falsch ist – außer dass die fossilen Brennstoffe natürlich wirklich den Klimawandel zentral vorantreiben? Ist die Vorstellung, Postfossilität sei einfach nur öko und überdies parteipolitisch grün, die von allen Seiten in westlichen Ländern fast für selbstverständlich gehalten wird, womöglich fatal falsch – weil die Fossilen auch Frieden und Demokratie untergraben; und weil nur Postfossilität und nicht etwa das weitere Setzen auf Öl, Gas und Kohle unseren Wohlstand einigermaßen sichern kann?
Gleichzeitig könnte in der Tat auch ökologisch der Handlungsbedarf deutlich größer sein, als wir uns aktuell eingestehen. Wir haben zwar viele Schadstoffprobleme, die Böden, Luft und Gewässer verseuchen, mehr und mehr in den Griff bekommen. An ihre Stelle sind jedoch mittel- und langfristige Menschheits-Herausforderungen getreten. Schon das Problem Klimawandel, also die globale Erwärmung, verursacht durch menschliche Treibhausgasemissionen vor allem aus den fossilen Brennstoffen und der Nutztierhaltung, könnte sich als größer erweisen als meist gesehen. Noch dramatischer könnte die Situation beim Biodiversitätsverlust sein, wobei das eine wie das andere Problem in den Auswirkungen existenziell bedrohlich für uns alle ist.
Ich möchte in diesem Buch die Lage beschreiben, die viel herausfordernder ist, als sie meist gesehen wird – und Zusammenhänge von Problemen aufzeigen, die meist nicht im Zusammenhang gesehen werden. Dabei allein soll es indes nicht bleiben. Ich möchte grundlegend verstehen helfen, was Menschen und Gesellschaften und ihren Wandel antreibt und Umwelt, Demokratie und Frieden gefährdet. Ich möchte ferner klären, was denn die guten Gründe dafür sind, Demokratie und Lebensgrundlagen zu schützen und gegen einen aggressiven Autoritarismus sowie ein zukunftsvergessenes Freiheitsverständnis zu verteidigen. Es geht also darum, was die normativen Maßstäbe sind, was das richtige Freiheitsverständnis ist, an denen wir uns im 21. Jahrhundert noch orientieren können, und welche konkreten Schritte wir in eine bessere Zukunft gehen könnten. Woran liegt es, dass die offene Gesellschaft eine historische Ausnahme zu bleiben droht, von welchen höchst unterschiedlichen Seiten her wird sie gefährdet, und was kann getan werden, um Freiheit und Demokratie zu verteidigen und schrittweise weltweit wachsen zu lassen? Müssen wir vielleicht aus diversen und gerade nicht nur (aber auch) ökologischen Gründen nicht vorsichtiger, sondern radikaler und schneller postfossil werden? Und wie könnten, statt dass wir immer auf die nationalstaatlichen Regierungen schauen, andere Akteure wie die EU, die Zivilgesellschaft oder Verfassungsgerichte den eingefahrenen politischen Lagern und Gesellschaften der Nationalstaaten Beine machen?
Teil I dieses Buches schildert, wie gefährdet Demokratie, Lebensgrundlagen und Frieden sind, wie dies untereinander und mit unserem Wohlstand, aber auch mit der fortlaufenden Digitalisierung zusammenhängt, warum der Klimawandel existenziell und doch nicht das größte Umweltproblem ist, inwiefern Demokratie eine historische Ausnahme ist – und warum die fossilen Brennstoffe bei alledem eine zentrale Rolle spielen.
Teil II fragt nach Ursachen dafür, warum Umweltschutz, Frieden und Demokratie, von denen man vordergründig meinen könnte, dass sie fast jeder Mensch will, es so schwer haben.
Teil III fragt, ob es ethisch und rechtlich überhaupt geboten ist, offene Gesellschaft und Umwelt zu schützen – und was postfossile Demokratie und Freiheit als Leitstern künftigen Lebens und Wirtschaftens heißen könnte.
Teil IV entwickelt konkrete Schritte, wie wir Demokratie, Lebensgrundlagen, Wohlstand und Frieden bewahren können – insbesondere dazu, wie radikale Postfossilität gelingen kann.
2. Jetzt bin ich mal dran: Wie Individuen, soziale Milieus und Staaten die Kompromissfähigkeit verlieren
Was im Alltag von den Megakrisen häufig am unmittelbarsten sichtbar ist für Menschen in einem mitteleuropäischen, (noch) friedlichen Landes, ist seit einigen Jahren: Der Ton ist rauer geworden. 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs scheint innergesellschaftlich und zwischenstaatlich die Kompromissfähigkeit zu schwinden. Ein Gefühl von „Jetzt bin ich mal dran“ scheint mehr und mehr Menschen, politische Strömungen und auch Regierungen zu erfassen, ob es um die Bereitschaft zu radikalem Klimaschutz geht, um den Zusammenhalt in demokratischen Gesellschaften oder um friedenswahrende Kompromisse zwischen Staaten. Autokraten und Halbdemokraten, aber auch Bevölkerungen in Russland, China, Indien, Lateinamerika oder Afrika haben genug von westlicher Dominanz, sei sie real oder nur noch vermeintlich.
Westliche zivilgesellschaftliche Aktive wiederum haben genug von „alten weißen Männern“, die immer noch nicht gendern und einen umweltzerstörerischen Lebensstil pflegen. Von genau diesen Aktivisten haben wiederum viele Bauern in westlichen Ländern genug. Proteste gegen die postfossile Transformation, die bisher meist als bloße Umweltmaßnahme gelesen wird, sind im Prinzip nicht überraschend. Neu ist indes die Kompromisslosigkeit, mit der hier und auch sonst immer öfter gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Auch die Pandemie hat dafür viel Anschauungsmaterial geboten, nicht nur von populistischer Seite. Auf allen Seiten sind „Unteilbarkeit“ oder auch „Unverhandelbarkeit“ das Konzept der Stunde. Die in den USA sprichwörtlichen „zwei Amerikas“ gibt es zunehmend auch in anderen Ländern wie Deutschland und auch zwischen den Ländern – Teile von Gesellschaften, die mehr und mehr auseinanderdriften und kaum noch Interesse haben an gemeinsamen, kompromisshaft und im Wege des gegenseitigen Zuhörens und Lernens errungenen Wegen.
Wettbewerb und konkurrierende Angebote sind prinzipiell zwar in Politik und Wirtschaft Mechanismen, die Kreativität hervorbringen können. Das Ganze funktioniert jedoch nur, wenn ein gemeinsamer Rahmen wie die Spielregeln der repräsentativgewaltenteiligen Demokratie und ihrer Mehrheitsentscheidungen akzeptiert werden. Dagegen gefährdet es Frieden, Wohlstand und Demokratie, wenn politische Meinungsverschiedenheiten zunehmend nicht mehr durch Diskussionen, Kompromisse und Mehrheitsentscheidungen befriedet werden können, sondern in Kulturkämpfe oder gar in offene Gewalt übergehen – innerstaatlich oder zwischen den Staaten.
Die aktuelle innerstaatliche und transnationale Lage trägt mitunter Züge von jeder gegen jeden. Trotz dieser hochkontroversen Situation kann man, etwas überzeichnet, auch so etwas wie Lager erkennen, wenn auch in sich heterogene. Plastisch werden die Lager besonders dann, wenn man auf das schaut, was die Beteiligten, mitunter auch stereotyp und überspitzt, wechselseitig aneinander kritisieren. Soziologisch könnte man sie leicht überspitzt als hyperindividualistisch einerseits und als kulturessenzialistisch andererseits bezeichnen1(was uns in diesem Buch noch intensiv beschäftigen wird). Andere reden noch etwas zugespitzter über Freunde versus Feinde der offenen Gesellschaft, wobei wir noch sehen werden, dass die Gruppierungen weniger eindeutig und auch in sich heterogen sind und speziell die Demokratie-Gefährdung durchaus als wechselseitiger Vorwurf im Raum steht. Was heißt das?
Mit Hyperindividualismus ist hier – stilisiert – vorerst die Fortschreibung klassisch-liberaler Vergesellschaftung und Staatlichkeit beschrieben. Also das fortgesetzte westliche Modell des klassischen Liberalismus mit seiner Fortschrittserzählung in einer immer stärker aufs Persönlich-Subjektive und Konsumaffine gewendeten, sich weltoffen und globalisierungsaffin gebenden Spielart, verbunden teilweise mit Öko-Rhetorik, real aber oft verknüpft mit einer ressourcenintensiven Lebens- und Wirtschaftsweise. Dabei gibt es mehr wirtschafts- oder neoliberale und mehr postmoderne Ausprägungen. Häufig verbindet sich damit auch Offenheit für Migration und für den Antidiskriminierungsdiskurs. Schien diese politische Linie im Westen und global Ende des 20. Jahrhunderts immer stärker hegemonial zu sein, zeigt sich zunehmend, dass dieser Geist nur noch von einem Teil der Bewohner der westlichen Welt – und jenseits dessen von nur wenigen – geteilt wird: und zwar von einem häufig relativ städtischen, vergleichsweise gebildeten Bevölkerungsteil.
Mit einem Kulturessenzialismus verbindet sich oft eine fortschrittskritische Vorstellungswelt, nach der sich die Gesellschaft bis hin zur Weltgesellschaft angeblich in homogene, letztlich gegnerische Gruppen aufteilt, etwa verschiedene Völker; oder Gruppen; oder das „authentische Volk“ und „die korrupte Elite“. Das kann dann eine stark nationalstaatszentrierte Alternative innerhalb demokratischer Staaten meinen im Sinne einer illiberalen Demokratie des wahren Volkswillens, es kann jenseits eines solchen Rechts- oder Linkspopulismus aber auch offenen Autoritarismus meinen. Häufig wird in diesem Rahmen für stärker traditionelle Bilder von Leben, Ehe und Familie plädiert und kulturkritisch deren Untergrabung und Verlust moniert. Ein Spektrum von Donald Trump über Wladimir Putin, Viktor Orbán, Marine Le Pen oder auch Sahra Wagenknecht und Björn Höcke prangert eine angenommene „linksgrüne“ oder „linksliberale“ Politik an, die sich demokratisch gebe, in Wirklichkeit aber den mehrheitlichen Volkswillen und die Demokratie untergrabe, sei es durch autoritäre Corona-Maßnahmen oder eine Art von Sprachpolizei in der Antidiskriminierungspolitik, sei es durch vermeintliche Umweltpolitik, die eigentlich nur der immer stärkeren Reglementierung des Alltagslebens diene. Und „der Westen“ als Ganzes privilegiere das Individuum auf Kosten von Familie und Gemeinschaft, predige eine schrankenlose, ökonomistische, oberflächliche Freiheit und bevormunde den Rest der Welt – vermeintlich wohlmeinend, in Wirklichkeit aber neo-totalitär. Teilweise werden Kulturessenzialisten allerdings auch selbst wirtschaftsliberal. Donald Trump und Elon Musk sind aktuell das wichtigste Beispiel.
Nimmt man die Gefährdungen für Demokratie, Frieden, Umwelt und Wohlstand zusammen mit dieser hier zunächst nur grob umrissenen Frontstellung, stellen sich mehrere fundamentale Fragen. Wie steht es nun um die einzelnen Gefährdungslagen, und wie hängen sie zusammen? Ist die Demokratie nun gefährdet, und durch wen? Dem wollen wir im Folgenden nachgehen – bevor wir in Teil II dann grundlegende Ursachen betrachten und in Teil III der Rechtfertigung und dem richtigen Verständnis von Freiheit und Demokratie nachgehen.
3. Weltweiter Trend zur autoritären statt offenen Gesellschaft – nicht allein erklärbar durch Globalisierung, Digitalisierung, Pluralisierung, Pandemie
Wenn wir nun in den Blick nehmen wollen, wie gefährdet Demokratie, Umwelt und Frieden sind, wie dies untereinander, mit dem Wohlstand und mit aktuellen Entwicklungen zusammenhängt und warum die fossilen Brennstoffe bei alledem eine zentrale Rolle spielen, fällt der Blick zunächst auf die Gefährdung der Demokratie. Wie groß und wie real ist sie, und von wem geht sie aus?
Demokratie: aktuell und historisch die Ausnahme
Zunächst kommt man kaum umhin zu konstatieren, dass demokratisches Regieren seit einigen Jahren global in die Defensive zu geraten scheint, und zwar bereits ohne die Verschärfungen im Kontext der fossilen Brennstoffe, die vorliegend besonders in den Blick kommen. Und dass sich Diskurshegemonien verschieben, in einer Weise, die viele an die frühen 1930er Jahre erinnert. Versteht man – hier noch ohne großes theoretisches Konzept (dazu Teil III) – Demokratie als ein System der individuellen und kollektiven Autonomie der Menschen mit Wahlen, Mehrheitsentscheidungen, grundrechtlichen Freiheiten als deren Rahmen, Pluralismus, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und freien Medien, so stellt man fest, dass nur rund ein Sechstel der Staaten weltweit dies in einem substanziellen Sinne erfüllen. Dies zeigen etwa der stetig aktualisierte Demokratie-Index und die Demokratie-Matrix auf.2
In allen anderen Staaten finden gar keine Wahlen statt oder sind etwa Polizeiwillkür, Einschüchterung, Inhaftierung oder gar Ermordung von Oppositionellen, korrupte Gerichte und missbräuchlich agierende Regierungen oder in unterschiedlichen Graden unfreie Wahlen an der Tagesordnung.3Entwicklungen etwa in Russland, Venezuela, Iran oder Georgien, aber auch Ungarn haben vormals zumindest vorhandene Demokratie-Ansätze zunehmend im autokratischen Sinne überformt, teils durch explizite Verfassungsänderungen, teils durch eine neue Verfassungspraxis. Darüber kann auch der Umstand nicht hinwegtäuschen, dass anders als in früheren Jahrhunderten Autokraten heutzutage sich mitunter verbal als Demokraten geben und Unterdrückungsmechanismen subtiler geworden sind. Hätte Mao Zedong Wahlen noch als westlich-bürgerliche Verfehlung abgetan, ist heute die smarte Wahlmanipulation en vogue, und dies keineswegs nur in Russland, Nordkorea, Belarus oder Georgien.
Aber auch innerhalb (noch) halbwegs funktionierender Demokratien nehmen autoritäre Tendenzen zu. Mehr und mehr präsent sind rechts- und mitunter linkspopulistische Strömungen, die liberal-demokratische Grundpfeiler in Frage stellen, selbst wenn es (vorerst?) weiterhin freie Wahlen gibt. Dies betrifft, um nur einige aufzuzählen, durchaus gegensätzliche Länder wie die Türkei, Slowakei, Ungarn, Polen, Brasilien, Indien oder Indonesien. In einer Reihe solcher Länder kommt es bereits zu relativ deutlichen Beeinträchtigungen der demokratischen Meinungsbildung, indem etwa oppositionelle Strömungen auf unterschiedliche Weise gegängelt werden und die Regierung die Kontrolle über die unabhängigen Gerichte zu übernehmen versucht – etwa in Ungarn, der Türkei oder zeitweise Polen.
In anderen Ländern waren die Probleme bislang subtiler, wenn etwa in den USA seit Jahren auf Bundesstaaten-Ebene das Wahlrecht durch kleine Veränderungen beim Wahlkreiszuschnitt und bei der Zulassung zur Wahl kaum merklich, aber doch manipulativ verändert wird. Einher gehen all diese Entwicklungen mit Verschiebungen im öffentlichen Diskursraum. So ist die in Kapitel 2 geschilderte, wenig kompromiss- und lösungsorientierte und eher demagogische und hasserfüllte Rhetorik auch bei vormaligen „Parteien der demokratischen Mitte“ immer häufiger anzutreffen. Ein besonders plastisches Beispiel dafür bietet die Entwicklung der US-amerikanischen Republikaner, die unter Donald Trump nun in eine offen autoritäre Richtung mit Einschränkungen der Meinungsfreiheit, ungesetzlichen Verhaftungen oder Behinderungen der Justiz abzubiegen drohen. Mit alledem ist eines der größten Probleme noch gar nicht erwähnt: Westliche Demokratien drohen mit dem Lebensstil ihrer Bewohner die Freiheit junger und künftiger Menschen sowie in anderen Teilen der Erde zu ruinieren. Doch diesen Aspekt greifen wir später auf, wenn die Umweltzerstörung in den Blick kommt.
All dies setzt die Demokratie bereits massiven Risiken aus. Es gibt allerdings noch eine andere, ebenfalls herausfordernde Seite der Medaille. Denn nicht wenige sind geneigt, die Geschichte von einem drohenden Verfall der Demokratie eher andersherum zu erzählen. Politiker wie Donald Trump, Marine Le Pen oder Viktor Orbán – und manchmal selbst Wladimir Putin – präsentieren sich selbst nämlich in einem ganz bestimmten Sinne quasi gar nicht als Feinde der Demokratie, sondern als deren Freunde.4Die politische Elite liberaler Demokratien habe nämlich seit längerem begonnen, mehr und mehr eine Politik gegen das eigene Volk zu machen. Dies betreffe Einschränkungen der Meinungsfreiheit etwa in der Corona-Pandemie oder bezogen auf Migrationsfragen oder auf das Verhältnis der Geschlechter – hier werde von „politischer Elite“ und „Medien“ eine bestimmte Linie vorgegeben und jede gegenläufige Ansicht verstärkt unter Druck gesetzt. Auch die zunehmende Migration in westliche Staaten nütze wegen des damit verstärkten Angebots an Billigarbeitskräften nur einer Elite, wogegen einfache Leute dadurch zunehmend am Arbeits- und Wohnungsmarkt unter Druck gerieten. Gleiches gelte für die typische liberal-demokratische Freihandelspolitik, die gerade Menschen mit niedrigerem Bildungsstand durch Konkurrenzunternehmen in Niedriglohnländern aus dem Arbeitsmarkt treibe. Auch der Klimaschutz – anstelle weiter auf vorgeblich billige fossile Brennstoffe zu setzen – schade den einfachen Leuten, weil er die Energiepreise nach oben treibe. Teils wird gar der Klimawandel an sich bezweifelt.
Vieles an dieser Gegenkritik mag als Demokratie-Kritik und vielleicht auch in sich selbst weniger überzeugend sein. Ist man beispielsweise mit einer bestimmten Wirtschafts-, Sozial- oder Migrationspolitik nicht einverstanden, so hat man in Demokratien die Möglichkeit, eine andere Politik zu wählen. Und hält man etwa die Maßnahmen im Zuge einer Pandemie für übermäßig freiheitsbeschränkend, so kann man selbiges tun oder die Gerichte anrufen (auf die Migrationspolitik und, am Beispiel der Identitätspolitik, die freie Rede in Demokratien kommen wir im Laufe des Buches jeweils noch zurück). Ein gravierender Punkt bleibt jedoch: Wenn in einer Gesellschaft die Meinung eine breite Anhängerschaft gewinnt, dass demokratische Politiker nicht in ihrem Interesse handelt, dann ist die Akzeptanz der Demokratie fundamental gefährdet.
Über alledem hängt ein geschichtliches Menetekel. Es verdeutlicht die letztlich globale Dramatik der Situation, selbst für Staaten, die derzeit noch als funktionierende liberale Demokratien gelten können. Historisch betrachtet ist die Demokratie im geschilderten substanziellen Sinne in noch viel krasserem Maße die Ausnahme, als sie es heutzutage ist, wurde in der Menschheitsgeschichte doch nahezu immer autoritär regiert – mal mit begrenzter Mitbestimmung mehr oder weniger kleiner Bevölkerungskreise, mal auch ganz ohne. Es ist historisch kein einziger Fall bekannt, in dem eine ernsthafte freiheitliche Demokratie tatsächlich länger als gut 200 Jahre – selbst bei sehr großzügiger Definition von Demokratie – überlebt hätte. Damit drängt sich eine große Frage auf: Bis zu welchem Grad resultieren die geschilderten Trends aus aktuellen Verwerfungen – und inwieweit muss man nach tieferliegenden Faktoren fragen, die der Demokratie unter Menschen Steine in den Weg legen? Und vielleicht auch dem Frieden und dem Umweltschutz (das wird ausführlich die Frage in Teil II sein).
Digitalisierung: nicht die Hauptursache des autoritären Rollbacks
An aktuellen Entwicklungen, die die Fliehkräfte innerhalb und zwischen Gesellschaften beschleunigen, denkt man spontan an die Haupttendenzen der vergangenen 30 Jahre: Digitalisierung und Globalisierung. Das Zunehmen autoritärer respektive populistischer Tendenzen, sei es weltweit oder speziell in westlichen Gesellschaften, lässt sich naheliegenderweise in Verbindung bringen mit einer Welt, in der die Echokammern der sozialen Medien und digitalisierungsbedingt abnehmende Aufmerksamkeitsspannen für komplexe Analysen es uns zunehmend ermöglichen, nur noch die eigene Sicht der Dinge und den Teil der Fakten, der die eigene Sicht vermeintlich bestätigt, wahrzunehmen. Reiche einflussreiche Einzelpersonen wie Elon Musk können den Mechanismus zudem massiv in ihrem Sinne manipulieren. Man könnte auch sagen: In einer immer komplexeren Welt scheint das Versprechen einer Rückkehr zu einer angenehmen Einfachheit, starken Männern, klaren Sündenböcken und vorgeblich durchgreifenden Lösungen gerade infolge der digitalisierungsbedingten Veränderungen politischer Diskurse immer mehr Zulauf zu finden. Ein kurzer, knalliger X-Post oder TikTok-Kurzvideo ist doch allemal leichter und angenehmer konsumiert als ein differenziertes Analysieren und Abwägen der vielen komplexen Aspekte irgendeiner politischen Grundsatzfrage! Dann ist im Kampf für Migrationsstopp oder Euro-Ausstieg oder einfach um die politische Macht plötzlich jeder Gegner ein Terrorist, ein Volksfeind oder Angehöriger irgendeiner dunklen Macht, die Schaden anrichten möchte. Autoritäre Staaten wie Russland und China steigern all diese Effekte noch durch gezielte Desinformationskampagnen, für die sich die sozialen Medien wiederum bestens eignen.
Indes ließe sich zur Digitalisierung und speziell den sozialen Medien (zur Künstlichen Intelligenz respektive KI siehe gesondert in Kapitel 6) auch die umgekehrte Geschichte erzählen. Das Internet ermöglicht es sehr vielen Stimmen, sich politisch Gehör zu verschaffen, ohne auf einige ausgewählte Journalisten oder eine große eigene Bekanntheit angewiesen zu sein. Damit könnte man die moderne digitale Entwicklung auch gerade als Garant liberal-demokratischer Gesellschaften und eines vielfältigen Diskurses erleben – der zwischenzeitlich gefeierte Arabische Frühling 2011 lässt grüßen. Ist die Digitalisierung damit also demokratisch ambivalent, kommt man unvermeidlich zu der Frage, ob wirklich die Digitalisierung als solche die Ursache für die Krise der Demokratie ist. Sicherlich haben soziale Medien und ihre gewinnorientierten Betreiber das Potenzial hierzu, doch müssen sie dazu auch auf einen Akteur, nämlich den Menschen, treffen, der Verschwörungstheorien etwas abgewinnen kann, der auf Filter-Bubbles reinfällt und bestimmte Dinge eben nicht so gerne und andere dafür umso lieber hören möchte. Zudem ist die Kehrseite des Siegeszugs von Instagram, X, TikTok, Facebook & Co., dass die klassischen, teilweise staatlich alimentierten, bewusst breit und neutral aufgestellten, professionell arbeitenden Medien ihre finanzielle Existenzgrundlage verlieren. Noch in den 1980er Jahren hatten in westlichen Staaten alle Bürger eine mehr oder minder identische Informationsgrundlage. Eine solche gemeinsame Diskursbasis ist heute nur noch rudimentär vorhanden.
Früher, als die meisten Menschen auf dem Dorf oder in kleinen Städten lebten, haben wenige Männer das kontrolliert, was an Informationen zugänglich war: der Lehrer, der Bibliothekar, der Priester. Auch dass über mediale Wege mitunter Sündenböcke auserkoren werden, ist nicht neu, sondern war schon zu Zeiten des ersten Medienhochs in den Kontroversen um die Reformation im 16. Jahrhundert so. Und Desinformations-Kampagnen interessierter Mächtiger gab es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte – sie sind heute leichter zu organisieren, aber gleichzeitig sind sie auch leichter zu überprüfen. Dass alte Intellektuelle wie Jürgen Habermas mit ihren Beziehungen zu einzelnen mächtigen Print-Journalisten nur noch kleine Teile der Öffentlichkeit erreichen, kann man als Problem, aber auch als begrüßenswertes Zeichen von Pluralität und demokratischer Kontrolle erleben. Demagogische Politik oder Kontroversen um Wahrheit sind ganz generell nichts, was der bisherigen Menschheitsgeschichte fremd wäre. Zeitphänomene wie ein zunehmend digitalisierter Medienkonsum wirken aktuell verstärkend, doch multiplizieren sie womöglich einfach eine menschliche Grundkonstellation?
Globalisierung: auch nicht die Hauptursache des Populismus
Allerdings gibt es neben der Digitalisierung weitere aktuelle Entwicklungen, die die Demokratie herausfordern und ihre Gefährdung erklären können: insbesondere die Globalisierung. Die Globalisierung bezeichnet im Kern ein System des weltweiten Freihandels, wenngleich sie nicht auf wirtschaftliche Vorgänge beschränkt ist, sondern zum Beispiel auch die kulturelle Pluralisierung und weitere Entwicklungen wie das zunehmende globale Verhandeln von Umweltproblemen bezeichnen kann.5Die ökonomische Globalisierung hat zwar im Transportkosten- und Informationstechnologiebereich auch technische Ursachen. Im Kern entsteht sie jedoch nicht naturwüchsig, sondern durch politische Entscheidungen für den Freihandel. Vorreiter der Globalisierung, auch und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, war die sukzessive Entstehung der Europäischen Union in den letzten 60 Jahren mit offenen Märkten und Zollfreiheit. Spätestens mit der Gründung der WTO, der Welthandelsorganisation der Nationalstaaten, ist sodann auch international ein komplexes Geflecht globaler und bilateraler Liberalisierungsabkommen entstanden, deren gemeinsame Intention ein möglichst freier Welthandel mit Produkten und Dienstleistungen ist. Die heutige WTO als das institutionelle Gerüst zahlreicher internationaler Wirtschafts- und Handelsverträge gründete sich im Jahr 1994 nach langjährigen Verhandlungen. Im Kern handelt es sich also um einige multilaterale Abkommen von drei Vierteln der Staaten der Welt, ergänzt durch eine große Vielzahl zwischenstaatlicher Verträge. Vorläufervereinbarungen bestanden seit 1947.
Der Freihandel – europäisch oder global – birgt im Wege der internationalen Arbeitsteilung erhebliche Chancen für eine globale Wohlstandssicherung, ebenso wie für einen sanften Export von Freiheit und Demokratie.6Er führt damit ein Wechselverhältnis fort, was sehr oft in den letzten Jahrhunderten auch zwischen Kapitalismus respektive Wohlstandsentwicklung und liberaler Demokratie bestand. Denn Kapitalismus braucht Rechtssicherheit, freie Ideen und Innovationen und verknüpft sich deshalb gern mit freiheitlichen Ordnungen, ebenso wie Markt und Wettbewerb gut zu freiheitlich-demokratischen Grundprinzipien passen – und er brachte Frieden, weil Demokratien nach bisheriger Erfahrung keine Kriege gegeneinander führen. Allerdings wird der freie Wettbewerb respektive Freihandel oft klarer Rahmensetzungen bedürfen, um beispielsweise ökologisch und sozial nicht sehr negative Begleiterscheinungen auszulösen. Dies gilt umso mehr, als der Zusammenhang zwischen Kapitalismus, Freiheit und Demokratie bei aller Affinität kein gänzlich zwangsläufiger ist, wie diverse schwankende Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zeigen.7
Doch bestehen auch große Herausforderungen. Da niedrigere Steuer-, Sozial- und Umweltstandards in der Regel niedrigere Produktionskosten und damit Wettbewerbsvorteile bedeuten, haben Staaten durch den Freihandel potenziell das Problem, dass sie unter jenem Freihandelsdruck genau jene Gestaltungsoption verlieren. Ferner setzen die WTO-Regeln (und die globalen Kapitalmarktregeln) auf ein möglichst „freies Spiel der Kräfte“ zwischen Staaten als „Standorten“ im Sinne eines weltweiten Wettbewerbs um Unternehmensansiedlungen und Kapital. Das begünstigt einen Dumpingwettlauf der Staaten um (vordergründig) kostengünstige Produktionsbedingungen in Gestalt von niedrigen Unternehmenssteuern, Sozial- und Umweltstandards sowie wenig Kapitalmarktbeschränkungen noch.8Denn damit werden nationale Umweltschutzmaßnahmen zum Beispiel nicht nur faktisch durch die Konkurrenz erschwert, sondern oft regelrecht verboten. Mit alledem entsteht nicht nur Druck auf die Sozialsysteme und den Arbeitsmarkt, weil die Arbeitgeberseite mit Abwanderung drohen und damit nicht nur die Politik, sondern auch die Gewerkschaften und allgemein die Belegschaft unter Druck setzen kann. Für gut ausgebildete Menschen ist dies meist von Vorteil, für weniger Gebildete allerdings häufig nicht, weil sich gerade einfache Produktionen etwa aus den Industriestaaten in die Schwellenländer verlagern. Deren Leben wird damit tendenziell fordernder, unübersichtlicher und unsicherer. Was just den Drang nach endlich wieder nach mehr nationaler Kontrolle auslösen kann – „take back control“ war folgerichtig das Motto der Brexiteers in Großbritannien und „make America great again“ jenes von Donald Trump seit 2016 in den USA.
Globalisierung verbunden mit Automatisierung und Rationalisierung kann also eine zunehmende Zweiteilung des Arbeitsmarktes bewirken einschließlich eines Booms oft prekärer einfacher Dienstleistungen. Dies kann gelesen werden als Herausforderung des für westliche Demokratien typischen Versprechens, sozialer Aufstieg und Sicherheit durch Fleiß seien jederzeit möglich. Wohlgemerkt wirkt all dies mit der Digitalisierung, ohne die die Globalisierung nicht möglich gewesen wäre, gerade zusammen. Globalisierung und Digitalisierung ergeben gemeinsam zudem eine Tendenz zur Beschleunigung und Komplexitätssteigerung, die in einem großen Spannungsverhältnis zu einem weiteren essenziellen Charakteristikum von Demokratien steht (neben der Fähigkeit zum sozialen Ausgleich): Es muss genug Zeit für Beratungen und Entscheidungen sein – und die Materie muss von der jeweiligen politischen Einheit überhaupt regelbar sein. Beides scheint in den klassischen nationalstaatlichen demokratischen Verfahren zunehmend nicht mehr gegeben zu sein. Zudem profitieren im globalen Maßstab die Ärmsten vergleichsweise am wenigsten von der Globalisierung.
Doch beweist das Gesagte, wie es gerade Rechts- und Linkspopulisten behaupten, dass die Globalisierung die Demokratie – und womöglich auch Frieden und natürliche Lebensgrundlagen – untergräbt? Im ersten Moment scheint sich das aufzudrängen. Doch ebenso drängen sich erhebliche Zweifel auf, denn dafür ist die Wirkung jener Prozesse zu ambivalent. Wie für den Kapitalismus allgemein, so kann auch für den globalen Freihandel wie gesagt diagnostiziert werden, dass er bis dato für die Bewohner westlicher Staaten in der Summe von Vorteil war, besonders in wirtschaftlich-sozialer Hinsicht. Es sind viele Arbeitsplätze im Export entstanden, und durch den wachsenden Gesamtwohlstand konnten auch Globalisierungsverlierer aus einfachen Fertigungstätigkeiten durch eine sukzessive Stärkung der Sozialsysteme finanziell entschädigt werden. Und die Automatisierung ist heute bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie dies vielleicht später wirklich sein mag und wie sich dies vor allem durch immer stärker lernfähige KI-Anwendungen abzeichnen könnte.
Eher für die Zukunft, mit immer mehr konkurrenzfähigen Ländern im Globalen Süden, stellt die Entwicklung die gewachsene Sozialstaatlichkeit und mehr noch die Klima- und Ressourcenpolitik, so ihre globale Verankerung nicht gelingen sollte, vor gravierende Probleme. Konnten die Nationalstaaten im 20. Jahrhundert durch soziale Ausgleichsmaßnahmen den Kapitalismus für die breiten Massen lebenswert machen, so könnte ihnen dieser Weg nunmehr durch einen drohenden globalen Wettlauf um die „preisgünstigsten“ Standards verstellt sein. Und eine globale (Sozial-)Politikebene gibt es bisher nicht, selbst auf EU-Ebene gibt es sie kaum, anders als teilweise in der Umweltpolitik. Für die Gesamtmenge verteilbaren Wohlstands ist die allerorten hörbare Forderung nach Renationalisierung allerdings gerade fatal, hat doch die Globalisierung in der Summe den Wohlstand deutlich erhöht. Zudem verbindet sich die moderne Existenz auch mit Entfaltungsmöglichkeiten, die es menschheitsgeschichtlich so noch nie gab. Und eine fortschreitende Automatisierung bedroht zwar die Arbeitsgesellschaft und wirft grundlegende Fragen danach auf, wodurch für viele Menschen künftig noch der Tag strukturiert werden wird. Doch umgekehrt könnte weniger Arbeit durchaus auch positive Seiten haben – und bei der ganz großen Verwerfung sind wir eben noch gar nicht angekommen.
Pluralisierung: unfreiwilliges Tor zum Autoritarismus?