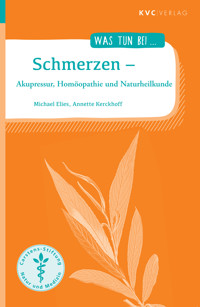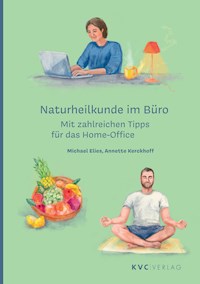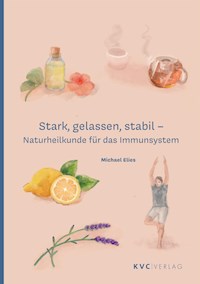54,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl F. Haug
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Praxis Homöopathie Sie haben wenig Zeit und wollen trotzdem das individuell optimale Mittel verschreiben? Dann ist diese praxisorientierte Arzneimittellehre das Richtige für Sie! Diese praxisorientierte Arzneimittellehre bietet Ihnen eine ideale Hilfe für Ihren Alltag. Nutzen Sie die Liste der Auslöser und das Indikationsverzeichnis, um schnell infrage kommende Arzneimittel zu finden. Die häufigsten homöopathischen Arzneimittel sind übersichtlich aufgeführt und somit zügig nachzuschlagen. Sie profitieren von einem schnellen Überblick über - Inhaltsstoffe, - gebräuchliche Potenzen, - Wirkungsrichtung, - Auslöser, - Leitsymptomatik, - Modalitäten, - Indikationen, - Differenzialtherapie, - Antidote und feindliche Beziehungen. Die 5. Auflage ist aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Markus Wiesenauer Michael Elies
Praxis der Homöopathie
Eine praxisbezogene Arzneimittellehre
Die Autoren:
Wiesenauer, Markus, Dr. med. geb. 1951. Studium der Pharmazie und Medizin. In eigener Praxis tätig als Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie, Naturheilverfahren und Umweltmedizin. Mitglied internationaler Fachgesellschaften, ehem. Vorsitzender der Arzneimittelkommission D und HAB, Mitglied der Kommission E am BfArM, Bonn. Zahlreiche Vorträge und Publikationen zum Thema Naturheilverfahren und Homöopathie.
Elies, Michael K. H., Dr. med. geb. 1959. In eigener Praxis tätig als Facharzt für Allgemeinmedizin, Homöopathie und Naturheilverfahren, zugleich Lehrbeauftragter für Geschichte und Entwicklung der Homöopathie. Vorsitzender der Arzneimittelkommission D am BfArM, Bonn. Zahlreiche Vorträge und Publikationen; Praxisschwerpunkt: Schmerztherapie mit Naturheilverfahren und Homöopathie.
Inhalt
Arzneimittelverzeichnis
Vorwort zur 4. Auflage
Vorwort zur 2. Auflage
Einleitung
Arzneimittel von A–Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
Anhang
– Literatur
– Indikationsverzeichnis
– Verzeichnis der Auslöser
Arzneimittelverzeichnis
A
Abies canadensis
Abies nigra
Abrotanum
Acalypha indica
Achillea millefolium
Acidum aceticum
Acidum arsenicosum
Acidum benzoicum
Acidum formicicum
Acidum hydrochloricum
Acidum hydrocyanicum
Acidum hydrofluoricum
Acidum nitricum
Acidum oxalicum
Acidum phosphoricum
Acidum picrinicum
Acidum salicylicum
Acidum sarcolacticum
Acidum silicicum
Acidum sulfuricum
Aconitum napellus
Actaea spicata
Adhatoda vasica
Adlumia fungosa
Adonis vernalis
Aesculus hippocastanum
Aethusa
Agaricus
Agnus castus
Ailanthus
Aletris farinosa
Alfalfa
Allium cepa
Allium sativum
Aloe
Alumina
Aluminium oxydatum
Amanita muscaria
Ambra
Ammonium bitumino-sulfonicum
Ammonium bromatum
Ammonium carbonicum
Ammonium causticum
Ammonium chloratum
Ammonium jodatum
Anacardium
Anagallis
Anamirta cocculus
Angustura
Anhalonium
Antimonium crudum
Antimonium sulfuratum aurantiacum
Antimonium tartaricum
Apis
Apocynum cannabinum
Aralia racemosa
Araneus ixobolus
Araninum
Argentum nitricum
Aristolochia
Arnica montana
Arsenicum album
Artemisia abrotanum
Artemisia cina
Arum triphyllum
Asa foetida
Asarum europaeum
Asclepias tuberosa
Aspidosperma quebracho-blanco
Asterias rubens
Atropa belladonna
Atropinum sulfuricum
Aurelia aurita
Aurum metallicum
Avena sativa
B
Badiaga
Baptisia tinctoria
Barium carbonicum
Barium jodatum
Belladonna
Bellis perennis
Berberis aquifolium
Berberis vulgaris
Bismutum subnitricum
Borax
Bovista
Bromum
Bryonia cretica
Bufo rana
C
Cactus
Cadmium metallicum
Caladium seguinum
Calcium carbonicum Hahnemanni
Calcium fluoratum
Calcium jodatum
Calcium phosphoricum
Calcium sulfuricum
Calendula officinalis
Calvatia gigantea
Camphora
Cannabis indica
Cannabis sativa
Cantharis
Capsella bursa pastoris
Capsicum
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Carboneum sulfuratum
Carcinosinum
Cardiospermum
Carduus marianus
Castor equi
Castoreum
Caulophyllum
Causticum Hahnemanni
Ceanothus americanus
Cedron
Centella asiatica
Cephaelis ipecacuanha
Cerium oxalicum
Chamaelirium luteum
Chamomilla
Cheiranthus cheiri
Chelidonium majus
Chimaphila
China
Chininum arsenicosum
Chininum sulfuricum
Chionanthus virginicus
Cholesterinum
Chondodendron tomentosum
Cicuta virosa
Cimicifuga racemosa
Cina
Cinchona succirubra
Cinnabaris
Cistus canadensis
Citrullus colocynthis
Clematis recta
Cocculus
Coccus cacti
Coffea
Colchicum
Collinsonia
Colocynthis
Comocladia
Conchae
Condurango
Conium maculatum
Convallaria majalis
Conyza canadensis
Corallium rubrum
Crataegus
Crocus sativus
Crotalus horridus
Croton tiglium
Cuprum aceticum
Cyclamen europaeum
Cypripedium
Cytisus scoparius
D
Dactylopius coccus cacti
Daphne mezereum
Datisca
Datura stramonium
Delphinium staphisagria
Dichapetalum
Dieffenbachia seguine
Digitalis purpurea
Dioscorea villosa
Dolichos pruriens
Drosera
Dulcamara
E
Echinacea
Eichhornia
Equisetum
Erigeron canadensis
Espeletia grandiflora
Eucalyptus
Eupatorium perfoliatum
Euphorbium
Euphrasia officinalis
Euspongia officinalis
F
Fabiana
Fagopyrum
Ferrum aceticum
Ferrum arsenicosum
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Ferrum picrinicum
Ferula moschata
Filipendula ulmaria
Flor de piedra
Formica rufa
G
Galipea officinalis
Galphimia glauca
Gaultheria procumbens
Gelsemium
Gentiana lutea
Geranium maculatum
Ginseng
Glonoinum
Gnaphalium polycephalum
Graphites
Gratiola officinalis
Grindelia robusta
Guaiacum
Gummi gutti
H
Hamamelis
Haplopappus
Harpagophytum
Hedera helix
Hekla lava
Helianthemum canadense
Helleborus niger
Helonias dioica
Hepar sulfuris
Hydrargyrum sulfuratum rubrum
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle asiatica
Hyoscyamus niger
Hypericum perforatum
I
Iberis amara
Ichthyolum
Ignatia
Ipecacuanha
Iris versicolor
J
Jaborandi
Jodum
Juglans regia
Juniperus sabina
Justicia adhatoda
K
Kalium bichromicum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium chloratum
Kalium jodatum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Kalmia latifolia
Kreosotum
L
Lac caninum
Lachesis
Lachnanthes tinctoria
Lactuca virosa
Lapis albus
Latrodectus mactans
Laurocerasus
Ledum palustre
Leonurus cardiaca
Leptandra
Lilium tigrinum
Lithium carbonicum
Lobaria pulmonaria
Lobelia inflata
Lophophora williamsii
Lophophytum leandri
Luffa
Lycopodium
Lycopus
Lytta vesicatoria
M
Magnesium carbonicum
Magnesium chloratum
Magnesium fluoratum
Magnesium jodatum
Magnesium phosphoricum
Magnesium sulfuricum
Mahonia aquifolium
Malandrinum
Mandragora e radice
Marsdenia cundurango
Marum verum
Matricaria chamomilla
Medicago sativa
Medorrhinum
Medusa
Melilotus officinalis
Mephitis putorius
Mercurius bijodatus
Mercurius jodatus flavus
Mercurius solubilis
Mercurius sublimatus corrosivus
Mezereum
Millefolium
Momordica balsamina
Moschus
Mucuna pruriens
Murex
Myrica cerifera
Myristica fragrans
Myristica sebifera
Myrrhis odorata
Myrtillocactus
N
Naja tripudians
Natrium carbonicum
Natrium chloratum
Natrium choleinicum
Natrium nitricum
Natrium phosphoricum
Natrium sulfuricum
Natrium tetraboraticum
Nerium oleander
Niccolum metallicum
Nicotiana tabacum
Nitroglycerinum
Nuphar luteum
Nux moschata
Nux vomica
O
Oenanthe aquatica
Oenanthe crocata
Okoubaka
Oleander
Opium
P
Paeonia officinalis
Paloondo
Panax quinquefolius
Pareira brava
Paris quadrifolia
Passiflora
Perilla ocymoides
Petroleum
Petroselinum
Phellandrium aquaticum
Phosphorus
Phytolacca
Pichi-Pichi
Picrasma excelsa
Picrorhiza
Pilocarpus jaborandi
Piper methysticum
Plantago major
Platinum metallicum
Plumbum metallicum
Podophyllum
Polygala senega
Populus
Potentilla anserina
Prunus laurocerasus
Prunus spinosa
Pseudognaphalium obtusifolium
Psorinum
Ptelea trifoliata
Pulsatilla pratensis
Pyrogenium
Q
Quassia amara
Quebracho
R
Ranunculus bulbosus
Ratanhia
Rauwolfia serpentina
Rheum
Rhododendron
Rhus toxicodendron
Robinia
Rubia tinctorum
Rumex
Ruta graveolens
S
Sabadilla
Sabal
Sabdariffa
Sabina
Sambucus nigra
Sanguinaria canadensis
Sanicula (aqua)
Sanicula europaea
Sarothamnus scoparius
Sarsaparilla
Schoenocaulon officinale
Scilla maritima
Scutellaria lateriflora
Secale cornutum
Selenicereus grandiflorus
Selenium
Semecarpus anacardium
Senecio aureus
Senega
Sepia
Serenoa repens
Silicea
Silybum marianum
Simaruba cedron
Smilax officinalis
Solanum dulcamara
Solidago virgaurea
Spigelia anthelmia
Spiraea ulmaria
Spongia
Spongilla lacustris
Stannum jodatum
Stannum metallicum
Staphisagria
Stibium sulfuratum nigrum
Sticta
Stramonium
Strontium carbonicum
Strophanthus gratus
Strychninum nitricum
Strychnos ignatii
Strychnos nux vomica
Sulfur
Sulfur jodatum
Sulfur stibiatum aurantiacum
Sumbulus
Symphoricarpus
Symphytum
Syphilinum
Syzygium jambolanum
T
Tabacum
Tarantula hispanica
Taraxacum
Tellurium
Terebinthina
Terebinthinae aetheroleum
Teucrium marum
Teucrium scorodonia
Thallium aceticum
Thlaspi bursa pastoris
Thryallis glauca
Thuja occidentalis
Toxicodendron quercifolium
Trillium erectum
Tuberkulinum Koch
U
Urginea maritima var. rubra
Urtica urens
Ustilago maydis
Ustilago zeae
V
Valeriana
Veratrum album
Veratrum viride
Verbascum thapsiforme
Veronica virginica
Viburnum
Vinca minor
Virola sebifera
Viola tricolor
Vipera berus
Viscum album
Vitex agnus castus
W
Wyethia
X
Xanthoxylon fraxineum
Z
Zincum metallicum
Zincum valerianicum
Zingiber
Vorwort zur 4. Auflage
Die homöopathische Therapierichtung findet bei Ärzten, Apothekern und Patienten eine ständig steigende Akzeptanz. Denn bei sachgerechter Anwendung lassen sich homöopathische Arzneimittel ohne Gefahr von Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen einsetzen, auch in Schwangerschaft und Geburtshilfe sowie in der Kinderheilkunde. Insofern haben wir auch am originären Konzept des Buches festgehalten, eine auf die Bedürfnisse der täglichen Praxis ausgerichtete Arzneimittellehre fortzuschreiben.
Neben der Aufnahme weiterer bewährter Arzneimittel haben wir insbesondere die Differenzialtherapie sowie das Indikationsverzeichnis überarbeitet. Ebenfalls neu aufgenommen wurden Antidote und sogenannte feindliche Beziehungen der Arzneimittel zueinander. Dies trägt zur Effizienzsteigerung der homöopathischen Therapie mit bei. Zusammen mit dem neuen Layout wird auch die Praktikabilität für die tägliche Arbeit weiter optimiert. Dazu trägt auch die Beibehaltung der traditionellen Nomenklatur der Arzneimittel mit bei; die im Homöopathischen Arzneibuch (HAB) sowie in den Aufbereitungsmonographien geführte neue Nomenklatur findet sich vergleichend im Arzneimittelverzeichnis. Wie immer sind wir für konstruktive Kritik und Hinweise dankbar und bitten wie bei den vorangegangenen Auflagen weiterhin um regen Austausch mit den Benutzern dieser praxisbezogenen Arzneimittellehre.
Die langjährige und bewährte Zusammenarbeit mit dem Hippokrates Verlag wollen wir würdigend hervorheben.
Frühjahr 2004
Markus Wiesenauer, Weinstadt
Michael Elies, Laubach
Vorwort zur 2. Auflage
Seit dem Erscheinen der 1. Auflage einschließlich mehrerer unveränderter Nachdrucke war eine systematische Überarbeitung notwendig geworden, zumal durch die Co-Autorenschaft mit Michael Elies sich neue Ideen aus Sicht der homöopathischen Praxis entwickeln und umsetzen ließen.
Unter Beibehaltung des originären Konzepts haben wir die Darstellung bei jedem Arzneimittel erweitert, indem die Causa und die Modalitäten neu aufgenommen resp. erweitert wurden. Zusammen mit der prägnanten Leitsymptomatik wird es dadurch möglich, sich fundiert und praxisbezogen über das Einzelmittel zu informieren.
Durch die Aufnahme weiterer Arzneimittel, die sich uns in praxi bewährt haben, soll die Arzneimittellehre auch Spiegelbild dessen sein, was als häufiger eingesetzte Homöopathika bezeichnet werden muss. Auch haben wir uns aus Gründen der Praktikabilität dafür entschieden, die Arzneimittel gemäß traditioneller Nomenklatur in das Alphabet aufzunehmen, wohlwissend, dass das Homöopathische Arzneibuch wie auch die Aufbereitungsmonographien sich der neuen Namensgebung bedienen. Alte und neue Bezeichnungen finden sich jedoch im Arzneimittelverzeichnis.
Wir würden uns über einen häufigen Gebrauch des Buches freuen, zumal gerade daraus konstruktive Kritik für nachfolgende Auflagen entsteht.
Die Zusammenarbeit mit dem Hippokrates Verlag war wiederum sehr harmonisch und erfreulich, wofür wir sehr herzlich danken.
Frühjahr 1995
Markus Wiesenauer, Weinstadt
Michael Elies, Laubach
Einleitung
Auswahl und Anwendung homöopathischer Arzneimittel erfordern die Beachtung gewisser Kriterien, um das therapeutische Potenzial der Homöopathie optimal einsetzen zu können. Grundsätzlich stellt die Homöopathie eine Behandlungsmöglichkeit innerhalb des gesamten Spektrums der zur Verfügung stehenden Therapiemaßnahmen dar, wobei sie nach derzeitigem Erkenntnisstand als eine Reiz- und Regulationstherapie interpretiert werden muss.
Grobschematisch lassen sich die Wirkungsprofile homöopathischer Arzneimittel in drei Gruppen einteilen, was zugleich die Wirkungsrichtung und deren therapeutischen Umfang zu verdeutlichen hilft; die Übergänge zwischen den einzelnen Gruppen sind dabei fließend.
Organotropie/Histiotropie:
Die Wirkung dieser Arzneimittel richtet sich auf ein Organsystem resp. Gewebe; oftmals können die damit verbundenen Erkrankungen mit einigen wenigen, jedoch typischen Symptomen („Syndrom“) charakterisiert werden, weshalb in der homöopathischen Literatur dafür auch der Begriff „bewährte Indikation“ verwendet wird.
Funktiotropie:
Der Anwendungsbereich dieser Arzneimittelgruppe geht über den Organ-/Gewebsbezug hinaus und nimmt Regulationsmechanismen (nerval, humoral) zum Ansatzpunkt. Auslöser (Causa) der Beschwerden und durchgängig bessernde/verschlechternde Einflüsse (Modalitäten) sind besondere Merkmale zur Differenzierung.
Personotropie:
Bei der Auswahl dieser Arzneimittel sind – neben den beiden oben aufgeführten – vor allem die Kriterien Konstitution, Disposition und Diathese zu berücksichtigen, was eine homöopathisch exakte Statuserhebung (biographische Anamnese) in besonderem Maße voraussetzt. Wegen der umfassenden Wirkung personotroper Arzneimittel werden sie auch als Polychreste (= viel verwendete Mittel) sowie als Konstitutionsmittel bezeichnet.
Aus der skizzierten Einteilung resultiert der jeweilige Umfang der in diesem Buch dargestellten Arzneimittel, wobei auf die Einhaltung einer systematischen Darstellung größtmöglicher Wert gelegt wurde.
Die Indikation für das homöopathische Arzneimittel orientiert sich an einer möglichst großen Kongruenz („Ähnlichkeit“) zwischen Arzneimittelbild (Pharmakodynamik) und Krankheitsbild (individueller Krankheitsstatus):
Das Krankheitsbild erfasst die individuell ausgeprägten phänomenologischen Erscheinungen im Sinne des subjektiven Befindens zusammen mit den objektiven Befunden, was mit dem aus unterschiedlichen Quellen entstandenen Arzneimittelbild verglichen wird. Bei möglichst genauer Übereinstimmung zwischen Krankheitsbild und Arzneimittelbild ist das Homöotherapeutikum indiziert (Simile-Regel: Similia similibus curentur – Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt).
Die einzelnen Arzneimittel werden nach folgender Systematik dargestellt:
Bezeichnung des Arzneimittels und die in der homöopathischen Nomenklatur übliche Abkürzung.
Chemische, botanische oder zoologische Fachbezeichnung, Synonyma, deutscher Name sowie Zugehörigkeit.
Herkunft oder Vorkommen des Arzneigrundstoffes.
Inhaltsstoffe des Arzneigrundstoffes; Herstellung des Arzneimittels gemäß Vorschriften des homöopathischen Arzneibuchs sowie seiner Nachträge (HAB).
Arzneistärke.
Bezug (Wirkungsrichtung des Arzneimittels).
Auslöser (Causa).
Leitsymptomatik (Charakteristika).
Modalitäten.
Klinische Indikationen; objektive und subjektive Symptome.
Wesentlichste Differenzialtherapie.
Antidote.
Feindliche Beziehungen.
Die Verschreibung homöopathischer Einzelmittel umfasst:
Bezeichnung des Arzneimittels unter Angabe von Arzneistärke, Darreichungsform und Packungsgröße; ggf. Name des Herstellers bei Originalpackungen.
Nennung der Dosierung.
Je nach Akuität und Chronizität der Erkrankung und damit auch in Abhängigkeit der Reagibilität des Organismus müssen homöopathische Arzneimittel bei der Dosierung nach Arzneistärke („Potenz“) und Arzneimenge differenziert eingesetzt werden.
Verschreibungsbeispiele:
Arnica D8 Dil. 20.0
S: 2-stündlich 3 Tropfen
Nux vomica D12 Tabl. 80 Stück
S: 2x täglich 1 Tablette
Cypripedium D4 Glob. 10.0
S: abends 5 Kügelchen
Lachesis D12 Amp. Nr. X
Hinweis: Eine Dezimalpotenz (z.B. D6) ist mit der analogen Centesimalpotenz (z.B. C6) wirkungsäquivalent.
Darreichungsformen homöopathischer Arzneimittel
Urtinktur
–
Ø
Dilution
–
dil.
Tropfen, Lösung
Tabuletta
–
tab.
Tablette
Trituratio
–
trit.
Verreibung
*
Globulus
–
glob.
Streukügelchen
Ampulle
–
amp.
Injektionslösung
* kaum mehr gebräuchlich
Äquivalente Einzeldosis (Humanmedizin) bei „tiefen“ Potenzen
Dil.:
3–5–7 Tropfen
Tabl.:
1 Tablette
Trit.:
1 Messerspitze
Glob.:
3–5–7 Streukügelchen
Amp.:
2–5 ml
Äquivalente Einzeldosis (Veterinärmedizin) für tiefe Potenzen
Kleintier Großtier
Dil. 5 Tropfen 12–25 Tropfen
Tabl. 1 2–3
Amp.
*
1–2 ml. sc. 5–10 ml sc.
* Bei empfindlichen Tieren an der Vorderbrust streng subkutan injizieren (n. Wolter)
Auf die Wirkungsrichtung bezogene Dosierung am Beispiel Globuli
Histiotrop/Organotrop
D/C 4–6–8 („tiefe“ Potenz)
5–7 Globuli
Funktiotrop
D/C 10–12–15 („mittlere“ Potenz)
2–4 Globuli
Personotrop
D/C 30–200–500 („hohe“ Potenz)
1–2 Globuli
Dosierungsrichtlinien
Stadium
Wiederholung der Einzeldosis
Perakut Akut Subakut Chronisch
alle 2–3 Minuten alle halbe resp. volle Stunde alle zwei Stunden 2–3-mal täglich und seltener
bei Wiederkehr der Ausgangssymptomatik
Hinweis:
Entgegen anderslautender Hinweise im Pflichttext der Arzneimittel („Packungsbeilage“) können die homöopathischen Einzelmittel bei Kindern ohne Altersbegrenzung sowie in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden, vorausgesetzt ist eine sachgerechte Anwendung!
Arzneimittel von A–Z
Abies nigra – Abies-n
Picea mariana (Amerikanische Schwarzfichte); Pinaceae
Amerika
Harzsäuren; eingetrocknetes Harz nach Vorschrift 4a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zum Magen-Darm-Kanal.
Alte Menschen, Schwangerschaft.
Auslöser
Tee, Tabak.
Leitsymptomatik
Druckgefühl im Magen und Aufstoßen wie nach Eiern; morgendliche Appetitlosigkeit bei Heißhunger am Nachmittag. Verlangen nach Fleisch und würzigen Speisen.
Modalitäten
Verschlimmerung
nach dem Essen.
Besserung
durch Erbrechen.
Indikationen
Gastritis, Dyspepsie, Obstipation; Trockenheit im Mund mit Durstgefühl, Magenschmerzen mit saurem Aufstoßen, obstipierter Stuhl vergl. Leitsymptomatik.
Differenzialtherapie
Antimonium crudum, Carbo vegetabilis, Eichhornia, Ignatia, Nux vomica, Pulsatilla.
Antidote
Aconitum.
Hinweis
Abies canadensis – Abies-c (Hemlocktanne; Pinaceae) hat eine histiotrope Beziehung zum Magen-Darm-Kanal sowie zum weiblichen Genitale.
Abrotanum – Abrot
Artemisia abrotanum (Eberraute); Asteraceae
Südeuropa, China
Flavone, Bitter- und Gerbstoffe; frische junge Triebe und Blätter nach Vorschrift 3a und 7.
Ø, D2, D4, D6, Salbe.
Bezug
Histiotrop zum Gefäß- und Lymphsystem, den serösen Häuten, zum Magen-Darm-Kanal sowie zur Haut. Kachexie.
Auslöser
Säfteverlust.
Leitsymptomatik
Abmagerung bei gutem Appetit; Lymphadenopathie mit Fieberschüben; vikariierende Beschwerden. Seröse Ergüsse.
Rekonvaleszenzmittel bei anämischen und kachektischen Patienten, auch bei Kindern und Jugendlichen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte und Nässe.
Besserung
durch Wärme, Essen.
Indikationen
Pädatrophie, Dyspepsie; Bauchkrämpfe, Flatulenz, wechselnde Stuhlkonsistenz.
Seröse Ergüsse; Hydrozele, Pleura- und Peritonealerguss bei rheumatischer oder tuberkulöser Grunderkrankung.
Angiopathie, Perniones; Durchblutungsstörungen an Fingern und Zehen, blaurot-fleckige Verfärbung, Parästhesien.
Differenzialtherapie
Agaricus, Bryonia, Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum, Carbo vegetabilis, Hedera helix, Kreosotum, Lachesis, Pulsatilla, Sulfur.
Acalypha indica – Acal
Acalypha indica (Brennkraut); Euphorbiaceae
Fernost
Ätherisches Öl, Gerbstoff, Harz; frische, oberirdische Teile blühender Pflanzen nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zur Lunge.
Auslöser
Infektionen, Tuberkulose.
Leitsymptomatik
Trockener, schmerzhafter Husten mit sanguinolentem Sputum, insbesondere bei chronischen Lungenerkrankungen (Bronchitis, Bronchiektasie, Emphysem). Durchfall mit gleichzeitigem Blähungsabgang.
Modalitäten
Verschlimmerung
am Morgen.
Indikationen
Hämoptoe, (chron.) Bronchitis.
Differenzialtherapie
Ipecacuanha, Kreosotum, Millefolium, Phosphorus.
Acidum aceticum – Acet-ac
Acidum aceticum (Essigsäure)
Nach Vorschrift 5a und 7.
D6, D12.
Bezug
Funktiotrop zum Gerinnungssystem.
Auslöser
Verdorbene Nahrung, Verletzungen, Schwangerschaft.
Leitsymptomatik
Abmagerung und Schwäche, wachsartige Blässe der Haut. Brennender Schmerz in Brustkorb und Magen, danach Kälte der Haut und kalter Schweiß auf der Stirn. Husten beim Einatmen. Blutungen nach Wehen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Rückenlage, morgens, Kälte.
Besserung
durch Bauchlage, nach Essen.
Indikationen
Blutungen jedweder Genese, Fleischvergiftung.
Lumbalgie; durch Überheben, besser in Bauchlage.
Stich-/Bissverletzungen, variköse Ödeme.
Differenzialtherapie
Arsenicum album, China, Digitalis.
Antidote
Aconitum, Arsenicum album, Calcium carbonicum, China, Magnesium carbonicum, Opium, Stramonium, Tabacum.
Feindliche Beziehungen
Arnica, Belladonna, Borax, Causticum, Lachesis, Mercurius, Nux vomica, Ranunculus, Sarsaparilla.
Acidum benzoicum – Benz-ac
Acidum benzoicum (Benzoesäure) aus Styrax-Arten; Styracaceae Asien
Sublimierte Benzoesäure aus Siambenzoe nach Vorschrift 5a und 6.
D4, D6, D12.
Bezug
Organotrop zu den ableitenden Harnwegen sowie zum Stütz- und Bewegungsapparat.
Auslöser
Überanstrengung, Erkältung.
Leitsymptomatik
Wandernde Schmerzen in Muskeln und Gelenken mit allgemeiner Schwäche und Schweißen. Ein dunkler, scharf riechender Urin (Pferdeurin) gilt als besonderer Hinweis.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte, Nässe, Entblößen, Ruhe.
Indikationen
Pyelonephritis, Zystitis, Urethritis; dumpfe Schmerzen im Nierenlager, Dysurie, Proteinurie, übel riechender Harn.
Gelenk- und Weichteilrheumatismus (fokalinfektiös); rheumatoide Schmerzen in den verschiedensten Gelenken und Muskeln.
Tendovaginitis, Ganglien.
Differenzialtherapie
Berberis vulgaris, Caulophyllum, Colchicum, Lycopodium, Ledum, Sepia, Spigelia.
Feindliche Beziehungen
Copaiva.
Acidum hydrochloricum – Mur-ac
Acidum hydrochloricum (Acidum muriaticum, Salzsäure);
HCL
Verdünnte Salzsäure nach Vorschrift 5a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zum Verdauungskanal.
Auslöser
Infektionskrankheit.
Leitsymptomatik
Schwäche und Benommenheit, Berührungsempfindlichkeit. Die Absonderungen sind von üblem Geruch und wundmachend.
Neigung zu Schleimhautblutungen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte, Nässe, Reizung der Sinnesorgane.
Besserung
durch Ruhe, Linkslage.
Indikationen
Herpes labialis; Stomatitis; Aphthen, Soor; Entzündungen im Mundraum.
Maldigestion, Dyspepsie, Gastritis; übler Geschmack im Mund bei Foetor ex ore, saures Aufstoßen, Sodbrennen, Abneigung gegen Fleisch.
Stuhlinkontinenz; unwillkürlicher Stuhlabgang, auch beim Wasserlassen.
Hämorrhoiden; Schmerzen und Brennen, ödematös.
Differenzialtherapie
Acidum nitricum, Acidum phosphoricum, Arsenicum album, Borax, Carbo vegetabilis, Phosphorus, Robinia.
Antidote
Bryonia, Camphora, Ipecacuanha.
Acidum hydrocyanicum – Hydr-ac
Acidum hydrocyanicum (Blausäure); HCN
Blausäure nach Vorschrift 5a und 7.
D12.
Bezug
Funktiotrop zum ZNS.
Auslöser
Hitze.
Leitsymptomatik
Kreislaufkollaps mit Zyanose und kaltem Schweiß, Präkordialangst und Dyspnoe; epileptiforme Zustände. Tonisch-klonische Muskelkrämpfe.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Reizung der Sinnesorgane.
Besserung
durch Einhüllen, frische Luft.
Indikationen
Insolation, Apoplexie, epileptiforme Zustände; Ohnmacht.
Kollapszustände; Tachyarrhythmie, pektanginöse Beschwerden.
Asthma bronchiale, Cor pulmonale; Angst, Dyspnoe, Schweiße, Zyanose, krampfartiger Husten.
Differenzialtherapie
Camphora, Glonoinum, Lachesis, Veratrum album.
Antidote
Camphora, China, Coffea, Ferrum, Ipecacuanha, Nux vomica, Opium, Veratrum album.
Acidum hydrofluoricum – Fl-ac
Acidum hydrofluorium (Flusssäure); (HF)n in H2O
Flusssäure nach Vorschrift 5a und 7.
D6, D12.
Bezug
Organotrop zum Lymph- und Venensystem, Stütz- und Bewegungsapparat sowie zur Haut.
Auslöser
Hitze.
Leitsymptomatik
Adynamie, unruhig, hastig. Abmagerung bei gutem Appetit, Kachexie. Neigung zu Muskelspasmen und Zittern. Hitzegefühl bei kaltschweißigen Händen und Füßen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Reizmittel, schwüles Wetter, bei Sekretstauung (z.B. Sinusitis).
Besserung
durch Essen, Gehen im Freien, Abkühlung.
Indikationen
(Chron.) Sinusitis; stockendes oder auch fließendes Nasensekret.
Hyperthyreotische Struma.
Karies; Zahnschmerzen bei kariösen Zähnen.
Lymphstauung bei Zustand n. Op.
Arthrose, Tendovaginitis, chron. Osteomyelitis; Muskelschwäche, Knochenschmerzen.
Varikosis, Ulcus cruris; Krampfadern, gestaute und erweiterte Venen, Wundheilungsstörungen.
Hämangiom, Naevus, Ekzem, Pruritus; heftiges Hautjucken, Bläschen und Pusteln, reduzierter Hautturgor, Entzündung alter Narben, Haarausfall, spröde und brüchige Nägel.
Differenzialtherapie
Abrotanum, Aesculus, Calcium fluoratum, Hedera helix, Hamamelis, Pulsatilla, Sabdariffa, Spongia, Sulfur.
Antidote
Silicea.
Hinweis
Der Anwendungsbereich von Acidum hydrofluoricum entspricht in etwa dem von Calcium fluoratum.
Acidum nitricum – Nit-ac
Acidum nitricum (Salpetersäure); HNO3
Verdünnte Salpetersäure nach Vorschrift 5a und 7.
D6, D12.
Bezug
Histiotrop zum Verdauungskanal und zu den ableitenden Harnwegen.
Auslöser
Quecksilber.
Leitsymptomatik
Allgemeine Schwäche, innere Unruhe und Zittern, Überempfindlichkeit gegen Berührung und Geräusche.
Neigung zu Erkältungen; entzündliche Veränderungen an Haut und Schleimhäuten (insbesondere der Übergänge) mit Neigung zu Fissuren und Ulzerationen.
Ausgeprägter Splitterschmerz; saure, übel riechende Schweiße.
Modalitäten
Verschlimmerung
abends und nachts, durch Nässe und Kälte, bei Wetterwechsel.
Besserung
durch Fahren.
Indikationen
Stomatitis, Gingivitis, Aphthen; Entzündung der Schleimhäute, wunde Mundwinkel.
Gastritis, Ulcus ventriculi et duodeni; unspezifische Magensymptomatik wie rasches Sättigungsgefühl, Aufstoßen, Spasmen.
Enteritis, Colitis ulcerosa; harter oder durchfälliger Stuhl, Schleimabgang.
Analfissur, Hämorrhoiden; lang anhaltender Schmerz mit Blutung nach der Defäkation.
Nephritis, Nephrose, Pyelonephritis; Proteinurie, Zylindrurie, Hämaturie bei übel riechendem, dunklem Harn.
Urethritis, Prostatitis, Balanitis, Vulvovaginitis; Schmerzen und Brennen beim Urinieren, übel riechend, dunkel; Fluor mit Jucken und Brennen, auch Zustand nach venerischen Erkrankungen.
Differenzialtherapie
Acidum muriaticum, Argentum nitricum, Kreosotum, Natrium sulfuricum, Paeonia, Sulfur, Thuja.
Antidote
Aconitum, Belladonna, Camphora, Conium, Digitalis, Jodum, Lycopodium, Mercurius, Mezereum, Petroleum, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulfur.
Feindliche Beziehungen
Calcium carbonicum, Hepar sulfuris, Lachesis, Natrium chloratum.
Acidum oxalicum – Ox-ac
Acidum oxalicum (Oxalsäure)
Oxalsäure nach Vorschrift 5a und 6.
D6, D12.
Bezug
Organotrop zu peripherem Nervensystem, Herz-Kreislauf-System, Magen-Darm-Kanal, ableitenden Harnwegen, Stütz-/Bewegungsapparat.
Auslöser
Überanstrengung.
Leitsymptomatik
Schießende Schmerzen, wie Stromstöße, mit nachfolgender Taubheit und Kältegefühl, Oxalatsteine, marmorierte Haut.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Denken an die Beschwerden, Bewegung, feuchte Kälte, sexuelle Überanstrengung, Stimulanzien.
Besserung
durch Ruhe, Wärme, Absonderungen.
Indikationen
Angina pectoris.
Neuralgien, Arthralgien bei Nephrolithiasis.
Differenzialtherapie
Acidum nitricum, Cactus grandiflorus, Staphisagria, Zincum metallicum.
Acidum phosphoricum – Ph-ac
Acidum phosphoricum (Phosphorsäure); H3PO4
Verdünnte Phosphorsäure nach Vorschrift 5a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Funktiotrop zum ZNS.
Auslöser
Überanstrengung, Sorgen, (Liebes-) Kummer, Wachstum.
Leitsymptomatik
Apathie, Schwäche, Erschöpfung, Psychische und physische Schwächezustände mit Kreislauflabilität. Schwächende Schweiße, Schläfrigkeit, sexuelle Übererregtheit.
Modalitäten
Verschlimmerung
nachts, durch Kälte; schlimmer durch Sinneseindrücke wie Licht, Lärm.
Besserung
durch Wärme.
Indikationen
Erschöpfungszustände physischer und psychischer Art, Rekonvaleszenz; schläfrig, benommen, kann die Gedanken nicht sammeln, Kopfschmerzen, Schwäche infolge von Krankheiten, durch intensives Lernen, infolge schnellen Wachstums.
Cor nervosum; Herzsensationen, Tachykardie, Kurzatmigkeit.
Gastroenteritis; saures und bitteres Erbrechen, Flatulenz, schmerzlose Diarrhöen, die erleichtern.
Wachstumsschmerzen, Rachitis; Knochen-, Gelenk- und Muskelschmerzen, Gliederschwäche.
Differenzialtherapie
Ambra, Argentum nitricum, Calcium phosphoricum, China, Ferrum arsenicosum, Kalium phosphoricum, Phosphorus.
Antidote
Aconitum, Arnica, Camphora, Cocculus, Coffea, Ferrum, Lachesis, Nux vomica, Staphisagria, Sulfur.
Hinweis
Der Anwendungsbereich von Acidum phosphoricum in höheren Potenzen entspricht in etwa dem von Phosphorus.
Acidum picrinicum – Pic-ac
Acidum picrinicum (2,4,6-Trinitrophenol; Pikrinsäure); C6H3N3O7
2,4,6-Trinitrophenol nach Vorschrift 5a und 7.
D6, D12.
Bezug
Histiotrop zum ZNS.
Auslöser
Sorgen, Kummer, Hitze.
Leitsymptomatik
Erschöpfungszustände, depressive Verstimmung, Schlaflosigkeit; sexuelle Übererregtheit. Lähmungsartige Schwächezustände.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Wärme und Sonne; schlimmer durch psychische Ereignisse, Bewegung.
Besserung
durch Kühle, kaltes Wetter, durch Niederlegen.
Indikationen
Erschöpfungszustände; heftige Kopfschmerzen wie zum Bersten, Schwindel, ausgeprägte Bewegungsverschlimmerung.
Prostatahyperplasie; häufiger und plötzlich auftretender Harndrang, Pollutionen.
Acne vulgaris, Ohrekzem, Verrucae; Pusteln, Furunkel, nächtlicher Pruritus.
Differenzialtherapie
Acidum phosphoricum, Barium carbonicum, Conium, Hyoscyamus, Kalium phosphoricum, Magnesium jodatum, Sabal, Staphisagria, Zincum metallicum.
Acidum salicylicum – Sal-ac
Acidum salicylicum (Salizylsäure); C7H6O3
Salizylsäure nach Vorschrift 5a und 6.
D6, D12.
Bezug
Organotrop zum ZNS, Stütz- und Bewegungsapparat sowie zur Haut.
Auslöser
Erkältung.
Leitsymptomatik
Hitze, Schweißausbrüche, Wallungen, Schwindel, Ohrensausen; Quaddeln, Petechien.
Modalitäten
Verschlimmerung
nachts, bei Berührung und Bewegung.
Besserung
durch frische Luft, Absonderung von Körpersekreten (Harn, Schweiß).
Indikationen
Kopfschmerzen, Trigeminusneuralgie; reißende, klopfende Schmerzen, Schwindel mit Kopfkongestion.
Morbus Menière; erschwertes Hören, Ohrensausen.
Rheumatischer Formenkreis; rheumatische Gelenk- und Muskelschmerzen, Nervenschmerzen.
Urtikaria, Erythem; Bläschen, Papeln, reichliche Schweißabsonderung.
Differenzialtherapie
Bryonia, Gaultheria procumbens, Ledum, Paloondo, Spiraea ulmaria.
Acidum sarcolacticum – Sarcol-ac
Acidum sarcolacticum (L + -Form der Milchsäure); C3H6O3
Milchsäure nach Vorschrift 5a und 7.
D6, D12 (Dil., Tabl.).
Bezug
Organotrop zum Magen-Darm-Trakt sowie zum Stütz- und Bewegungsapparat.
Auslöser
Überanstrengung, Infektionskrankheit, Medikamentennebenwirkung.
Leitsymptomatik
Muskelschmerzen, Adynamie, Zerschlagenheitsgefühl.
Sodbrennen, saures Erbrechen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Bewegung, Berührung.
Indikationen
Rhinitis, Pharyngo-Laryngitis, Bronchitis, Pleuritis; trockene Schleimhautkatarrhe mit schmerzhaften, nächtlichen Hustenanfällen.
Hyperazidität, Gastritis; saures Erbrechen, Magendrücken und -schmerzen, Flatulenz.
Muskelrheumatismus; Muskelschwäche und -schmerzen, Muskelkater, Schmerzen bei geringsten Anstrengungen. Herzmuskelschwäche bei/nach Infektionskrankheit.
Differenzialtherapie
Bryonia, Capsicum, Eupatorium perfoliatum, Rhus toxicodendron, Rhododendron, Robinia.
Acidum sulfuricum – Sulf-ac
Acidum sulfuricum (Schwefelsäure); H2SO4
Schwefelsäure nach Vorschrift 5a und 7.
D4, D6, D12 (Glob. ab D10).
Bezug
Organotrop zu den Atemwegen, zum Magen-Darm-Trakt, zum weiblichen Genitale sowie zum Stütz- und Bewegungsapparat.
Auslöser
Blei, Alkoholvergiftung.
Leitsymptomatik
Müdigkeit, Schwäche und Zittern sowie Reizbarkeit, Hast und Ungeduld.
Hyperästhesie der Haut. Neigung zu Blutungen und Ulzerationen.
Hitzewallungen, saure klebrige Schweiße.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte und Nässe sowie morgens.
Besserung
durch Wärme.
Indikationen
Bronchitis, Asthma bronchiale; Atemnot und erschwerte Atmung, lockerer Auswurf.
Gastritis, auch bei Alkoholabusus, Alkoholismus; morgendliches Erbrechen, Sodbrennen, Magenkatarrh.
Hämorrhoiden, juckend und blutend; tonfarbene, durchfällige Stühle.
Klimakterische Beschwerden; Hitzewallungen, Schweiße.
Arthritis, Arthrose; Schmerzen in den Gelenken, auch entzündlich bedingt, Abnahme der Muskelkraft, Gefühl von Gliederzittern.
Exanthem; trocken und juckend mit Neigung zu Eiterung.
Hinweis
Saller empfiehlt beim rheumatischen Formenkreis D12, D10, D8 s.c. alle zwei Tage.
Differenzialtherapie
Capsicum, Kalium bichromicum, Lachesis, Nux vomica, Magnesium carbonicum, Robinia, Sanguinaria, Sulfur.
Antidote
Acidum aceticum, Ipecacuanha, Pulsatilla.
Aconitum napellus – Acon
Aconitum napellus (Sturmhut, Eisenhut); Ranunculaceae
Gebirgsgegenden Europas, Nordamerikas und Asiens
Aconitin, Aconitinsäure (Alkaloide); frische, zu Beginn der Blütezeit gesammelte oberirdische Pflanze und Wurzelknollen nach Vorschrift 2a und 7.
D6, D8, D12.
Bezug
Organotrop zum ZNS, zu entzündlich-fieberhaften Prozessen.
Kräftiger, vollblütiger Patient.
Auslöser
Trocken-kalter Wind, Hitze, psychische Ereignisse.
Leitsymptomatik
Plötzliche, heftig einsetzende Symptomatik, Unruhe, Angstzustände. Gelegentlich Hochgefühl in der Fieberhitze.
Harter Puls, aktive Kongestion, Röte und Blässe abwechselnd, hochrotes Gesicht, kaltschweißig (Stirn, Wangen); unerträglicher Schmerz.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Sinneseindrücke (oder Reizung der Sinnesorgane), Schreck, Angst, Kälte jeglicher Form, Berührung.
Besserung
nach Absonderung von Körpersekreten.
Indikationen
Perakute, fieberhafte Prozesse mit Schüttelfrost und Schweißen (auch ohne Organmanifestation); entzündliches Geschehen besonders an den Schleimhäuten.
Funktionelle und organische Herzleiden (Z.n. Endoperikarditis, Arrhythmie), hypotone Regulationsstörung; oft mit nächtlichen Angstzuständen, rasender Puls, Herzsensationen, Neigung zu Ohnmacht.
Vasopathien der Koronarien (Spasmen, Sklerose).
Abortus imminens, sekundäre Amenorrhöe, Lochialstauung als Folge von Schreck.
Neuralgien (Trigeminus, Ischiadicus); ziehende, schießende Schmerzen mit Parästhesien, auch Folge von Erkältung.
Differenzialtherapie
Belladonna, Bryonia, Dulcamara, Gelsemium, Kalmia, Rhus toxicodendron, Spigelia, Veratrum album.
Antidote
Belladonna, Berberis, Cactus, Camphora, Chamomilla, Coffea, Nux vomica, Pareira, Sulfur, Veratrum album.
Feindliche Beziehungen
Acidum aceticum.
Actaea spicata – Act-sp
Actaea spicata (Christophskraut); Ranunculaceae
Europa
Hauptwirkstoff; frischer Wurzelstock mit anhängenden Wurzeln vor der Blüte nach Vorschrift 2a.
Oral ab D3; parenteral ab D6.
Bezug
Histiotrop zum Stütz-/Bewegungsapparat.
Auslöser
Unterdrückung von Absonderungen (Schweiß), Schreck.
Leitsymptomatik
Pulsierende Schmerzen; plötzliche Müdigkeit nach Essen, langem Reden oder beim Gehen in frischer Luft; Hunger mit Abneigung gegen Speisen, Übelkeit und saurem Erbrechen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte, Wetterwechsel, Anstrengung, Bewegung, Berührung, Druck.
Besserung
durch frische Luft.
Indikationen
Rheumatoide Arthritis; Gicht; reißende, vibrierende Schmerzen der kleinen Gelenke, Handgelenke.
Rheumatisch-neuralgischer Symptomenkomplex; halbseitiger reißender Schmerz von Zähnen des Oberkiefers durch das Jochbein bis zur Schläfe; Zahnherde.
Stenokardie; Tachykardie nachts, Beklemmung, Atemnot bei kalter Luft.
Amenorrhöe; Unterdrückung der Menses durch Kälte, Furcht, Schreck.
Differenzialtherapie
Apis, Cimicifuga, Caulophyllum, Ledum, Paloondo, Rhus toxicodendron.
Adlumia fungosa – Adlu
Adlumia fungosa (Erdrauch); Papaveraceae
Nordamerika
Adlumin, Adlumidin (Alkaloide); frische oberirdische Teile blühender Pflanzen nach Vorschrift 3a und 7.
D3, D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zur Leber.
Leitsymptomatik
Schmerzen in der Lebergegend, weißlich belegte Zunge, Meteorismus mit Druckgefühl nach oben, imperativer Stuhldrang.
Indikationen
Hepatopathie (Erhöhung von Transaminasen, Bilirubin).
Hyperurikämie, Gicht; stechende Gelenkschmerzen, speziell der Fingergelenke.
Differenzialtherapie
Carduus, Chelidonium, Flor de piedra, Lycopodium, Mandragora e radice, Natrium sulfuricum, Sulfur.
Adonis vernalis – Adon
Adonis vernalis (Frühlings-Adonisröschen); Ranunculaceae
Südliches Europa
Adonitoxin, Strophanthidin (Alkaloide); zur Blütezeit gesammelte frische Pflanze ohne Wurzeln nach Vorschrift 2a.
D3, D4, D6.
Bezug
Funktiotrop zum Herz-Kreislauf-System.
Auslöser
Infektionskrankheit.
Leitsymptomatik
Hinterkopfschmerz, über die Schläfen zu den Augen ausstrahlend, Zunge schmutzig-gelb, wund, Ödeme.
Indikationen
Funktionelle und organische Herzleiden; nervöse Herzbeschwerden, auch infolge von Hyperthyreose. Beginnende Herzdekompensation, auch infolge von fieberhaften Erkrankungen (fokaltoxisch). Arrhythmischer und tachykarder oder langsamer, schwacher Puls.
Differenzialtherapie
Crataegus, Kalmia, Lachesis, Spigelia.
Aesculus hippocastanum – Aesc
Aesculus hippocastanum (Rosskastanie); Hippocastanaceae
Europa, Nordamerika
Aescin, Aesculin; frische geschälte Samen nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zum Verdauungstrakt, venösen Gefäßsystem sowie zum Stütz-und Bewegungsapparat.
Auslöser
Infektionen, Klimakterium.
Leitsymptomatik
Trockene Schleimhautkatarrhe mit brennenden Schmerzen, auch im Nasen-Rachen-Raum.
Venöse Stauungen mit Bildung von Varizen und Hämorrhoiden; Beckenplethora.
Schmerzen im LWS-Bereich und in den Iliosakralgelenken.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Bewegung und Wärme, Stuhlgang, nach Essen.
Indikationen
(Chron.) Rhinitis, Pharyngo-Laryngitis; scharfes wässriges Sekret oder Trockenheit und Schwellung der Schleimhäute mit Brennen und Kratzen.
Hämorrhoiden bei Obstipation; Meteorismus, kolikartige Leibschmerzen, Fremdkörpergefühl im Enddarm, schneidende Schmerzen am After mit dunkelroten Hämorrhoidalknoten.
Varikosis, postthrombotisches Syndrom, Ulcus cruris; geschwollene und schmerzhafte Beine, verstärkte Venenzeichnung, Thromboseneigung, Stauungsdermatose.
Koxalgie, LWS-Syndrom, Brachialgia paraesthetica nocturna; ständige Rückenschmerzen, arthralgisch-neuralgische Schmerzen von wanderndem Charakter.
Differenzialtherapie
Acidum hydrofluoricum, Calcium fluoratum, Collinsonia, Hamamelis, Lachesis, Pulsatilla, Sabdariffa, Sulfur.
Antidote
Sulfur.
Feindliche Beziehungen
Nux vomica.
Aethusa – Aeth
Aethusa cynapium (Hundspetersilie); Apiaceae
Europa
Aethusin (Alkaloid); ganze frische blühende Pflanze mit unreifen Früchten nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Funktiotrop zum Magen-Darm-Kanal und ZNS.
Auslöser
Zahnung, Milchunverträglichkeit.
Leitsymptomatik
Erbrechen mit Schweiß und Schwäche, beim Anblick von Nahrung oder etwa 1 Stunde nach Essen; sofort wieder hungrig nach Erbrechen.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Wärme, im Sommer.
Besserung
im Freien, in Gesellschaft.
Indikationen
Pylorospasmus der Säuglinge.
Milchunverträglichkeit der Kleinkinder (Nutritionsallergie).
Gastroenteritis der Kinder; Brechdurchfall, auch mit delirantem oder soporösem Zustand.
Differenzialtherapie
Calcium carbonicum, Galphimia glauca, Magnesium carbonicum.
Antidote
Camphora, Opium, Plumbum.
Feindliche Beziehungen
Antimonium crudum, Cicuta.
Agaricus – Agar
Agaricus muscarius, Amanita muscaria (Fliegenpilz); Amanitaceae Europa, Nordamerika, Südafrika
Cholin, Azetylcholin, Muscarin, Muscaridin; frischer oberirdischer Fruchtkörper nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Funktiotrop zum ZNS.
Auslöser
Überanstrengung.
Leitsymptomatik
Hastiges, fahriges, ruheloses Wesen; unkoordinierte Bewegungen, Zuckungen der Glieder, Grimassieren; Kraftlosigkeit, lähmungsartige Schwäche.
Kognitive Entwicklungsstörungen, Kinder sind ungeschickt und plump; geistige und körperliche Retardierung.
Lidspasmus, Tremor, Muskelkontraktionen.
Gefühl von Eisnadeln an der objektiv warmen Haut, Parästhesien.
Modalitäten
Verschlimmerung
nachts und morgens, nach dem Essen, durch Reizmittel, durch Kälte, durch Sonne, vor Gewittern; schlimmer durch psychische Ereignisse.
Besserung
durch Bewegung, im Freien.
Indikationen
Zentralnervöse Symptomatik, hypokinetisch-hypertones und hyperkinetisch-hypotones Syndrom, Kleinhirn-Affektionen.
Angiospasmen (peripher, koronar); Brennen und Jucken, Herzsensationen (gastrokardialer Symptomenkomplex).
Miktionsbeschwerden, auch infolge ZNS-Erkrankung.
Klimakterische Beschwerden; Hitzewallungen, Hyperhidrosis.
Dermatosen; juckende, trophische Hautstörungen (z.B. Acne rosacea), trockene Ekzeme, Perniones, venöse Stase.
Differenzialtherapie
Abrotanum, Aranea, Belladonna, Hyoscyamus, Nux vomica, Secale, Stramonium, Sulfur, Zincum.
Antidote
Acidum nitricum, Calcium carbonicum, Camphora, Coffea, Pulsatilla, Rhus toxicodendron.
Feindliche Beziehungen
Belladonna.
Agnus castus – Agn
Vitex agnus castus (Mönchspfeffer, Keuschlamm); Verbenaceae Südliches Europa
Agnusid, Aucubin; reife getrocknete Früchte nach Vorschrift 4a und 7.
D3, D4, D6, D12.
Bezug
Organotrop zu den Geschlechtsorganen.
Agnus castus besitzt eine Corpus-luteum-ähnliche Wirkung.
Auslöser
Infektionen.
Leitsymptomatik
Kälte und Erschlaffung der Geschlechtsorgane, Erweiterung der Pupillen, Schwellung/Schmerz der Milz.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch Kälte, Nässe, Reizmittel.
Besserung
durch Einhüllen.
Indikationen
Depressive Verstimmung; auch in Zusammenhang mit Impotenz, ovariellen Zyklusstörungen, prämenstruellem Syndrom.
Differenzialtherapie
Aristolochia, Conium, Pulsatilla, Selen.
Antidote
Camphora, Natrium chloratum, Nux vomica, Rhus toxicodendron.
Ailanthus – Ail
Ailanthus glandulosa (Götterbaum); Simarubaceae
Südostasien, China, Japan
Alkaloide, Saponin, Gerbstoffe; frische blühende Triebe und frische Stamm- und Astrinde nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zu septischen Prozessen.
Auslöser
Infektionskrankheit.
Leitsymptomatik
Kongestive Kopfschmerzen, stuporöser Zustand, Neigung zu Kollaps, fieberhafter Verlauf mit Schwächezustand, livide oder purpurne, fleckige Haut.
Indikationen
Fieberhafte Infektionskrankheiten (auch subakute und chronische Prozesse); rotes heißes Gesicht, katarrhalische Symptome, Lymphdrüsen schmerzend und geschwollen, Exanthem.
Differenzialtherapie
Baptisia, Echinacea, Lachesis, Pyrogenium, Veratrum viride.
Antidote
Aloe, Nux vomica, Rhus toxicodendron.
Aletris farinosa – Alet
Aletris farinosa (Sternwurzel); Melanthiaceae
Nordamerika
Bitterstoffe, Harze; frische unterirdische Teile der Pflanze nach Vorschrift 3a und 7.
D4, D6, D8, D12.
Bezug
Organotrop zu den weiblichen Geschlechtsorganen.
Auslöser
Infektionskrankheiten, Säfteverlust.
Leitsymptomatik
Erschöpfungszustand; Neigung zu atonischer Obstipation und Kopfschmerz.
Indikationen
Schwächezustand post partum.
Uterusprolaps, Subinvolution und Bindegewebsschwäche post partum.
Hypermenorrhöe, Dysmenorrhöe; vorzeitige und starke Menses mit klumpigem, dunklem Blut, kolikartige Schmerzen.
Fluor albus; strähnig-weiß.
Abortus imminens; Schmierblutung und Kreuzschmerzen.
Emesis gravidarum; geringste Nahrungsaufnahme verschlimmert.
Differenzialtherapie
China, Helonias, Kalium carbonicum, Pulsatilla, Sepia.
Alfalfa – Alf
Alfalfa (Medicago sativa); Fabaceae
Saponine, frisches blühendes Kraut nach Vorschrift 2a und 7.
D3, D4, D6, D12.
Bezug
Organotrop zu weiblichem Hormonsystem, Kindheit, Wachstum, Magen-Darm-Kanal, ableitenden Harnwegen.
Auslöser
Überanstrengung, Infektionskrankheiten.
Leitsymptomatik
Gesteigerter Durst bei fehlendem Appetit oder Heißhunger bis zur Bulimie, hungrig vormittags, gern Süßes, Blähungsschmerz entlang Kolonverlauf Stunden nach Essen, gelbe, schmerzhafte Stühle, Polyurie; mangelhafte Milchbildung.
Modalitäten
Verschlimmerung
abends.
Indikationen
Verzögerte Rekonvaleszenz, Untergewicht, Milchmangel.
Differenzialtherapie
Abrotanum, China, Phytolacca.
Allium cepa – All-c
Allium cepa (Küchenzwiebel); Alliaceae
Europa, Asien
Ätherisches Öl, Flavonglykoside; frische Zwiebelknolle nach Vorschrift 2a und 7.
D4, D6, D12.
Bezug
Histiotrop zu den Atemwegen.
Auslöser
Erkältung.
Leitsymptomatik
Katarrhalische Erscheinungen der oberen und unteren Atemwege; reichlich, scharfe Absonderung bei mildem Tränenfluss, bellender Kitzelhusten.
Modalitäten
Verschlimmerung
in Wärme.
Besserung
im Freien und in der Kälte.
Indikationen
Rhinitis, Sinusitis, Pharyngitis, Laryngitis, Bronchitis; Ohrenschmerzen.
Bei Phantomschmerzen und Neuralgien wird Allium cepa immer wieder in der Literatur als bewährt erwähnt, wenn der Schmerz als fadenförmig entlang des Nerven beschrieben wird.
Differenzialtherapie
Chamomilla, Euphrasia, Ferrum phosphoricum, Hedera helix, Pulsatilla.
Antidote
Arnica, Arsenicum album, Chamomilla, Nux vomica, Phosphorus, Thuja, Veratrum album.
Feindliche Beziehungen
Allium sativum, Aloe, Scilla.
Allium sativum – All-s
Allium sativum (Knoblauch); Alliaceae
Europa, Asien, Nordafrika
Allicin, Parteine; frische Zwiebeln nach Vorschrift 3a und 7.
D2, D3, D4, D6, D12.
Bezug
Organotrop zu weiblichem Genitale, Atemwegen, Magen-Darm-Kanal, Stütz-/Bewegungsapparat.
Auslöser
Genussmittelabusus, Mykose, feucht-kaltes Wetter.
Leitsymptomatik
Großer Appetit auf Fleisch mit Neigung zur Korpulenz, fehlender Durst, blasse, glatte Zunge, Blähungskoliken (Colon descendens), Schleimrasseln in den Bronchien, zäher, stinkender, schleimiger Auswurf, Psoasschmerz, herpetiforme Ausschläge und Pruritus an Vulva und Vagina.
Modalitäten
Verschlimmerung
durch feuchte Kälte, Menses (Pruritus), Diät.
Indikationen
Chronische Bronchitis.
Lumbalgie, Lumboischialgie, Koxalgie.
Pruritus vulvae, vaginae; Fluor vaginalis.
Differenzialtherapie
Antimonium crudum, Lilium trigrinum, Rhus toxicodendron, Sulfur.
Antidote
Lycopodium.
Feindliche Beziehungen
Allium cepa, Aloe, Scilla.
Aloe – Aloe
Aloe, insbesondere Aloe ferox; Asphodelaceae
Mittelmeerländer, Afrika, Indien
Aloin, Emodin, Harze; zur Trockne eingedickter Saft der Blätter nach Vorschrift 4a und 6.