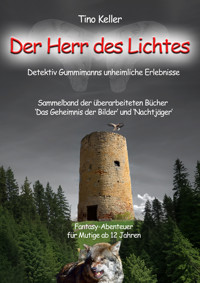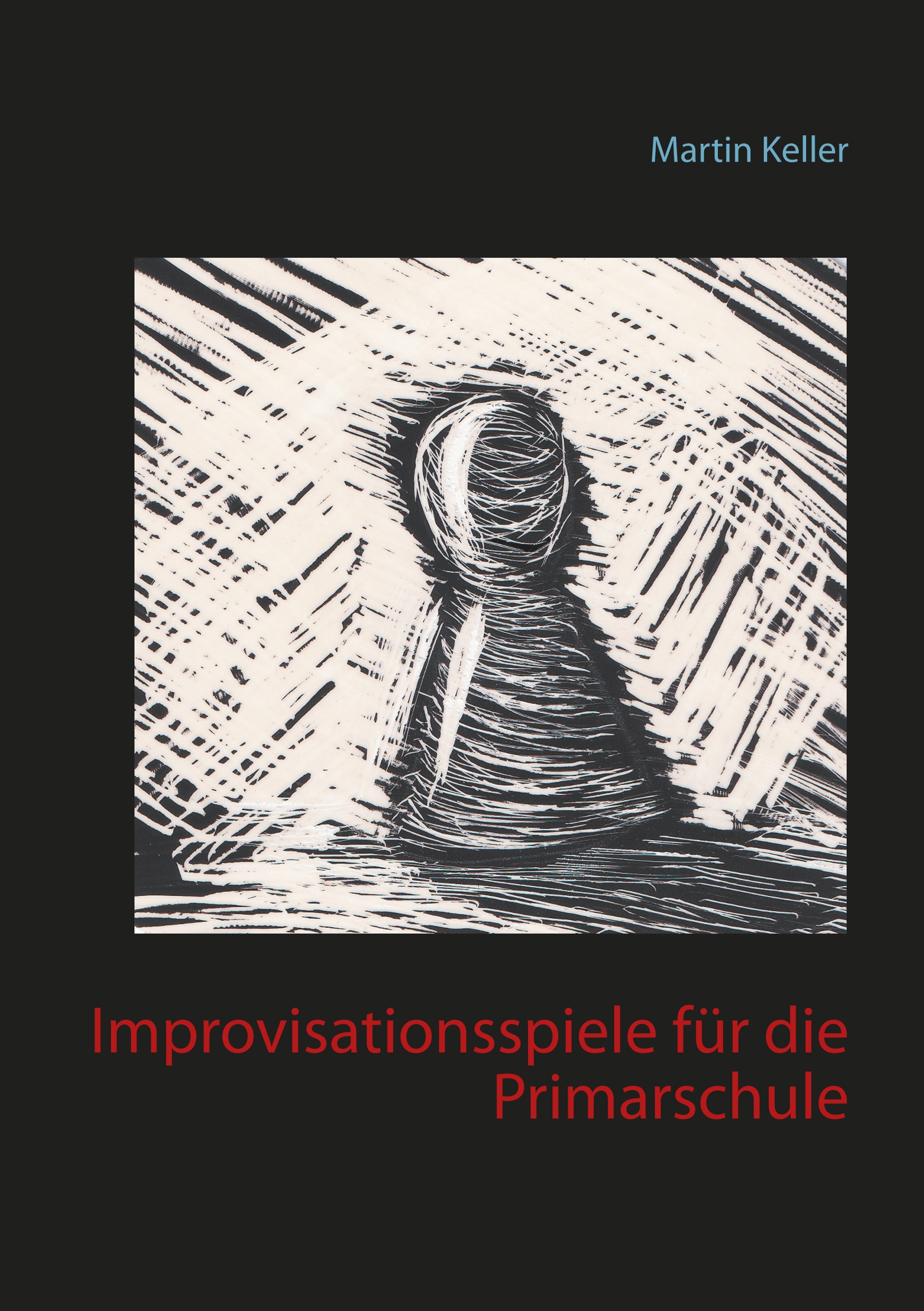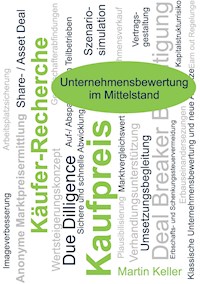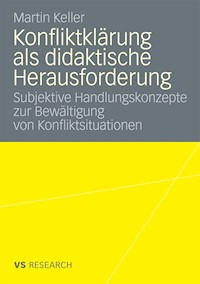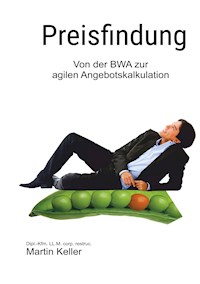
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die richtige Preisfindung für ein Produkt oder eine Dienstleistung kann für kleinere Unternehmen, Selbständige und Gründer existenziell sein. Der Preisfindungsprozess ist sehr komplex, weil er einerseits das Verständnis von Zahlen-Daten-Fakten für die Kalkulation voraussetzt und andererseits im Endkundenbereich hohes Verhandlungsgeschick erfordert. Im vorliegenden Band werden die Kalkulationsgrundlagen so kurz und knapp und so praxisbezogen wie möglich dargestellt. Das Buch enthält fast zu jedem Aspekt ein Rechenbeispiel und beschreibt die Kalkulation anhand eines durchgängigen Beispiels für einen Webdesigner von A-Z.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 46
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Methodische Grundlagen
1.1 Die betriebswirtschaftliche Auswertung
1.2 Kostenrechnungsgrundlagen
1.2.1 Kostenarten
1.2.1.1 Materialkosten
1.2.1.2 Personalkosten
1.2.1.3 Abschreibungen
1.2.1.4 Sachkosten
1.2.1.5 Kalkulatorische Zinsen
1.2.1.6 Kalkulatorische Wagnisse
1.2.1.7 Fixe und variable Kosten
1.2.1.7.1 Verfahren der Kostenspaltung:
1.2.1.7.2 Ermittlung eines Kostendeckungspunktes
1.2.2 Kostenstellenrechnung
1.2.3 Kostenträgerstückrechnung
1.2.3.1 Arten und Verfahren der Kalkulation
1.2.3.1.1 Divisionskalkulation
1.2.3.1.2 Äquivalenzziffernrechnung
1.2.4 Kostenträgerzeitrechnung
1.2.5 Fixkostendeckungsrechnung
1.2.6 Fixkosten und Verfahrenswahl:
1.2.7 Make or Buy
Durchgängiges Rechen-Beispiel
Fortgeschrittene Kalkulationsansätze
3.1 Plankostenrechnung
3.2 Starre Plankostenrechnung
3.3 Flexible Plankostenrechnung
3.4 Kalkulationsmethodik:
3.5 Prozesskostenrechnung
3.5.1 Gründe für die Entwicklung
3.5.2 Planung der Prozesskosten
3.5.3 Prozesskostensatz
3.5.4 Kalkulation der Prozesskosten
3.5.4.1 Degressionseffekt:
3.5.4.2 Produktkomplexität
3.5.4.3 Variantenvielfalt
3.5.5 Würdigung Prozesskostenrechnung
3.6 Target Costing
3.6.1 Idee der Zielkostenrechnung
3.6.2 Beispiel Bekleidungsindustrie:
3.6.3 Würdigung der Zielkostenrechnung
Weiterführende Literatur
Vorwort
Dieses Buch soll kurz und prägnant auf die „big points“ des Themas Preisfindung für mittelständische Unternehmen, Selbständige und Kleinbetriebe eingehen. Hier wird kein wissenschaftlicher Anspruch erhoben, sondern der Kern des Kerns der jeweiligen Methode beschrieben und an Beispielen vertieft.
Sicher ließen sich Quellenangaben zu verschiedenen Ansätzen angeben, da die Methodik so grundlegend ist, fände sich sicher eine Vielzahl möglicher und unterschiedlicher Quellangaben für jede Methode.
Dieses Buch soll von der Praxis für die Praxis geschrieben und verwendbar sein, daher wurde i.w. auf Quellenangaben verzichtet und eine stark selektive Zusammenfassung meiner Vorträge erstellt.
Martin Keller
Preisfindung – Kalkulation
Die Kalkulation eines Produktes oder einer Dienstleistung ist kostenrechnerisch gesehen, der finale Höhepunkt Ihrer Arbeit.
Aus vielen Vorträgen und Seminaren ist mir bewusst, dass die Erbsenzählerei, die mit Buchhaltung und Kostenrechnung verbunden ist, nicht besonders beliebt ist und gerade im Vertrieb häufig eine Preisuntergrenze besonders interessant ist. Allerdings stellt sich dann in vielen Fällen heraus, dass methodische Grundlagen einfach nicht vorhanden sind. Kein Problem! - Niemand möchte Sie zurück auf die Schulbank zerren, aber bitte gestatten Sie mir aus der Perspektive eines kleineren Unternehmens einen (vergleichsweise) kurzen Abriss kostenrechnerischer Zusammenhänge.
1. Methodische Grundlagen
1.1 Die betriebswirtschaftliche Auswertung
Ihr Steuerberater bucht Ihre Erträge und Ihre Aufwendungen und stellt sie in einer Ergebnisrechnung dar; diese wird als Betriebswirtschaftliche Auswertung – kurz BWA – bezeichnet. Gegebenenfalls gibt es auch einen Ergebnisbericht oder eine monatliche Gewinn- und Verlustrechnung.
Je nach Kontenrahmen (meist Sachkontenrahmen 03 oder 04) weichen Gliederung und Nummerierung der Konten voneinander ab, aber immer werden die vollen Kosten des gesamten Unternehmensdargestellt.
Die Darstellung des Steuerberaters ist meist undifferenziert und stellt – aus steuerlicher Sicht vollkommen korrekt – auf die Gesamtunternehmung ab:
Er erfasst keine Abgrenzung von Geschäftsbereichen
Er unterscheidet nicht zwischen vollen, fixen und variablen Kosten
Das reicht für die Steueroptimierung des Unternehmens, aber nicht zur Steuerung des Unternehmens. Dennoch sind die gebuchten Werte des Steuerberaters manchmal die einzige Information zur Kostensituation im Unternehmen.
Der Unternehmer kann seinen Steuerberater ansprechen, die BWA differenzierter zu erstellen. Außerdem müssen Abschreibungen und buchhalterische Abgrenzungen, z.B. Rechnungsabgrenzungsposten für Versicherungen, Mieten u.ä. vorgenommen werden.
Ganz wichtig ist auch die Abgrenzung von Bestandsveränderungen. Es wird kaum jemals eine monatliche Inventur erstellt werden, aber es gibt zumindest ein durchschnittliches Verhältnis von Materialaufwendungen und Gesamtleistung. Diese Quote für die Bestandsveränderungen ist zumindest im ersten Halbjahr repräsentativer als die meistens vorgenommene Materialaufwandsbuchung beim Einkauf von Rohmaterial. Hier wird ggf. ein Aufwand dargestellt, der beim bloßen Tausch von Geld gegen Material einfach nicht vorhanden ist.
Grobe Darstellung einer Ergebnisrechnung (BWA):1
Im Optimalfall kann eine Profit- oder Cost-Center Darstellung erreicht werden, wenn sich Personal- und Sachkosten einzelnen Geschäftsbereichen zuordnen lassen.
1.2 Kostenrechnungsgrundlagen
Die drei Elemente der Kostenrechnung sind Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung – die Kostenträgerstückrechnung bezeichnet man auch als Kalkulation.
Schema zur Strukturierung von Aufwendungen in der Kostenrechnung:
Gerade aus unternehmensinterner Sicht, sollten die unterschiedlichen Zielsetzungen für die Verarbeitung des Zahlenwerkes stets berücksichtigt werden.
So ist es klar, dass in einer Angebotskalkulation alle Kosten mindestens gedeckt werden sollen. (Vollkostenansatz), wohingegen man als Unternehmer in Zeiten der Unterauslastung schon froh ist, zumindest einen Teil der fixen Kosten zu decken, damit die Verluste nicht noch höher ausfallen.
Auch die Genauigkeit der Kostenerfassung ist von den Zielen abhängig – ein Kollege sagte mir mal: „Per Saldo muss es stimmen“ – bei der Entscheidung über den Zukauf oder die Eigenfertigung von Teilleistungen bzw. Komponenten reicht das nicht mehr aus – vielmehr müssen einzelne Prozessschritte einzeln rückgemeldet und kostenmäßig erfasst werden.
1.2.1 Kostenarten
Im Prinzip hat die Kostenartenrechnung viele Gemeinsamkeiten mit der BWA. Es gibt jedoch auch Zusatzkosten und Anderskosten. So darf ein Einzelunternehmen die Vergütung des mitarbeitenden Inhabers nicht vergessen – diese werden in der BWA eines Einzelunternehmens, im Gegensatz zu einer Kapitalgesellschaft, wie beispielsweise einer GmbH, nicht aufgeführt.
Es kann auch sein, dass Maschinen wesentlich länger genutzt werden können, als dies die steuerlichen Abschreibungstabellen vorsehen – dann ist die kalkulatorische Abschreibung niedriger, als die bilanzielle Abschreibung.
In der Kostenartenrechnung kann auch zwischen Teilkosten und Vollkosten unterschieden werden. Üblicherweise sind die Teilkosten die variablen Kostenbestandteile, die sich mit einer Bezugsgröße ändern und der Rest sind dann fixe Kosten, die unabhängig von der gewählten Bezugsgröße immer gleich hoch bleiben.
Beispiel: