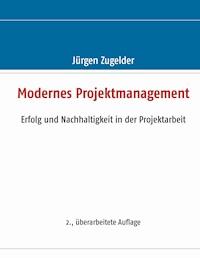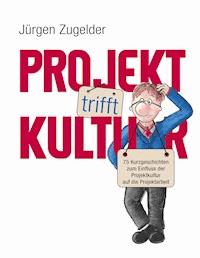
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was hat Rotwein mit Projekten zu tun? Wieso sollte Heike den Kauf ihres Rennrads zurückstellen? Und was können wir von drei kleinen Schweinchen lernen? Diesen und vielen weiteren Fragen wird in den zahlreichen Kurzgeschichten dieses Buches nachgegangen. Auf unterhaltsame Weise lenken sie den Blick auf verschiedene Aspekte der Projektkultur und regen zum Nachdenken über Sinn und Unsinn einer Kultur an, die - kaum wahrnehmbar - jedes Projekt massiv beeinflusst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Der Weg ist das Ziel
Alphabetisches Verzeichnis
Thematisches Verzeichnis
Der Schreiber und die Zeichnerin
Einleitung: Der Weg ist das Ziel
Wenn wir Projekte verbessern wollen, müssen wir uns mit der Projektkultur auseinandersetzen.
Projekte sind wie schwarze Schafe, sie gehören dazu, aber niemand will sie so wirklich haben. Wenn man einmal die Unternehmen, die ausschließlich Projekte abwickeln, ausnimmt, scheinen Projekte nur zu stören. Sie stören die Linie, die bestehenden Machtverhältnisse und die Tagesroutine. Projekte stören das Management, die Mitarbeiter und vielleicht sogar die Kunden. Projekte zwingen zu Entscheidungen, die man nicht treffen möchte und geben Geheimnisse preis, die man für sich behalten will. Man muss sich mit Dingen beschäftigen, die man nicht richtig versteht und erfährt Wahrheiten, die man nicht hören möchte.
Jeder braucht Projekte, aber scheinbar will sie keiner. Das ist vielleicht der Grund für die häufig erlebte Diskrepanz zwischen dem gesprochenen Wort und der gelebten Tat, die letztlich dazu führt, dass viele Projektergebnisse unter ihren Erwartungen bleiben.
Dass zahlreiche Projekte scheitern, und darüber lässt eine große Zahl von Untersuchungen keinen Zweifel, ist schon schlimm genug. Viel schlimmer ist jedoch, dass man sich anscheinend mit dem Scheitern abfindet. Projekte werden vielfach bearbeitet, ohne dass man sich wirklich mit ihnen beschäftigt. Also stellt sich die Frage: Warum ist das so? Und vor allem: Muss das so sein? Warum führen die Kenntnisse über die (Miss-)Erfolgsfaktoren nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen? Warum werden Projekte nicht mehrheitlich mit großem Erfolg abgeschlossen? Und warum ist Projektmanagement, egal ob traditionell oder agil, nicht längst von allen Mitarbeitern verinnerlicht?
Projektmanagement, so wie es heute verstanden wird, geht weit über die Methodenanwendung hinaus. Ein Unternehmen muss sich mit seinen Werten, die die Projektarbeit betreffen, auseinandersetzen und gezielt in die Verbesserung seiner Projektkultur investieren. Es muss eine Projektkultur schaffen, die erfolgreiche Projekte überhaupt erst ermöglicht. Projektkultur ist dabei keine Worthülse sondern konkrete Verhaltenssteuerung. Eine projektfreundliche Kultur bereitet ein Klima, das Projektarbeit unterstützt und eine gemeinsame Ausrichtung fördert. Wird Projektmanagement in diesem Sinne verstanden, werden Projekte mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgreicher abgeschlossen und bringen dem Unternehmen tatsächlich den erwarteten Nutzen.
Natürlich verfügt jedes Unternehmen über eine Projektkultur, die das kollektive Verhalten in einem bestimmten Maß auf Projektarbeit ausrichtet. Projekte sind jedoch nicht alles. Die gelebte Projektkultur eines Unternehmens ist deshalb weder gut noch schlecht, sondern eine Antwort auf die Anforderungen der Vergangenheit. Erhöhen sich allerdings die Anforderungen an Projektarbeit, muss über eine Anpassung der Projektkultur nachgedacht werden. Das Unternehmen muss das Projektumfeld dabei einbeziehen und seine Projektarbeit in diesem Sinne verbessern wollen. Erkennt es im modernen Projektmanagement keinen wirklichen Nutzen, hat es auch keine Motivation zur Anpassung seiner Projektkultur.
Das vorliegende Buch beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Projektkultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Es will dabei Mut machen, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen und diese bewusst auf den Prüfstand zu stellen. Das ist nicht einfach, denn Projektkultur ist zwar überall zugegen, aber trotzdem kaum erkennbar. Nur wenn sie bewusst wahrgenommen und – falls gewünscht – verändert wird, ist eine deutliche Verbesserung der Projektarbeit zu erwarten. Denn eines ist sicher: Projektkultur ist zu wichtig, um sie sich selbst zu überlassen.
Projektkultur ist der Schlüssel zum Projekterfolg! Egal ob mit Rotwein zum Fisch, Heikes Fahrrad oder den Drei kleinen Schweinchen, die zahlreichen Facetten der Projektkultur werden in abwechslungsreichen Kurzgeschichten beleuchtet. Sie sollen dabei alles sein: prägnant und umfassend, glaubwürdig und überspitzt, entspannend und anregend. Sie sollen den Spagat vollbringen, im gleichen Moment unterhaltsam und ernsthaft zu sein.
Natürlich spiegelt sich nicht jeder Aspekt in jedem Projekt und in jedem Unternehmen wider. Die Intention dieses Buches ist deshalb, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen, zum Nachdenken anzuregen und so ein klein wenig zu einer Verbesserung der Projektarbeit beizutragen. Dies soll mit einem Augenzwinkern geschehen, denn viele Vorgehensweisen laufen unbewusst ab und müssen zunächst ins Bewusstsein zurückgeholt werden. Dann sind die Erfolgsaussichten aber groß, das, was in der Theorie so einfach klingt, in der Praxis auch tatsächlich umzusetzen: Alle, die Projektbeteiligten und ihr Umfeld, ziehen an einem Strang. Der Weg dorthin, die permanente Verbesserung der Projektarbeit, ist das Ziel. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen zunächst viel Spaß beim Lesen.
1 So – oder anders
Projektkultur bedeutet eine einheitliche Vorstellung davon, wie Projekte initiiert, geplant, durchgeführt und abgeschlossen werden. Hierzu gehören neben Rollen, Strukturen und Prozessen insbesondere auch Verhaltensweisen.
Was versteht man eigentlich unter Projektkultur? Natürlich gibt es jede Menge Definitionen, die aber nicht wirklich weiterhelfen. Projektkultur ist nämlich ein recht schwammiger Begriff. Er ist schwer greifbar und zeigt sich eher in Symptomen und Verhaltensweisen, die die Projektarbeit behindern – oder eben auch nicht. Hier ein paar Beispiele:
Neue Projekte sind plötzlich da – oder werden zunächst objektiv geprüft und bewertet
Es wird unverzüglich mit der Projektarbeit begonnen – oder es werden zunächst Ziele, Vorgehensweisen und Ressourcen abgestimmt
Die Projektsteuerung erfolgt informell und reagierend – oder strukturiert und vorausschauend
Zuständigkeiten ergeben sich – oder sind durch Rollenmodell und Projektplan verbindlich festgelegt
Informationen über das Projekt vermitteln eine Wunschsituation – oder ein reales, der tatsächlichen Situation entsprechendes Bild
Statusberichte sind bürokratisch – oder schaffen Transparenz im Hinblick auf die Zielerreichung
Fehler werden verheimlicht – oder als Ansatzpunkt für Verbesserungen genutzt
Fehler werden wiederholt – oder gemeinsam zu vermeiden versucht
Probleme werden schöngeredet – oder frühzeitig eskaliert
Getroffene Vereinbarungen sind unverbindliche Vorschläge – oder bindende Absprachen, auf die sich alle Projektbeteiligten verlassen
Führungskräfte fordern Projektmanagement ein – oder leben es vor
Ist ein Projekt abgeschlossen, wartet schon das nächste – oder werden erst einmal Zielerreichung, Projektnutzen und Lernerfahrungen überprüft
Kollegen, die in Projekten mitarbeiten, werden aufrichtig bedauert – oder beneidet
Die Liste ließe sich fast beliebig verlängern. Projektkultur zeigt sich in allem, was wir tun müssen, tun dürfen oder eben auch nicht tun dürfen und drückt damit sehr gut den Stellenwert der Projektarbeit in einem Unternehmen aus. Wie gehen wir mit Rollen, Strukturen und Prozessen, mit Transparenz und Fehlern, aber auch mit Vertrauen, Motivation und Wertschätzung um? Jedes Unternehmen hat eine Projektkultur, die sich aus der wechselseitigen Beziehung von Unternehmen und Mitarbeitern herausbildet. Sie kann so sein – oder eben anders.
2 Kulturelle Führung
Führung lebt Projektkultur (vor) und motiviert die Mitarbeiter, es ebenso zu tun. Sie ist der wichtigste Treiber für die Ausprägung der Projektkultur.
Projektkultur, immer nur Projektkultur! Als ob es nichts anderes gäbe! Warum wird nicht mal etwas über fehlerfreie Abläufe in stabilen Linienorganisationen gesagt, über gewachsene Beziehungen in traditionellen Familienunternehmen oder über kreative Begeisterung in innovationsgetriebenen Start-ups? Ist Projektkultur der einzig sinnvolle Kulturstil im Unternehmen?
Nein, natürlich nicht. In einem Unternehmen wirken viele verschiedene Kulturstile und jeder Stil hat seine Berechtigung. Aber je stärker ein Unternehmen vom Erfolg seiner Projekte abhängig ist, desto mehr wird es sich Gedanken darüber machen müssen, wie Projekterfolg herbeigeführt werden kann. Und eine „gute“ Projektkultur fördert nun einmal die erfolgreiche Bearbeitung von Projekten.
Hat sich ein Unternehmen für die Anwendung von Projektmanagement entschieden, wird es sich früher oder später mit seiner Projektkultur befassen müssen. Eine gute Kultur entwickelt sich nämlich nicht zufällig, sondern muss bewusst herbeigeführt werden. Allerdings handelt es sich hierbei um eine laufende Aufgabe oder, besser noch, eine permanente Herausforderung. Dies macht sie so bedeutend.
Ein Wandel hin zu einer projektfreundlichen Kultur lässt sich nicht verordnen. Menschen können nicht geändert werden, sie können sich nur selbst ändern. Führungskräften kommt in diesem Zusammenhang die Rolle des Vorbilds zu. Sie leben Projektkultur (vor) und müssen den Geist der Kultur deshalb selbstbewusst und möglichst frei von Ausnahmen leben.
Glaubwürdige und konsequente Führung bedeutet somit, die Idee der Projektkultur auch dann zu verfolgen, wenn sie gerade einmal nicht passt. Der langfristige Nutzen steht im Vordergrund. Kultur ist Führung.
Führung kann andere Mitarbeiter in ihrem Verhalten bestärken und zur Veränderung ermutigen. Sie gibt Mitarbeitern die Orientierung, die sie erwarten. Und sie vermittelt gemeinsame Werte, die sich in ihrem Reden und Handeln widerspiegeln muss. Führung führt auf Dauer zu einer Selbstregulierung und ist deshalb der wichtigste Treiber für die Ausprägung der Projektkultur.
3 Das Traumhaus
Werden Projekte nacheinander bearbeitet, werden sie schneller und besser abgeschlossen als wenn sie parallel bearbeitet werden.
Endlich haben wir unser Traumhaus gefunden. Ein tolles Haus mit viel Platz und schönem Grundstück. Das Haus ist allerdings schon 40 Jahre alt, sodass natürlich einiges renoviert werden muss. Aber zum Glück können wir vieles selber machen. Wir können es kaum erwarten, endlich einzuziehen. Also nur noch schnell renovieren.
In allen Zimmern reißen wir die Tapete herunter, auch die alten Böden fliegen raus. Es werden neue Stromleitungen und zusätzliche Steckdosen benötigt. Jetzt, da die Kellerräume leergeräumt sind, nutzen wir auch die Gelegenheit, um die Wände zu streichen. Der Garten ist stark verwildert, so dass wir Sträucher zurückschneiden und Unkraut zupfen müssen. Die Einbauküche ist wirklich nicht mehr schön und kommt sofort raus. Und das Bad hat ja noch rosa Fliesen, die werden natürlich ebenfalls abgeschlagen.
Die Wochen vergehen und irgendwie haben wir noch gar nicht viel geschafft. Gut, wir haben ja auch noch unseren Beruf. Aber dass die Renovierung so langsam vorangeht, hätten wir nicht gedacht. Eigentlich haben wir noch gar nichts renoviert, sondern nur die alten Sachen rausgerissen. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir weitermachen sollen. Es ist so viel zu tun, aber es geht überhaupt nicht voran. Und wir haben doch schon unsere alte Wohnung gekündigt. Oh nein, wir können doch nicht in eine Baustelle ziehen. Es ist noch kein einziges Zimmer fertig, geschweige denn das Bad oder die Küche. Dabei sind wir doch jeden Abend und jedes Wochenende auf der Baustelle. Wir drehen hier noch durch …
Jeder kennt es, jeder macht es: Multitasking, also die gleichzeitige Erledigung verschiedener Aufgaben. Und wir haben alle ein gutes Gefühl dabei, glauben wir doch Zeit zu sparen.
Das Gegenteil ist aber der Fall: Je weniger Arbeit parallel durchgeführt wird, desto schneller und konzentrierter wird sie erledigt. Oder andersherum: Je mehr Dinge gleichzeitig gemacht werden, desto länger braucht jede einzelne Aufgabe. Dabei geht es nicht nur um die reine Arbeitszeit, sondern auch um Zeiten, um wieder in das Thema hineinzufinden, die geistige Rüstzeit. Zusätzlich leidet die Qualität.
Eine klare Priorisierung sowie die Einhaltung dieser Prioritäten führen dazu, die Aufgaben in Summe zügiger und in besserer Qualität als bei Durchführung mit Multitasking zu erledigen. Dies gilt sowohl für die Durchführung von Projekten als für die Bearbeitung einzelner Arbeitspakete.
Das Traumhaus-Beispiel stammt aus unserem Bekanntenkreis. Überall wurden alle Arbeiten gleichzeitig begonnen, auch in der Garage und im Garten. Der Einzug unserer Bekannten mit ihren beiden Kindern erfolgte schließlich in ein halbfertiges Haus ohne Tapeten und ohne Bodenbeläge. Eine Küche gab es nicht, ein Bad war immerhin eingeschränkt nutzbar. Nach vielen mühsamen Monaten der Renovierung meinte der Hausbeisitzer: Wir haben wirklich geglaubt, wenn wir alles parallel machen, geht es schneller. Hätten wir ein Zimmer nach dem anderen renoviert, hätten wir die Hälfte an Zeit, Kosten und Nerven gespart.
4 Ohne Navi ans Meer
Die Bearbeitung von Projekten erfordert ein zeitgemäßes Vorgehen. Auch Vorgehensweisen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden.
Ich bin viel im Auto unterwegs, sowohl beruflich als auch privat. Und ich komme immer an, egal wohin ich fahre. Egal ob in die Innenstadt, in die Berge oder ans Meer. Ich finde jeden Ort, und zwar ohne Navigationsgerät. Ich brauche kein Navi, schließlich habe ich eine aktuelle Straßenkarte und kann Straßenschilder lesen. So bin ich immer gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes.
Natürlich weiß ich, dass viele Leute heutzutage ein Navi benutzen, aber ich halte das für unnötig. Ich glaube außerdem, dass es vom Verkehr ablenkt. Der Bildschirm ist so klein, dass man nur bei längerem Hinsehen etwas erkennen kann und in dieser Zeit kann ich nicht auf den Verkehr achten. Außerdem lässt mich die Stimme immer erschrecken, gerade, wenn ich alleine im Auto bin. Das ist gefährlich. Ich brauche kein Navi und, wie gesagt, ich finde mein Ziel ja auch so. Und wenn ich mich doch einmal verfahre, naja, dann drehe ich halt um. Ich plane sowieso immer ausreichend Zeit ein. Klingt logisch – oder etwa nicht?
Eine lustige Geschichte, die einen vielleicht schmunzeln lässt, die sich dennoch tagtäglich auf ähnliche Weise in vielen Unternehmen wiederholt: Das Festhalten an Vorgehensweisen, die zu einem „das haben wir schon immer so gemacht“ führen. Aber jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, denen mit eigenen Vorgehensweisen begegnet werden muss. Vorgehensweisen, die früher durchaus erfolgreich waren, greifen bei geänderten Rahmenbedingungen in vielen Fällen nicht mehr. Ändern sich die Zeiten, müssen deshalb auch die Vorgehensweisen überprüft und angepasst werden, um weiterhin erfolgreich zu sein.
Natürlich würde ich das Meer auch heute noch ohne Navigationsgerät finden. Aber finde ich meinen Zielort mit Navigationsgerät nicht besser? Vermutlich. Ich werde auf der schnellsten Strecke zum Ziel geleitet, umfahre Staus, verliere dadurch keine Zeit, verbrauche weniger Benzin und der Stimmung im Auto tut es vermutlich auch gut. Dagegen kommt auch besseres Kartenmaterial nicht an.
Gleiches gilt für die Bearbeitung von Projekten. Diese werden häufig noch bearbeitet wir vor 25 Jahren, als Projekte in Unternehmen eine Ausnahme darstellten und aus der Linienorganisation heraus erledigt werden konnten. Inzwischen sind Menge und Komplexität der Projekte allerdings stark gestiegen. Trotzdem werden viele Projekte immer noch „wie immer“ bearbeitet. Aber ein „mehr“ desselben Vorgehens, also mehr Planungen und mehr Methoden, helfen nicht. Neue Zeiten erfordern neue Vorgehensweisen. Eine erfolgreiche Projektbearbeitung erfordert heute den Einsatz eines modernen Projektmanagements mit einer verhaltenssteuernden Projektkultur.
Aber warum ist ein „das haben wir schon immer so gemacht“ so weit verbreitet? Weil man sieht, was man sehen will. Ich bin mit meiner Straßenkarte zufrieden und will nichts anderes. Wenn man mich zwingt, künftig mit Navi zu fahren, mache ich das natürlich, werde aber das Gerät und das Ergebnis sehr genau beobachten. Und wenn ich nur genau genug beobachte, werde ich auch etwas finden, was meine Meinung über Navigationsgeräte stützt: Der Bildschirm ist zu klein, die Stimme zu künstlich und das hinterlegte Kartenmaterial nicht aktuell genug. Das gleiche gilt für Projektmanagement. Wenn ich genau genug hinschauen, finde ich Gründe, alles so zu belassen wie es ist. Es geht ja auch ohne Projektmanagement. Man sieht, was man sehen will.
Genauso kann man aber auch die großen Potenziale sehen, die Navigationsgeräte – genauso wie modernes Projektmanagement – bieten. Lässt man sich auf das Experiment ein, erkennt man schnell die Vorteile. Autofahren heute erfordert den Einsatz moderner Navigationsgeräte. Und Projektarbeit heute erfordert den Einsatz eines modernen Projektmanagements. Vielleicht nicht in jedem einzelnen Fall, aber in aller Regel. Falls Sie es noch nicht kennen, probieren Sie es aus und nehmen Sie das Navi, wenn Sie das nächste Mal ans Meer fahren.
5 Hätte ich doch
Wird das Projektziel nicht gemeinsam formuliert und akzeptiert, geht jeder den aus seiner Sicht richtigen Weg.
Der Auftraggeber weiß genau, was er will. Er hat das Ergebnis vor Augen. Nicht jedes Detail, aber das für ihn Wesentliche. Er sieht den Sportwagen, aber weder die genaue Form der Heckleuchten noch die exakte Anordnung der Instrumente. Der Sportwagen ist sein Ziel und das genügt ihm. Dieses Bild kommuniziert er dem Projektleiter, als der ihn nach den Projektzielen befragt.
Auf Nachfrage konkretisiert der Auftraggeber: Der Wagen soll hochwertig, elegant und mit einer wahnsinnigen Beschleunigung ausgestattet sein. Das beste ferngesteuerte Auto halt, das es auf dem Markt gibt. Nicht nur ein Spielzeug für Erwachsene, sondern ein Hobby, ein neues Lebensgefühl. Die Entwicklungskosten dürfen dabei die durchschnittlichen Kosten der zuletzt entwickelten ferngesteuerten Autos nicht übersteigen. Und die Mannschaft soll aufgrund der anderen Projekte möglichst wenig belastet werden.
Sind die Projektziele nun klar und kann der Projektleiter mit diesen Zielen arbeiten? Falls nein, wo muss konkretisiert werden? Was genau wird unter einer „wahnsinnigen Beschleunigung“ verstanden? Und was konkret bedeutet es, die Mannschaft möglichst wenig zu belasten? Welche exakten Kosten dürfen höchstens anfallen und was genau soll eigentlich unter dem „neuen Lebensgefühl“ verstanden werden?
Solange nicht wirklich klar ist, was gewollt ist, wer was macht und wie es bezahlt werden soll, führt ein Beginn der Arbeiten nur zu Verschwendung. Dies gilt übrigens bereits für die ersten Schritte, die den Beteiligten häufig noch klar sind. Wird Projektarbeit nämlich erst einmal ohne ausreichende Klärung begonnen, dann wird es auch später keine Klärung mehr geben. Stattdessen gibt es endlose Diskussionen, in denen die unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander prallen, in denen jeder mitreden darf und in denen jedes Detail ausdiskutiert wird. Die Betroffenen blockieren sich dann gegenseitig. Unsicherheit, Hektik und Ärger machen sich breit.