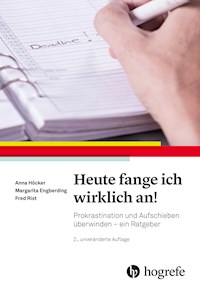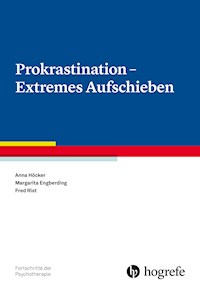
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten werden in der Praxis immer häufiger mit dem Anliegen Prokrastination, also dem chronischen exzessiven Aufschieben, oder mit milderen Formen des Aufschiebens konfrontiert, die zwar nicht "pathologisch" sind, aber dennoch als störend oder belastend empfunden werden. Das Buch liefert einen praxisorientierten Leitfaden für die Diagnostik und Behandlung von Prokrastination. Chronisch-exzessives Aufschieben ist ein Problem der Selbststeuerung. Es hat gravierende Folgen sowohl für die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit als auch für die allgemeine Lebensführung und das psychische Wohlbefinden. Prokrastination kann Ursache psychischer Symptome und Störungen sein, als Symptom im Rahmen psychischer Störungen auftreten oder selbst eine klinisch relevante Symptomatik darstellen. Der Band liefert neben einer Beschreibung der speziellen Arbeitsstörung ein kognitiv-behaviorales Erklärungsmodell und eine Anleitung für das diagnostische Vorgehen. Weiterhin werden Behandlungsmodule vorgestellt, die je nach individueller Problemlage und nach zeitlichen Rahmenbedingungen unterschiedlich kombiniert werden können. Die Module sind einzeln durchführbar oder können in eine bestehende umfassendere Behandlung oder Beratung integriert werden. Lösungen für die Bewältigung problemtypischer Schwierigkeiten in der Behandlung werden erörtert. Arbeitsmaterialien erleichtern die Umsetzung des Vorgehens in die Praxis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anna Höcker
Margarita Engberding
Fred Rist
Prokrastination – Extremes Aufschieben
Fortschritte der Psychotherapie
Band 84
Prokrastination – Extremes Aufschieben
Dr. Anna Höcker, Dipl.-Psych. Margarita Engberding, Prof. Dr. Fred Rist
Herausgeber der Reihe:
Prof. Dr. Martin Hautzinger, Prof. Dr. Tania Lincoln, Prof. Dr. Jürgen Margraf, Prof. Dr. Winfried Rief, Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffier
Begründer der Reihe:
Dietmar Schulte, Klaus Grawe, Kurt Hahlweg, Dieter Vaitl
Dr. Anna Höcker, geb. 1981. 2006−2016 Projektleitung Spezialambulanz für Arbeitsstörungen/Prokrastinationsambulanz der Universität Münster. 2009 Approbation als Psychologische Psychotherapeutin (VT). 2010 Promotion. 2010−2015 Leitende Psychologin der Hochschulambulanz der Universität Bielefeld/des Bielefelder Instituts für Psychologische Psychotherapieausbildung (BIPP), 2015−2017 Leitung der Ausbildungsambulanz des BIPP. Seit 2007 Dozentin für Psychologie an verschiedenen Universitäten und Ausbildungsinstituten, seit 2010 Supervisorin. Zertifizierter Coach und Business Coach. Seit 2017 in eigener Praxis für Coaching, Psychotherapie und Supervision in Düsseldorf tätig.
Dipl.-Psych. Margarita Engberding, geb. 1947. 1993–2012 Geschäftsführende Leiterin der Psychotherapie-Ambulanz am Fachbereich Psychologie der Universität Münster. Seit 1999 als Dozentin und Supervisorin am Institut für Psychologische Psychotherapie-Ausbildung (IPP-Münster) und anderen Ausbildungsinstituten tätig.
Prof. Dr. Fred Rist, geb. 1947. 1996–2013 Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie am Fachbereich Psychologie der Universität Münster. Seit 2013 Senior-Professor der Universität Münster.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Satz: Sabine Rosenfeldt, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3081-2; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3081-3)
ISBN 978-3-8017-3081-9
https://doi.org/10.1026/03081-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1 Beschreibung und Definition
1.1 „Normales“ Aufschieben und Prokrastination
1.2 Diagnostische Kriterien (Forschungskriterien) und Indikation
1.3 Epidemiologische Angaben und psychologische Befunde
1.3.1 Verbreitung von Prokrastination
1.3.2 Psychologische Befunde
1.3.3 Verschiedene Typen von Prokrastination?
1.4 Differenzialdiagnostik
1.4.1 Verhältnis zu anerkannten psychischen Störungen
1.4.2 Differenzialdiagnostische Abgrenzung
2 Störungstheorien und Erklärungsansätze
2.1 Kognitiv-verhaltenspsychologisches Erklärungsmodell für Prokrastination
2.2 Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen
2.3 Stellenwert und Einsatz der beiden Modelle im diagnostisch-therapeutischen Prozess
3 Diagnostik und Indikation
3.1 Diagnostischer Ablauf
3.2 Fragebögen
3.2.1 Fragebogen zu den diagnostischen (Forschungs-)Kriterien für Prokrastination (DKP-FB)
3.2.2 Allgemeiner Prokrastinationsfragebogen (APROF)
3.2.3 Weitere Fragebögen
3.3 Exploration und Problemstellung
3.4 Selbstbeobachtung
3.5 Verhaltens- und Bedingungsanalyse
3.6 Zielbestimmung und Therapieplanung, Kassenantrag und Gutachterbericht
4 Behandlung
4.1 Merkmale und Komponenten der Behandlung
4.1.1 Zielsetzung und Charakteristika der Interventionen
4.1.2 Beziehungsgestaltung
4.1.3 Therapiebausteine und Aufbau der Behandlung
4.1.4 Differenzielle Indikation: Welche Interventionen für welchen Klienten?
4.2 Erstellung eines Masterplans
4.3 Modul Kognitive Methoden
4.4 Modul Arbeitszeitrestriktion
4.5 Bedingungsmanagement
4.5.1 Selbstverstärkung
4.5.2 Arbeitsplatzwahl und Arbeitsplatzgestaltung
4.5.3 Umgang mit Störungen
4.6 Modul Realistisch Planen
4.7 Modul Pünktlich Beginnen
4.8 Rückfallprophylaxe: Fortschritte aufrechterhalten und Rückschritte vermeiden
4.9 Effektivität und Empfehlungen zur Prioritätensetzung
4.9.1 Therapiestudien aus der Literatur
4.9.2 Wirksamkeit der hier beschriebenen Interventionsmethoden und Empfehlungen zur Prioritätensetzung
4.10 Umgang mit Besonderheiten und schwierigen Therapie- oder Beratungssituationen
5 Fallbeispiel Frau S. – Ziele und angewandte Methoden
6 Weiterführende Literatur
7 Literatur
8 Kompetenzziele und Lernkontrollfragen
9 Anhang
Fragebogen zu den diagnostischen Forschungskriterien für Prokrastination (DKP-FB)
Allgemeiner Prokrastinationsfragebogen (APROF)
Auswertung DKP-FB und APROF
Merkblatt: Arbeitszeitrestriktion
Realistische Planung und Bewertung
Schritte zum pünktlichen Beginnen
Arbeitsfragen zur individuellen Prokrastinationsanalyse
Karten
Kognitiv-verhaltenspsychologisches Erklärungsmodell für Prokrastination
Rubikon-Modell der Handlungsphasen
Prokrastination: Erste Orientierung und Differenzialdiagnostik
|1|Vorwort
Chronisch-exzessives Aufschieben (= Prokrastination) ist ein verbreitetes Problem der Selbststeuerung. Es hat gravierende Folgen sowohl für die Leistungs- und Arbeitsfähigkeit als auch für die allgemeine Lebensführung und das psychische Wohlbefinden. Prokrastination kann Ursache psychischer Symptome und Störungen sein, als Symptom im Rahmen psychischer Störungen auftreten oder auch für sich eine klinisch relevante Symptomatik darstellen.
Eine Besonderheit dieses Bandes besteht darin, dass Prokrastination derzeit keine Diagnose im Sinne der gängigen Klassifikationssysteme psychischer Störungen ICD oder DSM ist. Wenn die Indikation für Psychotherapie nur auf Störungen entsprechend dieser Kriterien begrenzt wird, stellt Prokrastination allein keine Indikation für eine Psychotherapie dar. Prokrastination führt aber als Symptomatik innerhalb psychischer Störungen vielfach zu erheblichem Leiden und zu Beeinträchtigungen und stellt oft auch für sich genommen ein ernstzunehmendes Beratungsanliegen dar. Deshalb haben wir einen Vorschlag zu diagnostischen Forschungskriterien entwickelt und nach empirischer Prüfung an großen Stichproben mehrfach optimiert.
Hintergrund dieser Bemühungen ist unsere langjährige gemeinsame Arbeit an der Psychotherapie-Ambulanz der Universität Münster. Hier meldeten sich häufig Betroffene aufgrund extremer chronischer Prokrastination mit starken psychischen Beeinträchtigungen, die nicht immer die Kriterien für zusätzliche Störungsdiagnosen erfüllten. Nachdem unsere ersten wissenschaftlichen Studien erhebliche Nachfrage und großen Handlungsbedarf zeigten, eröffneten wir 2006 eine Spezialambulanz für Arbeitsstörungen und Prokrastination („Prokrastinationsambulanz“), in der wir uns seitdem der Entwicklung und Evaluation spezifischer Interventionsmodule für Therapie, Training und Coaching bzw. Beratung bei Prokrastination widmen.
Das vorliegende Buch bietet zunächst eine Beschreibung und Definition von Prokrastination, Vorschläge zur Diagnostik und eine Darstellung psychologischer Befunde und Erklärungsmodelle. Es folgt eine praxisorientierte Anleitung für den Einsatz wissenschaftlich fundierter, zeitökonomischer Interventionen gegen extremes Aufschieben. Diese wurden an der Prokrastinationsambulanz entwickelt, erprobt und systematisch evaluiert. Sie können – je nach individueller Problemlage und zeitlichen Rahmenbedingungen – unterschiedlich kombiniert werden und eignen sich auch dazu als Einzelkomponenten in bestehende, breiter angelegte Therapie- oder Beratungsprozesse integriert zu werden.
|2|Ausführlichere Beschreibungen diagnostischer und therapeutischer Vorgehensweisen, weitere Materialien und Sitzungsleitfäden für die Einzelberatung und Gruppentrainings finden Interessierte in unserem Manual „Prokrastination“ (Höcker, Engberding & Rist, 2017). Für Klienten und Angehörige empfehlen wir zur selbstständigen Vertiefung und Festigung der gemeinsam in der Behandlung/im Coaching erarbeiteten Inhalte ergänzend unseren Ratgeber „Heute fange ich wirklich an! Prokrastination und Aufschieben überwinden“ (Höcker, Engberding & Rist, 2021). Der Ratgeber enthält ebenfalls unsere hier vorgestellten Methoden in Form eines strukturierten Selbsthilfeprogramms.
Das im vorliegenden Band beschriebene Vorgehen kann mit den beigefügten Arbeitsmaterialien direkt und unkompliziert in die Praxis umgesetzt werden. Es hat sich nachweisbar in der praktischen Arbeit bewährt; viele Menschen haben damit schon erfolgreich ihr Aufschiebeproblem überwunden und neue entlastende und produktive Gewohnheiten für sich geschaffen. Wir danken ihnen allen für ihr positives und konstruktives Feedback und für alles, was wir von ihnen über Prokrastination lernen durften.
Zum Schluss dieses Vorwortes danken wir den Kolleginnen und Kollegen, die bei der Entwicklung und Evaluation unserer Interventionsmethoden und unseren Forschungsprojekten in der Prokrastinationsambulanz geholfen und/oder uns dabei begleitet haben, vor allem:
Unseren Diplomandinnen Julia Beißner, Sarah Nieroba, Nicole Samberg und Maike Wildt, die gemeinsam mit uns die Gruppentrainingsvariante der Trainingsbausteine „Pünktlich Beginnen und Realistisch Planen“ und „Arbeitszeitrestriktion“ entwickelt und im Rahmen ihrer Diplomarbeiten erstmals durchgeführt haben.
Unseren früheren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Prokrastinationsambulanz: Eva Frings, Lena Reinken (geb. Beck), Karoline Krumm, Katrin Hönen, Julia Haferkamp (geb. Beumler) und Stephan Förster, sowie den beteiligten Hilfskräften und Praktikanten.
Unseren Diplomanden und Diplomandinnen, Master- und Bachelorstudierenden, die für ihre Abschlussarbeiten Fragestellungen aus unserer Forschungsgruppe übernommen und mit uns gemeinsam bearbeitet haben: Julia Patzelt, Inga Opitz, Björn Deters, Dina Menke, Birthe Jaensch, Karoline Krumm, Dorothee Brückner, Meike Braukmann, Lena Reinken (geb. Beck), Anita Bandalo, Eva Frings, Sarah Rossa, Sonja Westermann, Dorothee Müller, Sophie Bischoff, Ruth Haferkamp, Andrea Daemen, Marijke Hullegie, Anna Engberding, Milena Mentgen, Carolin Thielsch (geb. Spieker), Inez Frank, Laura Engelke, Michaela Lues, Johanna Schulte, Cornelia Scheuerle, Nicole Paßlick, Johanne Wolf, Hannah Wittmann, Carola Schmidt, Christian Wolff, Melanie Lindenberger, Nele Hannig und Verena Jurilj.
Frau Prof. Dr. Marianne Ravenstein, Prorektorin für Lehre im Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität, dafür, dass sie die Arbeit unserer Prokrastinationsambulanz schon früh gewürdigt und unterstützt hat.
|3|Der Psychotherapie-Ambulanz des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, dem An-Institut für Psychologische Psychotherapieausbildung (IPP), der Christoph-Dornier-Stiftung (CDS) Münster und der Universitätsgesellschaft Münster e.V. für die Unterstützung unserer Forschungsarbeiten.
Düsseldorf und Münster, Herbst 2021
Anna Höcker,
Margarita Engberding und
Fred Rist
|4|1 Beschreibung und Definition
Immer häufiger werden Psychotherapeuten1 und professionelle Berater mit dem Anliegen „Prokrastination“ (chronisch-exzessives Aufschieben) oder mit psychischen Belastungen infolge starken Aufschiebens konfrontiert. Sowohl das Interesse in den öffentlichen und sozialen Medien als auch das fachpsychologische Forschungsinteresse an dieser Problematik hat seit Beginn des Jahrhunderts einen wahren Boom erlebt. Etymologisch leitet sich der Begriff „Prokrastination“ von dem lateinischen Verb „procrastinare“ ab und bedeutet „etwas vertagen, auf morgen (= crastinum) verschieben“.
Fallbeispiel: Frau S.
Frau S. (40 Jahre), Arbeitsgruppenleiterin in der Marketingabteilung eines großen Pharma-Unternehmens, verheiratet und Mutter eines dreijährigen Sohns, berichtet, sie leide seit ihrer Beförderung vor einem halben Jahr unter großem Stress, zunehmenden beruflichen Sorgen und Unzulänglichkeitsgefühlen. Hauptgrund dafür sei, dass sie mit ihrem anspruchsvollen Projekt zur Neu-Konzeption der Marketingstrategie inzwischen in totalen Rückstand geraten sei. Die Arbeit daran schiebe sie seit Monaten vor sich her, obwohl dies ihre Kernaufgabe sei und sie sich mit höchster Priorität intensiv darauf konzentrieren müsste, da sie an den Ergebnissen „gemessen werde“. Stattdessen verwende sie unnötig viel Zeit auf kleinere, kurzfristige und manchmal auch dringliche Aufgaben, die sie aber genauso gut delegieren könnte. Die Frist für die Präsentation ihrer Projektergebnisse sei bereits in zwei Monaten; immer wieder werde sie schon nach den ersten Entwürfen gefragt. Sie empfinde starken Stress aufgrund des Aufschiebens, sei angespannt und unkonzentriert und „fahre schon mit Bauchschmerzen zur Arbeit“. Gleichzeitig schaffe sie es nicht, sich endlich dran zu setzen. Täglich mache sie trotz ihrer familiären Situation ca. ein bis zwei Überstunden; abends sei sie dann völlig erschöpft und „gar nicht richtig da“, wenn sie zu Hause sei.
Auf Frau S. werden wir im Verlauf des Buches noch häufiger Bezug nehmen (vgl. auch S. 24 f., 50, 85 f.).
|5|Fallbeispiel: Herr F.
Herr F. (31 Jahre), Jurastudent im 19. Semester, berichtet, dass er seit über einem Jahr jegliche Prüfungsvorbereitung zum ersten Staatsexamen aufschiebe und sich mit dem Stoff gar nicht mehr beschäftige, obwohl er sich das täglich vornehme. Er könne sich nicht vorstellen, wie er jemals die Prüfung schaffen solle. Angesichts seiner Zukunft fühle er sich oft traurig und mutlos. Er habe deutlich länger für sein Studium gebraucht, weil er sich seinen Lebensunterhalt immer nebenher habe verdienen müssen. Die erforderlichen Prüfungen im Studium habe er noch recht gut absolviert. Aber in der Repetitoriumszeit habe er es immer wieder aufgeschoben, sich an die Prüfungsvorbereitung und Probeklausuren zu setzen. Er könne sich einfach nicht dazu überwinden und ärgere sich immer wieder über sich. Wegen seines Alters brauche er besonders gute Examensnoten, um überhaupt noch eine Stelle zu finden. Die früheren Prüfungsvorbereitungen hätten ihn entmutigt, deshalb habe er immer mehr Zusatzverpflichtungen in seinem Nebenjob übernommen, verbringe daneben viel Zeit in sozialen Medien und sehe ausgiebig Serien. Seit einigen Monaten habe er sich zunehmend zurückgezogen und sei oft deprimiert und verzweifelt. Er schlafe schlecht und wache mit Gedanken an seine verfahrene Situation wiederholt auf. Seine frühere Kommilitonen-Gruppe sei längst fertig; er fühle sich als „übrig gebliebener Versager“. Herr F. möchte lernen, das Aufschieben und die Ersatztätigkeiten abzubauen, die Prüfungsvorbereitung wieder aufzunehmen und seine Aufgaben selbstbewusst in Angriff zu nehmen.
Fallbeispiel: Herr A.
Herr A. (54 Jahre) betreibt selbstständig mit zwei Angestellten eine Tischlerei, die hauptsächlich Aufträge zur Inneneinrichtung bekommt. Er mache sich große Sorgen um die Zukunft seines Betriebs, da ihm die Arbeit im Büro immer mehr über den Kopf wachse. Seit langer Zeit neige er zum Aufschieben, besonders bei der endgültigen Fertigstellung von Projekten, wenn noch kleine Nachbesserungen anstünden, sowie bei der Rechnungsstellung und Buchführung. Er reserviere sich zwar die nötige Zeit, verbringe diese aber dann mit lauter unwichtigen Nebentätigkeiten wie Blumengießen, Zeitunglesen, Schubladen aufräumen und Telefonieren. Beispielsweise schaffe er es nicht – oft bedingt durch das Verschieben von kleinen noch anstehenden Abschlussmaßnahmen bei einem Auftrag – in einem angemessenen Zeitraum Rechnungen an Kunden zu stellen und auch eigene Rechnungen zu bezahlen. Auch die Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen für den Steuerberater schiebe er viel zu lange vor sich her. Hierdurch seien bereits erhebliche finanzielle Verluste entstanden, sodass er schon mehrfach mit den Gehältern in Verzug geraten sei. Seine Angestellten |6|drohten ihm inzwischen mit Kündigung. Außerdem habe es viel Ärger bei Geschäftskunden gegeben und sein Ruf innerhalb der Branche sei mittlerweile stark beschädigt. Bei Herrn A. wurde vor kurzem stressbedingter Bluthochdruck diagnostiziert. Er leide unter Magenschmerzen und Schlafstörungen, da es ihm kaum noch gelinge, seine Gedanken an die Firma abzuschalten.
1.1 „Normales“ Aufschieben und Prokrastination
Viele Menschen schieben unangenehme Tätigkeiten auf, anstatt sie rechtzeitig und zügig zu erledigen. Je nach Lebens- und Arbeitssituation können solche unliebsamen Aufgaben sehr unterschiedlich sein. Aufschieben betrifft oft wichtige langfristige Arbeiten, wie die Arbeit an größeren Arbeitsprojekten, aber auch die Inangriffnahme heikler Gespräche oder privater, unangenehmer Aufgaben. Typische Beispiele sind etwa die Erstellung von Präsentationen, Projektberichten oder Gutachten, die Vorbereitung von Meetings, Referaten oder einer Rede, das Lernen für Prüfungen, das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten, längst fällige Steuererklärungen, unbezahlte Rechnungen oder das Fällen wichtiger Entscheidungen.
Gerade komplexe und umfangreiche Aufgaben, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, stellen große Anforderungen an die Selbststeuerungsfähigkeit. Es entwickelt sich häufig eine ausgeprägte Aversion, z. B. aufgrund des Umfangs, längerer Dauer, hoher Schwierigkeit oder Komplexität, großer Wichtigkeit oder wegen Unklarheit bezüglich des Arbeitsergebnisses und seinen Konsequenzen. Auch mit der Aufgabe verbundene Unsicherheit, Anstrengung, Selbstwertrelevanz des Ergebnisses, Langeweile und nicht zuletzt die Tatsache, dass die Aufgabe bereits lange aufgeschoben wurde, steigern den Widerwillen. Häufig wird dies erschwert durch ungünstige Verstärkerbedingungen, wie etwa weit entfernt liegende Fristen oder weit entfernte und unklare Konsequenzen bei Nichterledigung.
Aufgrund der hohen Anforderungen an die Selbststeuerungsfähigkeiten sind hier besondere Strategien zum Selbstmanagement nötig, um die Aufgabe „trotzdem“ zu bewältigen.
„Normales“ Aufschieben
Aufschieben an sich ist ein annähernd normalverteiltes Merkmal. Nicht jedes Aufschieben ist problematisch oder schädlich und nur sehr wenige Personen |7|können von sich sagen, dass sie nie aufschieben und sich bei freier Wahlmöglichkeit immer „vernünftig“ zugunsten der wichtigeren Absicht und gegen die momentan attraktiver erscheinenden Aktivitäten entscheiden. Sporadisches oder gelegentliches Aufschieben von einzelnen Aufgaben oder zu bestimmten Zeiten, welches weder zu Leiden noch zu Beeinträchtigung führt, ist weit verbreitet und in der Regel unproblematisch.
Problematisches Aufschieben und Prokrastination
Ab wann aber wird Aufschieben zum Problem, welches Menschen als so störend und belastend erleben, dass sie sich um professionelle Unterstützung bemühen? Aufschieben wird dann zum Problem, wenn dauerhaft und wiederholt wichtige Tätigkeiten zugunsten weniger wichtiger Tätigkeiten aufgeschoben werden und die tatsächlich durchgeführten Handlungen anhaltend nicht den eigenen Absichten zur Erreichung wichtiger Ziele entsprechen, sodass deutliche Nachteile und psychische Belastungen entstehen (vgl. Kasten).
Ab wann wird Aufschieben zum Problem?
Aufschieben wird dann zum Problem, wenn Personen
chronisch und exzessiv aufschieben und dadurch über längere Zeit in ihrem psychischen Befinden beeinträchtigt sind, z. B. durch Ärger, Stress, Angst, Anspannung, Unzufriedenheit, Schuld- und Schamgefühle, Depressivität bis hin zur manifesten Depression.