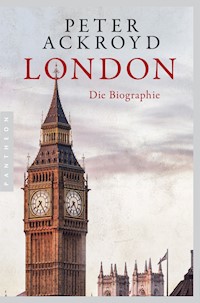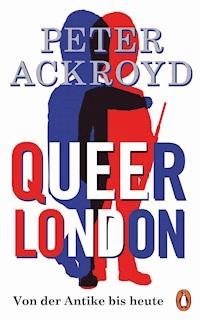
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Londons größter lebender Chronist über die »gay history« seiner Stadt
Das römische Londinium war übersät mit »Wolfshöhlen«, Bordellen und heißen Bädern, in denen es hoch herging. Homosexualität galt als bewundernswert. Bis Kaiser Konstantin die Macht übernahm und mit seinen Mönchen und Missionaren für Ordnung sorgte. Zeiten der Toleranz wechselten mit Zeiten der Ächtung und Verfolgung. Heute gehört »queer London« zur britischen Hauptstadt wie Tower und Big Ben. Londons homosexuelle Szene ist die größte in Europa und eine der größten weltweit. Peter Ackroyd zeigt uns, wie seine Stadt sich diesen Platz erkämpft hat. Er zelebriert die Vielfältigkeit und Energie der Community, zeigt aber auch die Gefährdungen, denen sie zu allen Zeiten ausgesetzt war. »Ein absolut einzigartiges Leseerlebnis.« The Independent
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Zum Buch
Londons größter lebender Chronist über die »gay history« seiner Stadt
Das römische Londinium war übersät mit »Wolfshöhlen«, Bordellen und heißen Bädern, in denen es hoch herging. Homosexualität galt als bewundernswert. Bis Kaiser Konstantin die Macht übernahm und mit seinen Mönchen und Missionaren für Ordnung sorgte. Zeiten der Toleranz wechselten mit Zeiten der Ächtung und Verfolgung. Heute gehört »queer London« zur britischen Hauptstadt wie Tower und Big Ben. Londons homosexuelle Szene ist die größte in Europa und eine der größten weltweit. Peter Ackroyd zeigt uns, wie seine Stadt sich diesen Platz erkämpft hat. Er zelebriert die Vielfältigkeit und Energie der Community, zeigt aber auch die Gefährdungen, denen sie zu allen Zeiten ausgesetzt war.
»Ein absolut einzigartiges Leseerlebnis.« The Independent
Zum Autor
Peter Ackroyd wurde 1949 in London geboren, wo er bis heute lebt. Er studierte Literaturwissenschaften in Cambridge und Yale und arbeitete viele Jahre für den »Spectator« und die »Times«. Mit seinen Romanen, Theaterstücken und Biografien gehört er zu den wichtigsten britischen Gegenwartsautoren. Er erhielt unter anderem den Somerset Maugham Award und den Whitbread Award. Bei Knaus erschienen zuletzt »London. Die Biografie« und »Die Themse. Biografie eines Flusses«.
PETERACKROYD
QUEER
LONDON
Von der Antike bis heute
Aus dem Englischen von Sophia Lindsey
Inhalt
1Kleine Erklärung der gebräuchlichsten Begriffe
2Eine rote, wilde Zunge
3Ein militärisches Glied
4Der Freund
5Bruderliebe
6So ein Theater
Bildteil 1
7Schlüpfrig und schlabbrig
8Die Reiberin
9Sodomitenwege
10Der Hinternhof
11Immerzu feucht
12Mother Clap und ihre Kinder
13Der gefälschte Gatte
14Die Macht der Masse
15Steißritter
16Omi-palone
Bildteil 2
17Dem Untergang geweiht
18Das Geheul
Dank
Bibliografie
Abbildungsverzeichnis
1 KLEINE ERKLÄRUNG DER GEBRÄUCHLICHSTEN BEGRIFFE
Die Liebe, die ihren Namen nicht zu nennen wagt, hört mit dem Reden gar nicht mehr auf. Galt sie einst als peccatum illud horribile, inter christianos non nominandum – das entsetzliche Vergehen, das unter Christen nicht beim Namen zu nennen ist –, wird sie seitdem endlos diskutiert.
Früher drückte der Begriff »queer« Abscheu aus, heute hat er einen anderen Klang. Im akademischen Raum hat er sich als Bezeichnung durchgesetzt und die Queer Studies haben in die Lehrpläne der Universitäten Einzug gehalten.
Wer weiß schon, woher das Wort »gay« stammt? Es lässt sich sowohl vom altprovenzalischen gai ableiten, was »fröhlich« oder »munter« bedeutet, als auch vom gotischen gaheis (ungestüm) oder vom fränkischen gahi (schnell). Ungeachtet der Sprache ist die Konnotation in jedem Fall dieselbe, nämlich Heidenspaß und helle Freude. Im Englischen bezog sich »gay« ursprünglich auf weibliche Prostituierte und die Männer, die ihnen nachstellten. Alle gay ladies waren zu haben. »Gay« als Bezeichnung für gleichgeschlechtliche Liebe, wie sie seit dem 20. Jahrhundert verwendet wird, ist wohl eine Erfindung der Amerikaner aus den Vierzigerjahren. Bis diese den Weg nach England fand, würde es einige Zeit dauern. Noch Ende der Sechziger verstanden viele nicht, was mit einer gay bar gemeint war.
Sodomie konnte ab dem 11. Jahrhundert so ziemlich alles und jedes bedeuten. Darunter fielen Ketzer und Ehebrecher, Gotteslästerer, Götzendiener und Rebellen – wer auch immer also die heilige Ordnung der Welt zu stören wagte. Der Begriff wurde außerdem mit Ausschweifung und Hochmut in Verbindung gebracht und immer wieder mit übermäßigem Reichtum assoziiert. Nicht zuletzt zielte er natürlich auf all jene, die abweichende Vorstellungen von sexueller Lust hatten, und wurde gerne einer bestehenden Reihe von Anschuldigungen dieser Art einfach hinzugefügt, etwa dem Vorwurf der widernatürlichen Unzucht (»buggery«). [Im Deutschen deckte der Begriff eine ähnliche Vielfalt sexueller Normverstöße ab, bevor er Ende des 19. Jahrhunderts auf die Definition »Geschlechtsverkehr mit Tieren« eingeschränkt wurde. Anm. d. Ü.]
Der Ausdruck »bugger« meinte ursprünglich einen Häretiker und im Besonderen die aus Bulgarien stammenden Albigenser. Weil deren Lehre ehelichen Geschlechtsverkehr und überhaupt Begattung verurteilte, nahm er bald eine Bedeutung an, die über Religion hinausging. Das Wort stammt vom französischen bougre ab und ist dort auch in der Wendung pauvre bougre geläufig, zu Deutsch: armer Tropf.
Mit dem »ingle«, dem entarteten Knaben, war man spätestens Ende des 16. Jahrhunderts vertraut. Die Straße Ingal Road im Osten von London trägt ihren Namen noch immer. Der »pathic«, der passive Partner, erblickte im 17. Jahrhundert das Licht. Obwohl seine Erregung im Gegensatz zu der des aktiven Mannes zweitrangig war, wurde er paradoxerweise als einziger bestraft. Er war weniger sexuell, sondern vielmehr sozial in Ungnade gefallen. Der »pathic« wandelte auf Abwegen, deren Betreten eine Gefahr für die bestehende Ordnung und eine Verletzung seiner sozialen Pflichten darstellte.
Der »catamite«, der Buhlknabe, stammt aus derselben Zeit wie der »pathic«. Minderjährige Jungen wurden »chicken« genannt, was wiederum »chicken hawk« (Hühnerhabicht) als Ausdruck für einen Päderasten erklärt. Wörter dieser Art mögen vorher jahrzehntelang ein Dasein im Untergrund geführt haben, da sie natürlich nach wie vor einen unaussprechlichen Akt benannten. Zum Inbegriff des jungen Mannes, der das eigene Geschlecht liebt, wurde »Ganymed«, jener bartlose Jüngling, auch bekannt als kinaidos, der in Darstellungen oft einen jungen Hahn umfasst hält.
Im 18. Jahrhundert standen die »Mollys« (Weichlinge) im Zentrum der Aufmerksamkeit. »Jemmy« war eine Verballhornung des Königs Jakob I. von England, dessen erotische Neigungen weithin bekannt waren. Selten stößt man auch auf »indorsers«, ein Slangwort aus dem Boxsport, mit dem anhaltende Schläge auf den Rücken des Gegners bezeichnet wurden. In einem alten Manuskript aus dem Newgate-Gefängnis wird einem Taschendieb geraten, jene »Indorsers ihren animalischen Gelüsten zu überlassen«. Ein zahmerer Ausdruck war »fribble«, nach der gleichnamigen Figur des englischen Schauspielers und Bühnenautors David Garrick. Darüber hinaus kannte das 18. Jahrhundert Begriffe wie »madge« und »windward passage« in Anspielung auf Analverkehr, außerdem »caudlemaking« oder »giving caudle« vom lateinischen Wort cauda für Schwanz. Schwule wurden »Backgammonspieler« oder »Herren der Hintertür« genannt, die sich »miauend« vergnügten. Sowohl Männer als auch Frauen erfreuten sich an »gamahuche«, ein anderes Wort für Fellatio.
Effemination gehörte schon immer zur »Natur des Menschen«, wie es David Garrick in der Rolle des Mr Fribble ausdrückt. Der Begriff war nicht nur queeren Männern vorbehalten, sondern bezeichnete auch jene, deren Liebe zu Frauen das gesunde Maß überstieg. In seiner Bibelübersetzung aus dem frühen 14. Jahrhundert überträgt John Wycliffe effeminati als »men maad wymmenysch« (verweiblichte Männer). Sie galten als schamlos und albern, waren weich oder auch schwach. Um die Lage noch zu verkomplizieren, konnten sie auch asexuell sein.
»Effeminiert« ist nicht zu verwechseln mit dem Ausdruck »camp«, dem der Wille zum Unterhalten, Amüsieren und Schockieren innewohnt. »Camp« impliziert Extravaganz und Zurschaustellung und kommt wahrscheinlich vom italienischen Verb campeggiare für hervorstechen oder dominieren. Über »camp« herrschte die »Queen« (oder »quean«). Waren damit zunächst schamlose oder dreiste Frauen gemeint, also die Starken ihres Geschlechts, fand es im frühen 20. Jahrhundert auch Anwendung auf überkandidelte Schwule, die noch weibischer waren als die Weiber selbst.
Der Schriftsteller und Journalist Karl Maria Kertbeny führte 1868 den Begriff »homosexuell« (beziehungsweise »homosexual«) ein und gehört damit zu den heimlichen Gesetzgebern der Menschheit. Dies war für ihn keine Frage der Moral, sondern eine der Klassifikation. Ein nüchtern denkender Mensch musste sich des Themas annehmen, kein Priester. Auf Kertbenys Grab werden heute noch Blumen niedergelegt. Dreiundzwanzig Jahre später übertrug der Neurologe Charles Gilbert Chaddock den Begriff ins Englische: »homosexuality«. Der Sexualforscher Havelock Ellis nannte ihn einen »barbarischen Neologismus, entsprungen dem animalischen Ineinander griechischer und lateinischer Stämme« – doch möglicherweise verwechselte er das Wort mit dem Akt.
Als der Schriftsteller J. R. Ackerley 1918 gefragt wurde, ob er »homo oder hetero« sei, verstand er nicht, was mit der Frage gemeint war. Der Schriftsteller und Kritiker T. C. Worsley berichtet, dass Homosexualität im Jahr 1929 »immer noch ein technischer Begriff war, dessen Implikationen sich mir nicht vollständig erschlossen«. Bis in die Fünfzigerjahre vermochte das Wort die älteren Herrschaften zu verwirren, und in die Ruhmeshalle der Oxford English Dictionary zog es erst mit dem Ergänzungsband von 1976 ein.
1862 tauchte im Werk von Karl Heinrich Ulrichs eine weitere Bezeichnung auf. Die Inspiration für seinen »Uranier« oder »Urning« bezog er von Platons Symposion, in dem gleichgeschlechtliche Liebe als ouranios (himmlisch) bezeichnet wird. (Wörtlich übersetzt bedeutet ouranos übrigens »der Pinkler«, was mehr Fragen aufwirft als beantwortet.) Seines überirdischen Ursprungs zum Trotz fand der Begriff keine Verbreitung. Wer will schon »Urning« genannt werden? Das klingt wie eine Zwergenart. Eine »Urninde« war dementsprechend eine lesbische Frau, ein »Uranodioning« ein Bisexueller. Fachtermini wie »simisexualism« und »homogenic love« (homogene Liebe) waren ähnlich ungelenk. Der »invert« (der Invertierte) ist eine Erfindung des späten 19. Jahrhunderts, die sich aber nicht der gleichen Beliebtheit erfreute wie der »pervert« (der Perverse).
Untereinander verwendeten die bunt gemischten Brüder und Schwestern Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche Euphemismen: Ist es ihm ernst? Ist er so? Ist er musikalisch? Ist er theatralisch? Ist er temperamentvoll? Ist er zu haben? In den Dreißigerjahren fragte man junge Männer, ob sie sich »eine Wohnung teilen«.
Auf der anderen Seite gab es die weniger beschönigenden Ausdrücke wie »fairy« (Tunte), »shirt-lifter« (Druntenlieger), »pansy« (Bubi), »nancy boy« (warmer Bruder), »pervert« (Perverser), »bone-smoker« (Knochensauger), »poof« vormals »puff« (Tucke), »sissy« (Lusche), »Mary Anne« (Stricher), »fudge-packer« (Nougatstecher), »butt-piler« (Hinterlader), »pillow biter« (Kissenbeißer) und das amerikanische »faggot« oder »fag« (Schwuchtel). Ein »faggot« war ein Bündel Feuerholz, wie es auch zur Verbrennung der Sodomiten [oder Sodomiter, wie man damals sagte, Anm. d. Ü.] diente. Zumindest ist das eine Erklärung. Das Schimpfwort könnte auch vom englischen »fag« kommen, das einen jüngeren Schüler meinte, der für die höheren Jahrgänge niedere Dienste zu verrichten hat. Kompliziertere Wörter tauchten aus dem Nichts auf. Ein »dangler« (wörtlich »Baumler«) war im 19. Jahrhundert jemand, der zwar vorgab, zu Frauen hingezogen zu sein, es aber in Wahrheit nicht war.
Zu den weiblichen Varianten der gleichgeschlechtlichen Liebe gehören »sapphisch« und seit den 1730er-Jahren auch »lesbisch«, was auf die unübertroffene Dichterin Sappho der Insel Lesbos zurückzuführen ist. »Sapphisch« wurde im frühen 20. Jahrhundert häufig zu »sapph« abgekürzt. Auch von »Tribaden« oder »tribadischen Frauen« war gelegentlich die Rede, wofür es sowohl griechische als auch lateinische Quellen gibt. Neben der »fricatrice«, der Reiberin, gab es die »subigatrice«, die Pflügerin. Im 18. Jahrhundert kannte man in England außerdem die Bezeichnung »Tommy«, wie sie im Sapphic Epistle (1777) auftaucht. »Butch«, »Femme«, »dyke« (Lesbe), »bull-dyke« (Kampflesbe) oder »diesel-dyke« sind heute noch geläufig.
Das Wort »queer« drückt nicht nur Widerstand aus, sondern ist zudem eine Absage an Karl Maria Kertbenys nüchternen Neologismus »Homosexualität«. Man könnte auch sagen, dass es sich jenseits der Geschlechter bewegt. Als überaus treffsicherer Begriff wird er in dieser Studie des Öfteren verwendet. Das schließt aber die Verwendung von Wörtern wie »schwul« [die wohl beste Entsprechung für das englische »gay«, Anm. d. Ü.] oder »lesbisch« nicht aus, wenn diese passender erscheinen oder sich besser ins Erzählte einfügen. Mit »homoerotisch«, das aus dem 20. Jahrhundert hinübergerettet wurde, kann sich notfalls beholfen werden. [Es gilt zu bedenken, dass von einem Phänomen die Rede ist, das sich jahrhundertelang der Versprachlichung entzog. Wir können unsere heutigen Begriffe nicht eins zu eins auf die Vergangenheit übertragen. Wenn hier also auf Wörter wie »Homosexualität« zurückgegriffen wird, um Ereignisse des Mittelalters und der Frühen Neuzeit zu beschreiben, dann in einem abstrakten Sinn und um Wortungetüme wie »Gleichgeschlechtlichkeit« zu vermeiden. Anm. d. Ü.]
Manchmal ist es auch nötig, von »LGBTQIA« zu sprechen, das mit »lesbisch« beginnt, mit »asexuell« endet und in dessen Mitte sich irgendwo »transgender« verbirgt.
Und so bewegen sich queere Menschen durch Raum und Zeit, jeder mit seiner oder ihrer eigenen Geschichte des Andersseins. Manche könnten deshalb geneigt sein, dieses Buch ein queeres Narrativ zu nennen – aber je queerer, desto besser.
2 EINE ROTE, WILDE ZUNGE
Es gibt kaum Aufzeichnungen aus der Zeit, bevor die Römer nach London kamen. Dennoch kann man versuchen, im imaginierten keltischen Zwielicht einen Blick auf fremde Leidenschaften zu erhaschen. Der Name der Stadt ist vermutlich keltischen Ursprungs. Man stellt sich die männlichen Mitglieder dieser frühen Stämme gerne als tatkräftige Kerle vor, die mit der einen Hand das Herz eines Hirschs herausreißen und mit der anderen die mit Tierhaut bespannte Trommel schlagen. Doch in Wahrheit trugen viele der Anführer Frauenkleidung und vollzogen Riten, bei denen sie den weiblichen Orgasmus und die Schmerzen der Geburt nachahmten. Aristoteles merkt an, dass bei den Kelten »der fleischliche Verkehr mit Männern als anständig gilt«; er benutzt hier das griechische Wort synousia, das wörtlich »Zusammensein« oder »etwas von gleicher Natur« bedeutet, in seiner derberen Bedeutung aber den Geschlechtsverkehr meint. Die Kelten waren für ihren dunklen Teint und ihr schwarzes, lockiges Haar bekannt. Öl war das bevorzugte Gleitmittel. »Sie tragen langes Haar«, schrieb Julius Caesar, »und rasieren sich am ganzen Körper mit Ausnahme von Haupt und Oberlippe.« Auf den Straßen Londons sind ihresgleichen noch immer anzutreffen.
Dem griechischen Philosophen und Geografen Strabo zufolge ging die keltische Jugend »verschwenderisch mit ihren Reizen« um. Sein Zeitgenosse Diodorus Siculus berichtet in seiner Universalgeschichte von keltischen Männern, die ihren Frauen wenig Beachtung schenken und stattdessen die körperliche Nähe ihrer Geschlechtsgenossen suchen; demnach drohten Schande und Ehrverlust, wenn ein Jüngling die sexuellen Annäherungen eines Erwachsenen ausschlug. Die Männer lagen auf Tierfellen, zu jeder Seite einen jungen Beischläfer. Der Schriftsteller Athenaios von Naukratis schildert Ähnliches, doch womöglich erzählte er einfach eine verruchte Geschichte nach, die sowohl von den Germanen als auch von den Kelten handeln konnte. Anstatt vom Volk der »Kelten« oder »Germanen« zu sprechen, scheint es zielführender, einzelne Stämme zu untersuchen, deren Geschichte teilweise bis ins Mesolithische Zeitalter zurückreicht. Doch auf diesem Gebiet herrscht ein heilloses Durcheinander. Wir tun besser daran, über ihr Verhalten nachzudenken als über ihre Herkunft.
Eusebius von Caesarea berichtet im 4. Jahrhundert von jungen, männlichen Stammesmitgliedern, die einander nach dem üblichen Brauch zu heiraten wünschten. »Die schönen Knaben werden gleichsam wie Frauen zu Männern genommen, und selbst Hochzeitsfeste werden für sie veranstaltet«, beschreibt auch Bardesanes von Edessa. Bei Sextus Empiricus heißt es, die Germanen betrachten Sodomie »nicht als schändlich, sondern als gebräuchlich«. Hier stimmen die Quellen erfreulicherweise überein.
Schöne Knaben waren in stark militärisch ausgerichteten Gemeinschaften keine Seltenheit. Die große Anzahl entsprechender Hinweise lässt vermuten, dass das Einnehmen der passiven Geschlechtsrolle für einen erheblichen Teil der Gesellschaft zum Erwachsenwerden gehörte. Darunter waren Sklaven, Geistliche und Männer, die keine militärische Karriere im Sinn hatten. Die überlieferten Quellen belegen, dass eine Alternative zum herkömmlichen Zeugungsakt nicht nur jederzeit verfügbar, sondern auch überaus gefragt war. Daran hat sich in der gesamten Geschichte Londons nichts geändert.
Was das römische London betrifft, bewegen wir uns auf gut dokumentiertem Terrain. Als die Eroberer Ziegel und Marmor heranschafften, brachten sie auch ihre sozialen Bräuche mit. Anfangs verliefen auf dem östlichen Hügel zwei schotterbedeckte Hauptstraßen parallel zum Fluss. Im Nordwesten der Stadt entstand ein Heerlager. Rundherum sprossen alsbald Kneipen und Bordelle wie Unkraut. Als relativ junge Siedlung war London zu diesem Zeitpunkt empfänglich für neue Gepflogenheiten und Einflüsse. Sobald es den Status einer Stadt, einer Hauptstadt gar, erlangt hatte, war sein Wachstum nicht zu bremsen. Eine reiche Stadt war entstanden, in der sich Händler tummelten und Geschäftsleute, die negotiatores, die zweifellos nicht nur Waren, sondern auch Körper käuflich erwarben. London ist eine der wenigen Siedlungen der Welt, die ihren Anfang als Stadt nahm und immer eine geblieben ist – mit allen kommerziellen und finanziellen Verwicklungen, die damit einhergehen.
Der städtische Alltag gestaltete sich nach römischem Vorbild. Gleichgeschlechtliche Liebe wurde am häufigsten zwischen Herr und Sklave oder Mann und Knabe praktiziert, der passive Partner nahm also nicht am politischen Leben teil. London war im Grunde ein Stadtstaat mit eigenem, unabhängigem Stadtregiment, und Statusunterschiede waren entscheidend. Die Aktiven waren auch die Herrschenden. Sexualität entfaltet sich nie unabhängig von der Gesellschaft, sondern ist immer ihrer Deutungshoheit und Kontrolle unterworfen. So konnten im Kampf unterlegene Krieger von römischen Bürgern vergewaltigt werden – oder man penetrierte die Besiegten stattdessen mit Rettichen. Das mag nicht allzu schmerzhaft klingen, doch im Süden Englands wird seit jeher eine Sorte weißen Rettichs angebaut, deren Exemplare bis zu fünfzehn Zentimeter lang werden können.
Pädophilie, also Sex mit einem Kind, und Päderastie, Sex mit einem Jugendlichen, wurden nicht verurteilt. Die Liebe zwischen zwei frei geborenen Männern hingegen war unerwünscht und galt als schändlich, was natürlich nicht ausschließt, dass es sie gab. Doch wenn ein Mann dieser infamia beschuldigt wurde, lief er Gefahr, seine Bürgerrechte zu verlieren.
In einer geschäftigen Stadt wie Londinium boten die zahlreichen lupanaria oder »Wolfshöhlen« (behördlich genehmigte Freudenhäuser) und die fornices (Bordelle) sowie die thermiae (Thermen) viele Möglichkeiten. Die teuren Freudenhäuser waren vor allem römischen Verwaltungsbeamten und dem römisch-britischen Adel vorbehalten. Die Bordelle der unteren Gesellschaftsschichten betrat man durch einen Vorhang, hinter dem sich eine Reihe kleiner Kammern verbargen. Die strohgedeckten Holzhütten hatten bunte Malereien an den Innenwänden. Auch die palaestrae – die Sportanlagen – der Thermen waren dafür bekannt, dass man hier leicht sexuelle Kontakte knüpfen konnte.
Sex konnte auch in der Öffentlichkeit feilgeboten werden, um Laufkundschaft anzulocken. Männliche Prostituierte warteten zum Beispiel vor ihrer Bude oder »Zelle« auf Kunden oder gingen selbst in Wirtshäusern, Herbergen und Backstuben auf die Suche. Sie gehörten meist der Unterschicht an, es waren aber auch Ausländer und Sklaven darunter. Unweit der wichtigsten Schiffsanlegestellen befanden sich freie Flächen, sogenannte »Romelands«, wo Sklaven und ausländische Gefangene an Ort und Stelle verkauft werden konnten. »Romelands« gab es etwa an den Länden von Dowgate, Queenhithe und Billingsgate sowie in der Nähe des Tower. Männliche Prostituierte wurden als Steuerzahler geschätzt und hatten sogar ihren eigenen gesetzlichen Feiertag.
Minucius Felix, ein römischer Apologet des Christentums, bezeichnete Homosexualität als »die römische Religion«, und der assyrische Gelehrte Tatian bekräftigte im 2. Jahrhundert, dass Päderastie »bei den Römern hohes Ansehen genoss«. Sie war gesellschaftlich anerkannt und in London sicher genauso üblich wie in Rom. Tatsächlich war sie kaum der Erwähnung wert, genauso wenig wie die »Hermen« oder Steinsäulen, die an den wichtigen Kreuzungen standen und Hermes mit erigiertem Phallus oder auch einfach nur einen Phallus zeigten. Man kann gar nicht genug betonen, was Altphilologen gerne verschämt verschweigen, nämlich dass die römische Gesellschaft in höchstem Maße phallokratisch war. Eine vergleichbare Verehrung des männlichen Glieds fand nur in einigen Regionen Indiens statt.
Den »Schwulen« des alten Griechenlands, der seinen römischen und englischen Brüdern in vieler Hinsicht ähnelt, beschreibt die anonym verfasste Physiognomonica (etwa 300 v. Chr.) folgendermaßen: »unstete Augen und zusammenstoßende Knie; er neigt den Kopf nach rechts; er gestikuliert mit nach oben zeigenden Handflächen und schlaffen Handgelenken; er geht auf zweierlei Art: entweder sich in der Hüfte wiegend oder indem er sie gerade hält. Er lässt den Blick schweifen.« Sein Gegenstück in London und Rom ist der von Scipio im Jahr 129 v. Chr. beschriebene homo delicatus, der sich »täglich parfümiert und vor dem Spiegel ankleidet, gezupfte Brauen hat und mit gestutztem Bart und glatten Schenkeln herumstolziert«. Der homo delicatus war weichmütig, sein Gang war affektiert, und seine Stimme war schrill oder er lispelte. Er kleidete sich nicht in Weiß, sondern zog Violett oder Lila vor, gefiel sich aber auch in Hellgrün und Himmelblau. Die Hand stemmte er in die Hüfte, und am Kopf kratzte er sich mit nur einem Finger. Im 1. Jahrhundert berichtet Tacitus in seiner Biografie Agricolas über Britannien, dass »auch die Barbaren die verlockenden Laster mit der Zeit gutzuheißen begannen«. Das römisch-britische Volk habe die törichten Ausschweifungen seiner Herrscher nachgeahmt, doch was es in seiner Ahnungslosigkeit für »Zivilisation« hielt, sei in Wahrheit nur »ein Teil seiner Knechtschaft« gewesen. Das neue London wurde zum Spiegel des alten Roms.
Die Autoren der Antike dokumentierten ausführlich die Garderobe des weibischen Mannes; Kleider machten schließlich Leute. Beide Geschlechter trugen Umhänge aus weicher Wolle, doch der Mann sandte damit ein eindeutiges Signal aus. Das galt auch für weiße knie- oder wadenhohe Lederstiefel und safrangelb gefärbte Gewänder. Den effeminierten Mann erkannte man zudem am »orientalischen« Kopfschmuck, ähnlich eines Turbans, und an den Schlupfschuhen, die drinnen getragen wurden. Sandalen mit an den Sohlen befestigten Lederriemchen waren genauso unangemessen wie hauchfeine Tücher oder Schleier. Übermäßig lange und weite Kleidungsstücke, zum Beispiel knöchellange oder gürtellose Tuniken, hielt man für unmännlich. Auch Tätowierungen wurden mit Argwohn beäugt. Früher nahm man an, dass mit Schmuck ausgestattete Gräber Frauen gehörten, doch dieser bequeme Irrglaube ist mittlerweile aus der Welt geschafft. Heute weiß man, dass auch Männer Ringe, Ohrringe und Halsreifen (Torques) trugen. In London wurde ein Bildnis des Harpokrates gefunden, das den geschlechtsreifen Knabengott mit einer Goldkette zeigt, wie man sie zuvor nur an weiblichen Gottheiten gesehen hatte.
Doch die Männer sind nur eine Seite der Medaille. Historiker haben in juristischen Dokumenten Hinweise darauf entdeckt, dass Frauen sich Schlafstätten teilten und sogar flüchtige oder dauerhafte Beziehungen eingingen. Doch nicht nur das Antiquariat, auch die Archäologie liefert entsprechende Funde. In der Great Dover Street wurden die Überreste einer Gladiatorin freigelegt. Die Straße liegt in Southwark südlich der Themse, wo aus der Gesellschaft Ausgestoßene ihre letzte Ruhestätte fanden. Die Frau war Anfang zwanzig. Sie wurde unter anderem mit einer Lampe begraben, auf der ein gefallener Gladiator abgebildet war. Zu den Grabbeigaben gehörten außerdem Pinienzapfen (pinus pinea), wie es sie im römischen London einzig und allein im großen Amphitheater gab, wo sie die giftigen Gerüche übertünchten.
Trotz ihres Status als Außenseiterin scheint die junge Frau reiche Bewunderer angezogen zu haben, was davon zeugt, wie inbrünstig die waghalsigeren Kämpfer von der Masse verehrt wurden. Die römische Antike birgt noch weitere Beispiele für Gladiatorinnen und damit verbundene Bräuche und Gewohnheiten. So wurden zum Beispiel Kämpfe zwischen Frauen und Zwergen abgehalten. Im British Museum befindet sich ein Marmorrelief, das zwei Frauen in voller Rüstung zeigt. Wie es um die Sexualität dieser Frauen stand, können wir nicht mit Gewissheit sagen. »Wie kann von einer Frau im Helm man Scham erwarten«, schrieb Juvenal, »die selbst ihr Geschlecht flieht, die nur Mannkraft liebt?«
Noch eine weitere Spur führt nach London. Petronius berichtet von einer essedaria, einer Gladiatorin auf einem britischen Streitwagen. Das ist höchst verwunderlich. Antiken Quellen entnehmen wir außerdem, dass die Frauen in England so groß und stark seien wie Männer. Unterhalb der Rangoon Street in der City of London entdeckte man eine Grabstätte mit zwei eng umschlungenen Frauen in ihren Mittzwanzigern. Sie waren beide eher stämmig und hatten kräftige Beine und Füße, was darauf hinweist, dass sie schwer getragen und auf dem Bau gearbeitet oder irgendein anderes Handwerk verrichtet hatten. Man weiß von zwei weiteren Frauen, die am Bull Wharf am Ufer der Themse in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt wurden. Die ältere der beiden wurde offenbar durch einen Schlag auf den Kopf getötet. Neben ihr lag eine erheblich jüngere und zierlichere Frau, die etwa 1,45 Meter groß war. Vielleicht waren sie Schwestern, vielleicht aber auch nicht.
Auffallend ist, wie viele Gladiatoren weiblich anmutende Namen wie Hyacinthus und Narcissus wählten, und sehr wahrscheinlich gehörten zu ihren Bewunderern ebenso viele Männer wie Frauen. Sie wollten gefallen; die mit goldenen Quasten und Stickereien verzierten Tuniken und aufwändigen Armreifen waren offensichtlich darauf ausgelegt. Inschriften zu ihren Ehren lassen homoerotische Zwischentöne erkennen. Manchmal tourten sie wie Schauspieltruppen durch England. In London gibt es Statuen, kupferne Lampen und Schüsseln und sogar Ohrringe, auf denen Herkules abgebildet ist – typischerweise ist er nackt und bartlos, hat kurzes, glattes, »keltisches« Haar und in der rechten Hand seine Keule, doch am Walbrook wurde eine Darstellung gefunden, in der drei Liebesgötter die Waffe halten. In jedem Fall galt er vielen Bewohnern Londons als himmlischer Held.
Doch das Himmlische zog schon bald andere Saiten auf. Zu Beginn des 4. Jahrhunderts warf das Kreuz seinen Schatten auf Londinium. Der Übertritt zum christlichen Glauben passierte nicht auf einen Schlag, hatte aber weitreichende Folgen. Die Bischöfe und ihr Klerus kamen. Die Mönche kamen. Die Missionare kamen immer wieder. Erstmals wurden Gesetze erlassen, die bestimmte Sexualpraktiken unter Strafe stellten, obwohl Homosexualität erst im 6. Jahrhundert vollends verboten wurde.
Indes die Städte des Römischen Reichs zerfielen, wuchs die Feindseligkeit gegenüber den Minderheiten, die in der städtischen Atmosphäre aufgeblüht waren. Zur Regierungszeit des byzantinischen Kaisers Justinian, der im 6. Jahrhundert herrschte, wurden sodomitische Handlungen mit Kastration beider Beteiligten bestraft, was einer Todesstrafe gleichkam. Ein 538 verkündetes Gesetz warnte die Bewohner Konstantinopels davor, dass derlei Praktiken »den Zorn Gottes herausfordern und die Zerstörung von Städten mitsamt seinen Bewohnern herbeiführen« werden. Als Beweis mag Rom gedient haben oder sogar der Verfall Londiniums, das seit Beginn des 5. Jahrhunderts schutzlos sich selbst überlassen war.
Die Ankunft der Sachsen ist auf den Anfang eben dieses Jahrhunderts datiert worden. »Eine rote, wilde Zunge« leckte an den Bewohnern Englands, wie der Geschichtsschreiber Gildas verlauten ließ. Das archäologische Zeugnis lässt darauf schließen, dass die Stadt ab der Hälfte des 6. Jahrhunderts durch und durch sächsisch war, und Lundenwic entstand dort, wo sich heute Covent Garden befindet.
Die Angelsachsen – zu denen Jüten, Friesen, Angeln und Sachsen gehörten, die zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten aufgetaucht waren – waren noch nicht zum Christentum bekehrt worden und behielten ihre einheimischen sexuellen Traditionen bei. Die römischen Schilderungen ihrer homosexuellen Neigungen weisen so große Ähnlichkeit zu den Beschreibungen der keltischen und germanischen Stämme auf, dass sie praktisch austauschbar sind. Natürlich sind die Möglichkeiten dessen, was zwei Männer aneinander oder miteinander anstellen können, begrenzt. Doch oft wiederholten die frühen Geschichtsschreiber auch einfach, was sie woanders gelesen hatten.
Es war eine Welt der Krieger, geprägt von einer zutiefst männlichen Kultur. Die jungen Männer der oberen Schichten trugen Tuniken aus Leinen, die an Handgelenk und Hüfte mit goldenen Schnallen befestigt waren. Broschen und andere Schmuckstücke zierten ihre Gewänder. Beide Geschlechter färbten sich die Haare; bei Männern waren vor allem Blau, Grün und Orange beliebt. Die frühe Geschichte hatte außerdem eigene pikante Legenden. Mempricius, der fünfte König Britanniens, soll der Sodomie verfallen und von Wölfen verschlungen worden sein. Auch der sächsische König Malgo machte sich im 6. Jahrhundert angeblich der »Sünde wider die Natur« schuldig und verstarb plötzlich beim Baden in seinem Palast in Winchester.
Die ersten angelsächsischen Gesetzestexte erwähnen gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken mit keinem Wort. Das älteste Gesetzbuch, das Ethelbert von Kent zu Beginn des 7. Jahrhunderts niederschreiben ließ, führt Strafen für Unzucht mit Tieren, Vergewaltigung, Ehebruch und Inzest auf, spielt auf Homosexualität aber nicht einmal an. Im 9. Jahrhundert sah Alfred der Große unter Bezug auf die Bibel die Todesstrafe für Sex mit Schafen vor, wohingegen Sex zwischen Männern überhaupt nicht geahndet wurde. Man könnte sagen: Hunde, die beißen, bellen nicht.
Die Sachsen waren größer und massiger als die Römer und Kelten. Einige besaßen buschige Schnurrbärte, waren aber sonst glatt rasiert. Viele trugen ihr Haar kurz in dem Glauben, dass dies ihre Gesichter breiter und Furcht einflößender aussehen ließ. Sie unterschieden sich wahrscheinlich kaum von den Angeln und Jüten, die mit ihnen das Meer überquert hatten. Doch vielleicht war das in jungen Jahren anders? In der ersten Geschichte Englands beschreibt Beda Venerabilis, wie Papst Gregor I. auf einem Markt in Rom junge Angeln mit »heller Haut, zarten Gliedern und schönem Haar« erblickt. Non angli, sed angeli (Das sind keine Angeln, sondern Engel), rief der Papst angeblich aus, doch auf die kleinen Engel wartete zweifellos ein weitaus schlimmeres Schicksal als die Aufnahme in einen himmlischen Chor. Die Bemerkung wurde ihm später zum Verhängnis, als man ihn deshalb einen Sodomiten schimpfte. Vincere non protest, wie er vielleicht gesagt hätte. Man kann nicht gewinnen.
Das Christentum erreichte England offiziell erst im Jahr 597, als Augustinus von Canterbury auf der Insel Thanet landete, um nicht das britische, sondern das germanische Volk zu bekehren. Die Regierung wusste die Kirche für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und die Bußbücher (Libri poenitentiales) – inoffizielle Beicht- und Strafkataloge, die im Frühmittelalter vor allem in England und Irland verbreitet waren – gaben streng Auskunft darüber, welche Sünde wie zu begleichen war. Die angelsächsischen Gesetzesbücher mögen Homosexualität nicht erwähnt haben, doch in den Dokumenten der Christen spielte sie eine entscheidende Rolle. Die Bußbücher sahen für den Verkehr mit einem anderen Mann eine Buße von vier Jahren vor, die sich bei Wiederholung auf zehn oder fünfzehn Jahre erhöhte. Sieben Jahre büßte der sodomita oder mollis (der »weichliche« Mann) einfach für sein Dasein auf der Welt. Offenbar gab es schon damals eine klar abgegrenzte Gruppe oder Gemeinde von Homosexuellen, die von der gesellschaftlichen Mehrheit mit bestimmten Namen gerufen wurde. Ein solcher Name war baedling, der mit dem angelsächsischen Wort für einen Knaben oder weibischen Mann zusammenhängt oder aber jemanden meinte, der zu viel Zeit in Badehäusern verbringt. Einige Wissenschaftler vermuten, dass das englische Wort »bad« eine Ableitung von baedling ist und so einem sexuellen Unterschied eine grundlegend moralische Bedeutung zugewiesen wurde. In einem ähnlichen Versuch queerer Etymologie geht man davon aus, dass der Begriff »felon« (Verbrecher) von dem Wort fellare (saugen) abstammt.
Eine Bußordnung aus dem Jahr 670, die Erzbischof Theodor von Canterbury zugeschrieben wird, enthält folgende Vorschrift: »Wenn Knaben miteinander Unzucht treiben, sollen sie seinem Urteil nach ausgepeitscht werden.« Ferner heißt es, »wer seinen Samen in den Mund eines anderen entlässt, soll sieben Jahre Buße tun; dies ist das größte Übel«. Ein Knabe, der Geschlechtsverkehr mit einem geweihten Kleriker hat, büßt mit drei Fastenperioden zu je vierzig Tagen. Der Erwachsene hingegen wird nicht bestraft. Das mag daran gelegen haben, dass der Knabe als Verführer und Anstifter galt und außerdem die gesellschaftliche Autorität des Mannes gewahrt werden sollte. Vielleicht diente das Fasten auch dazu, das Kind vom »Schmutz« zu reinigen. Hier besteht ein offenkundiges Gefälle, das umso mehr den Unterschied zwischen frühmittelalterlicher und moderner Sexualität deutlich macht. »Lasset Uns Also Nun das Dekret Unserer Väter Erlassen über die Sündigen Spiele der Knaben«, wird der Abschnitt einer Pönitentiale besonders klangvoll eingeleitet.
Das irische Bußbuch des Finnian erwähnt auch Oralsex: »Wer sein Verlangen mit den Lippen stillt, büßt drei Jahre. Wenn es zur Gewohnheit geworden ist, sieben Jahre.« Es verurteilt auch in terga fornicantes, also Analverkehr, überlässt die Bestrafung aber dem Ermessen des Priesters, der die Beichte abnimmt. Es besteht kein Zweifel daran, dass der christliche Gesetzeskanon niemals auch nur ansatzweise tolerant gegenüber gleichgeschlechtlicher Liebe war. Verboten war sie immer, auch wenn sie erst im 16. Jahrhundert zum Kapitalverbrechen wurde.
Auch weibliche Sexualität kommt in den Bußbüchern zur Sprache. »Wenn eine Frau mit einer anderen Frau verkehrt, soll sie drei Jahre fasten.« Eine andere Pönitentiale erwähnt die Anwendung einer machina, die sich sehr nach einem Dildo anhört. Transvestismus wurde weder bei Frauen noch bei Männern als sexuelles Vergehen betrachtet, sondern galt als Aspekt der Hexerei oder einer anderen heidnischen Praxis. Es kam durchaus vor, dass männliche Leichen mit traditionell weiblichen Grabbeigaben beigesetzt wurden, weshalb Archäologen die Existenz eines »dritten Geschlechts« bei den Angelsachsen in Betracht zogen. Dies deckt sich mit Zeugnissen aus anderen Teilen der Welt, angefangen mit den Berdachen der Dakota in Nordamerika bis hin zu den bhutanischen Tänzern in Südindien. Die Fragen, wann und warum diese sexuelle Vielfalt eingeschränkt beziehungsweise getilgt wurde – falls es so war – gehören zur Geschichte der queeren Stadt.
Wenn es Männer gibt, deren Geschlecht nicht eindeutig ist, so gilt das auch für Frauen. Geschichten erzählen von religiösen oder auch heiligen Frauen, die wie Männer arbeiteten, lebten und deren Kleidung trugen. Sie schnitten sich die langen Haare ab, die wie kaum etwas anderes für Weiblichkeit standen. Manche trugen Mönchskutten, um ihre doppelte Berufung zu unterstreichen. Sie hatten ihre Natur verleugnet, um Gott zu dienen. Oftmals stellte man erst bei ihrem Tod fest, dass es sich um Frauen handelte.
Ein anderes angelsächsisches Bußbuch verweist auf einen verheirateten Mann, der Gefallen am Sex mit männlichen Partnern findet, und erwähnt den aggressiven waepnedman (waepned im Sinne von Waffen oder Rüstung), der mit ähnlich maskulinen Männern verkehrt. Viele Aspekte der modernen schwulen Lebensweise sind also im London des 1. und 2. Jahrhunderts gewissermaßen schon angelegt. Ausdrücke wie baedling und mollis deuten auf eine dauerhafte sexuelle Identität hin, auf eine unterschwellige Subkultur, die im angelsächsischen London den strengen Gesetzen der Kirche zum Trotz gedieh. Doch mit den Vorstellungen und Erklärungen des 20. Jahrhunderts können wir nicht darauf zugreifen. Ob die Beteiligten »queer« waren oder nicht, vermochte niemand zu sagen. Es war auch nicht relevant. Das Wort und auch das Konzept dahinter waren völlig unbekannt.
Manche Bußbücher sahen relativ milde Strafen vor. So büßten Frauen 160 Tage lang für Sex mit ihresgleichen, während Männer ein Jahr lang fasten und beten sollten. Doch die Strafen standen in keinem Verhältnis. Ein Priester, der auf die Jagd ging, büßte dafür zum Beispiel drei Jahre. Das eigene Geschlecht zu lieben war wahrscheinlich nicht mehr oder weniger verwerflich als außerehelicher Sex – und natürlich war Ersteres für Kleriker interessanter. Als Vorbild dienten ihnen wohl Heiligenpaare wie die Soldaten Juventinus und Maximus, deren brüderliche Zuneigung der Grenze zur gleichgeschlechtlichen Liebe gefährlich nahe kam. Auch England selbst bot zahlreiche Verlockungen; seine Bewohner »waren lüstern wie das Volk von Sodom«, wie Bonifatius im Jahr 744 meldete. Der frühmittelalterliche englische Geistliche Alkuin, der eher in York als in London zu verorten ist, schrieb einen überschwänglichen Brief an einen anderen Mann; er wolle ihm über die Brust lecken und die Finger und Zehen küssen. Angeblich handelte es sich um eine in Briefen übliche Ausdrucksweise, aber die explizite Sprache weckt Zweifel daran, wo die Konvention endet und die private Leidenschaft beginnt. »Das tiefste weltliche Gefühl dieser Zeit ist die Liebe zwischen Männern«, bemerkte schon C. S. Lewis in seinem Werk The Allegory of Love (1936).
Das lässt sich auch von den zahlreichen Invasoren behaupten, die London in den nachfolgenden Jahrhunderten eroberten und besetzten, darunter die Wikinger und Normannen. Die altnordischen Schimpfwörter ergi und argr spielten auf homoerotisches Begehren und Verrat an der Gemeinschaft an. Das Altnordische hatte Bezeichnungen für den aktiven und passiven männlichen Sexualpartner, doch Verbannung und Tod drohten paradoxerweise ausgerechnet demjenigen, der einen anderen der Sodomie beschuldigte. Der Akt selbst stand nicht unter Strafe. Die Wikinger waren in sexuellen Fragen womöglich so unbekümmert, wie man es Seemännern gemeinhin nachsagt – schließlich hatten sie das Meer im Blut. Ihre Legenden sind voller Anspielungen auf koerleikr, was als Liebe zwischen Männern ausgelegt werden kann.
Ein medizinischer Leitfaden erwähnt zu Beginn des 11. Jahrhunderts »eine Krankheit, die einen Mann befällt, auf dem häufig andere Männer liegen. Er hat großes sexuelles Verlangen und reichlich Sperma, das nicht bewegt wird.« Jenen, »die diese Menschen zu erretten suchen«, wird nahegelegt, die Krankheit sei »eine eingebildete. Sie ist nicht natürlich. Das einzige Heilmittel besteht darin, ihr Verlangen mittels Trübsal, Hunger, Schlafentzug, Gefangenschaft und Peitschenhieben zu brechen.« Wieder einmal zeigt sich, dass sexuelle Passivität als bedrohlicher und verderblicher empfunden wurde als sexuelle Aktivität. »Trübsal« kann hier auch Ernst oder Seriosität bedeuten – nebst vielem anderen machte sich der queere Mensch der Unbeschwertheit schuldig.
Spätestens im 12. Jahrhundert standen normannische Edelmänner, Prinzen und Könige allesamt unter Verdacht, das eigene Geschlecht zu lieben. Wie konnte es anders sein in einer militärischen Gemeinschaft, die auf Treue und Freundschaft zwischen Männern basierte? Tatsächlich waren die Normannen für ihre sexuellen Vorlieben berüchtigt. Willige Knaben gab es zuhauf nahe der Festungen Montfichet Tower, Baynard’s Castle und der Anlage am südöstlichen Mauerabschnitt, später bekannt als Tower of London.
Wilhelm I., auch Wilhelm der Eroberer, gehörte nicht dazu, aber sein Sohn, Wilhelm II. oder Wilhelm Rufus, war den Praktiken Sodoms nicht abgeneigt. Er heiratete nie und hatte keine Kinder, was für einen König höchst ungewöhnlich war. Auch wenn sie ihre Frauen nicht ausstehen konnten, kamen die meisten ihrer Pflicht nach und führten ihr Geschlecht fort. Doch Wilhelm II. umgab sich Chronisten zufolge mit »Weiblingen«, die einen affektierten Gang hatten und wallende, extravagante Kleidung trugen. Seine Freunde hatten eine Vorliebe für weiche Gewänder und Liegestätten, trugen enge Hemden und Tuniken. Ihre Schuhe liefen an den Zehen spitz zusammen. Bänder schmückten ihr langes Haar, das ihnen in Wellen auf die Schultern fiel. Lockeisen kamen regelmäßig zum Einsatz, genau wie später zur Regierungszeit Johann Ohnelands. Der englische Geschichtsschreiber Wilhelm von Malmesbury berichtet, dass die Jünglinge oft nackt waren und darum wetteiferten, wer die weichste Haut besaß; demnach war »ihr Gang durchsetzt von schamlosen Gebärden«. Angeblich löschte man nachts die Lampen am Hof, um im Schutz der Dunkelheit sexuelle Sünden zu begehen. Doch das ist beileibe nicht die einzige Erklärung. Die jungen Männer mögen auch »Weiblinge« genannt worden sein, weil sie den Frauen über das gesunde Maß hinaus zugetan waren, und die Gerüchte über Homosexualität waren womöglich nur Teil der Propaganda gegen die normannischen Herrscher. Entsprechend sind sie mit Vorsicht zu behandeln.
Gleichwohl galt der König als schlechtes Vorbild für seine Untertanen, und die freimütigeren anglonormannischen Kleriker griffen ihn darum heftig an. Der 1093 zum Erzbischof von Canterbury ernannte Anselm predigte vehement gegen das lange Haar der Höflinge und appellierte an Wilhelm II., eine Versammlung einzuberufen, die sich mit den Übeln im Reich befasste, im Besonderen mit dem »schändlichsten Verbrechen der Sodomie«. Der König befahl dem Erzbischof, in der Angelegenheit zu schweigen. Das wäre gar nicht nötig gewesen: Anselms Biograf Eadmer berichtet, dass lange Haare zur Mode wurden und so beliebt waren, dass kurzhaarige Höflinge als »Bauerntölpel« oder »Priester« bezeichnet wurden. »Wenn Ihr die Sitten des Hofs nicht beherrscht, was habt Ihr dann dort zu suchen?«, lautete die Frage.
Nach der Ankunft der Normannen verbreitete sich Homosexualität in England angeblich wie ein Lauffeuer. Sie galt als städtisches Phänomen, vor dem auch die Klöster in Bermondsey, Aldgate, Clerkenwell, Shoreditch, Cornhill, Holborn und Cripplegate nicht gefeit waren. Sogar im weit entfernten Yorkshire erlaubte der Abt von Rievaulx seinen Mönchen, ihre gegenseitige Zuneigung durch Händchenhalten auszudrücken – nach dem Vorbild der innigen Liebe Jonathans für David, die diesem »köstlicher als Frauenliebe« war. Wie musste es da erst in London selbst ausgesehen haben, im Zentrum der unersättlichen Sünde? Ein Manuskript aus dem 11. Jahrhundert zeigt eine zusammengekauerte Gruppe von Sodomiten, die einander eindringlich anstarren. Wilhelm Rufus ließ in London zahlreiche Klöster errichten, die junge Männer und Knaben in Kontakt brachten. Sodomie war vielleicht nicht ihr Zweck, aber Sodomie war die Folge. Uns begegnet ein gewisser Robert Badding; sein Name erinnert an baedling und deutet auf einen verweichlichten Mann hin. Er war bei Weitem nicht der Einzige.
Was bleibt, sind die Witze und Anspielungen auf »widerliche Buhlknaben«, »abscheuliche Ganymeds«, »Weiblinge« und »Sodomitersachen«. Man ging stets vom Schlimmsten aus. Mönche sowie ihre Schüler und Novizen wurden auf offener Straße beleidigt. Der heilige Bernhard von Clairvaux ging mit einem jungen Krüppel ins Bett und versuchte vergebens, ein Wunder zu bewirken. Der Chronist Walter Map stellte fest, dass »er von allen Mönchen der größte Pechvogel war, denn ich habe schon davon gehört, dass ein Mönch sich auf einen Knaben stürzte, aber immer wenn sich der Mann erhob, erhob sich der Knabe mit ihm«. Man war sich einig, dass die Mönche es miteinander trieben – und wenn nicht, dann stimmte etwas mit ihnen nicht. Das kommt dabei heraus, wenn eine gesellschaftliche Gruppe oder Institution für gleichgeschlechtliche Beziehungen in besonderem Maße prädestiniert erscheint.
3 EIN MILITÄRISCHES GLIED
Im Jahr 1102 fand in London eine Synode statt; damit gehörte die Stadt endgültig zu den bedeutendsten des Heiligen Römischen Reichs. Zwei Jahre nach dem Tod von Wilhelm Rufus ging Anselm nun entschieden gegen Sodomie vor, wie es die längste Zeit sein Ziel gewesen war. Sein Anliegen stand im Mittelpunkt der Versammlung und erschien nur angemessen in einer Stadt, in der entsprechende Praktiken weitverbreitet waren. Doch ein Edikt, das »die schändliche Sünde der Sodomie« verurteilte, blieb weitgehend folgenlos. Selbst Anselm musste zugeben, dass »diese Sünde bisher so öffentlich war, dass sich kaum einer ihrer schämte und viele ihr verfielen, ohne sich der Schwere bewusst zu sein«. Roger von Chester berichtete, dass immerhin »sechs Äbte und eine große Zahl einfacher Priester und Ordensbrüder schuldig gesprochen wurden«. Im frühen Mittelalter erließ man gerne strenge Edikte und drohte mit drastischen Strafen, um nicht in die Verlegenheit zu kommen, tatsächlich handeln zu müssen. Geldbußen waren viel praktischer. Der neue König Heinrich I. konnte sicher jeden Penny gebrauchen, den er dem Klerus für seine abscheulichen Laster abluchste. Zu gerne hätte man den Männern auch die langen Haare abgeschnitten und die »ziegen- und sarazenenhaften Bärte« rasiert, doch dies wurde selbstredend nicht weiter verfolgt.
Ein solches Verbot hätte man gegen den Widerstand der Ritter, die sich um jeden neuen König scharten, ohnehin nicht durchsetzen können. Die Grabfigur von Richard Löwenherz in der Abtei Fontevraud stellt den König mit wallendem Haar und Vollbart dar. Richard I. wurden über die Jahrhunderte immer wieder homosexuelle Neigungen unterstellt; er selbst haderte oft mit »dieser Sünde«, wie er ausweichend kundtat. Als Herzog von Aquitanien pflegte er eine so enge Freundschaft zu Philipp II. von Frankreich, dass sein Vater Heinrich II. »höchst erstaunt war über die leidenschaftliche Liebe der beiden und sich sehr darüber wunderte«. Nicht einmal des Nachts trennten sich die beiden. Doch vielleicht steckte auch politische Strategie dahinter. Warum sollte man sonst mit einem König schlafen? Darüber hinaus interessierte sich Richard angeblich für den jungen Ritter Raife de Clermont, den er aus Gefangenschaft rettete.
Die tiefe Verbundenheit, die in Feudalstaaten zwischen Männern militärischen Rangs besteht, wirft seit jeher Fragen auf. Ritterliche Kameradschaft scheint keine Grenzen zu kennen, und der Austausch von Blicken lässt sich als Form der Berührung deuten. Sir Launfal, Held der gleichnamigen anglonormannischen Dichtung, muss sich den Vorwurf anhören, dass »es Euch nicht nach einem Weib verlangt. Ihr habt gut ausgebildete junge Männer und vergnügt Euch mit ihnen.« Was blieb einem auch anderes übrig? Man lebte, aß, schlief und jagte schließlich gemeinsam. Die gegenseitige Zuneigung der Krieger bildete die Grundlage des feudalen Zusammenhalts. Die chansons und lais feierten die Liebe zwischen Kameraden sowie die eines älteren Mannes für einen jüngeren. Hatte ein Knabe das Alter von sieben Jahren erreicht, galt er als empfänglich für die »Sünde wider die Natur«. Viele Sagen beschäftigen sich ausschließlich mit der homosozialen Gemeinschaft. »Männer liebten Männer« (wapmon luuede wapmon) und verabscheuten Frauen – so beschreibt Layamon die Gepflogenheiten des Hofs in seinem Werk Brut, einer Geschichte Englands in Versform, deren Anfänge ins späte 12. Jahrhundert zurückreichen.
Junge Ritter verbrachten auf diese Weise bis zu zwanzig Jahre miteinander und waren in dieser Zeit kaum eine Minute getrennt. Der Chronist Ordericus Vitalis berichtet von einer Gruppe junger Kameraden, die ihr Zuhause in Chester – oder Cester – verließen und »wie aus den Flammen Sodoms« (quasi di flammis Sodomiae) wieder zurückkehrten. Sir Thomas Malory erzählt von Ritterspielen mit als Frauen verkleideten Teilnehmern. Dies geschah nach alter Tradition: Die Wettbewerbe erweckten eine Scheinwelt zum Leben, in der Geschlecht etwas Mehrdeutiges war. In jener Epoche verfasste der Sänger »Hilarius der Engländer« Loblieder auf die Schönheit der Jungen; zwei Gedichte richtet er an goldgelockte englische Knaben von lieblicher Gestalt, die als Mundschenk und Bettgenosse zugleich dienen. Der englische Geistliche Johannes von Salisbury beschreibt nicht ohne Interesse einen »Buhler«, der die Hände und Beine seines Liebesobjekts zu streicheln und umspielen beginnt: »Er gewinnt an Mut; erlaubt seiner Hand, den ganzen Körper unsittlich zu berühren, und fördert die Erregung, die er weckte, und fächelt die Flamme der abflauenden Lust.«
London hatte eine rasante Entwicklung durchlebt, mit all den Problemen, die das mit sich brachte: Überbevölkerung, Armut und Krankheit. Dabei entstanden unweigerlich auch sexuelle Freiräume. Angeblich gab es hier so viele Sodomiten »wie Gerstenkörner, Muscheln im Ozean oder Sand am Meer«. »Da rotten sich alle möglichen Männer sämtlicher Länder unter den Himmeln zusammen … an jeder Ecke tragen sich unsägliche Obszönitäten zu«, berichtete Richard von Devizes, ein Chronist aus dem späten 12. Jahrhundert. Er beschreibt glabriones (Milchgesichter), pusiones (Strichjungen), molles (Weichlinge) und mascularii (Männerliebhaber). Es scheint fast so, als schildere er den Londoner Dauerzustand über Jahrhunderte hinweg.
Wir können nach so langer Zeit keinen Blick in die einzelnen Häuser werfen, wie ihn die Literatur gerne imaginiert, doch wir können uns aus der Ferne ein Bild des städtischen Lebens machen. Männliche Bedienstete teilten sich für gewöhnlich eine Schlafkammer, und auch in Gasthäusern war es üblich, dass männliche Gäste im selben Zimmer übernachteten und darüber hinaus nackt schliefen. Der Herr des Hauses konnte seinen Neigungen ungehindert nachgehen. Meister und Lehrling teilten sich oft ein provisorisches Bett. Überhaupt standen die Betten überall im Haus herum, und das Konzept von Privatsphäre war völlig unbekannt. Man lebte in einer öffentlichen und in jeder Hinsicht sozialen Welt.
Lehrer interessierten sich nicht nur für die Hirne, sondern auch für die Hintern ihrer jungen Schüler. Man war sich im Allgemeinen einig, dass der Adel und der hohe Klerus sich mit dem eigenen Geschlecht vergnügten. An den zwei Universitäten teilten sich Studenten ein Bett, und sei es auch nur, um sich warm zu halten. Öffentliche Bäder nach dem Vorbild der türkischen hammam wurden errichtet, die sämtliche Vorzüge der östlichen Welt boten – eines der eher sybaritischen Vermächtnisse der Kreuzzüge.
Die zahlreichen Nischen der im Jahr 1209 fertiggestellten London Bridge dienten unter anderem als öffentliche Toiletten. Ein Gerichtsverfahren aus dem Jahr 1306 belegt, dass diese ausreichend Gelegenheit zu Stelldicheins und heimlichen Abgängen boten. Der Kläger ließ den Angeklagten von seinem Diener verfolgen, »der ihm mehrere Straßen lang nachging, bis sie zur London Bridge gelangten, wo er [der Angeklagte] dem Diener zu warten beschied, während er dort den Abtritt aufsuchte … diesen aber dann durch einen anderen Eingang verließ«. Auch in Queenhithe an der Themse wurde 1237 eine Bedürfnisanstalt ausgebaut, die zweifellos von den üblichen Verdächtigen frequentiert wurde.
Anklageschriften aus dem Jahr 1339 geben skizzenhaft Auskunft über den queeren Alltag in den überfüllten und schmutzigen Straßen Holborn, Chancery Lane, Shoe Lane und am River Fleet. Gilbert le Strengmaker wurde beschuldigt, in seinem Haus »Hospital Rents« in der Fleet Street »übel beleumdete Männer« zu beherbergen. Es handelte sich wohl um ein Bordell. Die Schwestern Agnes und Juliana aus Holborn waren aus dem gleichen Grund angeklagt. In der Chancery Lane, in der Fetter Lane, in der Shoe Lane und in der Hosier Lane befanden sich verdächtige Häuser. Die übel beleumdeten Männer mögen ganz gewöhnliche Diebe oder Räuber gewesen sein, doch der Kontext lässt etwas anderes vermuten.
Die Atmosphäre war angespannt, und die kuriosen gegenseitigen Anschuldigungen verschiedener religiöser Genossenschaften trugen nicht gerade zur Entschärfung bei. Als ein gewisser Peter Pateshull 1387 auf der Kanzel der Kirche St Christopher’s gegen die Augustinermönche predigte, attackierten seine Anhänger, die Lollarden, die Ordensbrüder mit dem Ruf Incendamus sodomitas – brennen sollen die Sodomiten! 1395 schlugen die Lollarden während einer Parlamentssitzung ihre zwölf Thesen an den Portalen der Westminster Hall an und verkündeten: »Das englische Volk beklagt das Verbrechen von Sodom.« Die dritte »These« bezeichnet Sodomie als mögliche Folge der Schlemmerei. Die verzehrten Speisen müssten erbrochen und abgeführt werden – eine Metapher für den sexuellen Frevel der Sodomiten. »Diese Männer sind an ihrer Abneigung gegen das Weib zu erkennen«, heißt es weiter, »und wenn Ihr einen solchen Mann überführt, so kennzeichnet ihn entsprechend, denn er ist einer von ihnen«. Sodomie war eine priue synne, eine heimliche Sünde. Sie fand im Verborgenen statt, ähnlich wie das Schattenleben des Häretikers. »Die Rasse der Lollarden ist die abscheuliche Rasse von Sodom«, heißt es wiederum in einem anonymen Gedicht. Die Anschuldigung war allgegenwärtig, gerade weil sie so schwer zu fassen war.
Die meisten Randgruppen galten zu irgendeinem Zeitpunkt als Ketzer, was unweigerlich den Vorwurf der Sodomie nach sich zog. Angeblich war es eine Weisung der Tempelritter, hinauszuziehen und miteinander in Sünde zu verkehren; einem anderen Gerücht zufolge verpflichtete sie ihr Orden zum Beischlaf. Das ist reine Spekulation. Überliefert ist, dass der Londoner Notar Robertus le Dorturer ein Ordensmitglied der versuchten Sodomie beschuldigte. Auch ein Stadtbewohner namens Johannes de Presbur sagte aus, ein Tempelritter hätte einem seiner Verwandten sexuelle Avancen gemacht. Diese zwei Vorfälle lassen aber keineswegs auf einen allgemeinen Ausbruch der Sodomie rückschließen.
Der regierende König Eduard II. schenkte den Berichten jedenfalls wenig Glauben und scheute sich, den Templern den Prozess zu machen. Er hatte wohl Verständnis für ihre Notlage, wenn auch nicht für ihre Neigungen. Während sie in Paris in großer Zahl verbrannt wurden, verschonte man sie in London. Die Gerichte in Westminster schickten die Verurteilten stattdessen ins Exil nach Ponthieu, eines der französischen Hoheitsgebiete des Königs.
Auch Frauen blieben nicht verschont. Die elfte der zwölf Thesen der Lollarden bezieht sich auf die »geheimen Sünden« der Kirchenfrauen; demnach sei das weibliche Geschlecht »von Natur aus wankelmütig und unvollkommen« und verantwortlich »für den Einbruch der abscheulichsten aller Sünden über die Menschheit«. Die Schrift lässt keinen Zweifel daran, worin diese Sünde besteht. Die Ancrene Riwle, ein spiritueller Leitfaden für Englands Klosterfrauen aus dem frühen 13. Jahrhundert, erwähnt den »Skorpion stinkender Unzucht« – und beteuert noch im gleichen Satz, jenen ausdrücklich nicht zu erwähnen. Abermals ist die Anspielung auf gleichgeschlechtliches Begehren unmissverständlich. Das Mittelalter umschrieb das wohlvertraute Phänomen als mulier cum muliere fornicans (eine Frau, die mit einer anderen »unzüchtigt«) sowie mulier cum muliere fornicationem committens (eine Frau, die mit einer anderen Unzucht begeht). Gerüchten zufolge mischten Frauen ihren Speisen Sperma bei, um männlicher zu werden, und fertigten ein »schwergewichtiges Machwerk in Gestalt des männlichen Gliedes« an. Frauen galten als sexuell unersättlich; sie konnten also gar nicht anders, als miteinander ins Bett zu springen. Die Frage, ob sie lesbisch oder queer waren oder wie auch immer wir es heute nennen möchten, stellte sich gar nicht. Sie folgten einfach ungehindert ihrer vermeintlichen weiblichen Natur, die auf Evas ursprüngliche Sünde der Lust, oder vielmehr der Neugier, zurückzuführen war.
Als das 13. Jahrhundert sich dem Ende zuneigte, nahm die allgemeine Missbilligung konkrete Formen an. Bereits 1250 hatte Fulk Bassett, der Bischof von London, zur Bestrafung der Sodomiten aufgerufen. Der Zorn des Klerus wuchs. Das Rechtsbuch Britton forderte den Feuertod als Strafe für Sodomie. Die Abhandlung Fleta aus dem Jahr 1290 – benannt nach der Londoner Fleet Street, wo der Autor wohnte – verlangte, verurteilte Sodomiten sollten lebendig begraben werden. Anscheinend hatte es einen juristischen Sinneswandel gegeben, für den schon verschiedenste Gründe angeführt wurden: die Vormachtstellung der Kirche, die Bedrohung durch die Türken im Osten oder auch die Zunahme zentralisierter Monarchien. Doch die Gesetze sollten wohl vor allem Angst einflößen. Zumindest sind aus London keine Feuertode oder Lebendbegräbnisse überliefert. In Texten aber konnte man sich genüsslich seinen Rachegedanken hingeben: In der Legenda aurea aus dem Jahr 1260 heißt es etwa, mit der Geburt Christi seien sämtliche Sodomiten plötzlich zu Tode gekommen.
4 DER FREUND
Piers Gaveston, der jüngere Sohn eines Ritters aus der Gascogne, trat 1297 als Soldat der englischen Armee in Flandern in den Dienst von Eduard I. Der König aber war von der Eleganz und Haltung des jungen Mannes beeindruckt und berief ihn schon bald an den Hof des Prinzen von Wales – vermutlich in der Hoffnung, seine Manieren und sein vorbildliches Betragen würden auf seinen Sohn abfärben. Doch dem Anschein nach wurde Prinz Eduard von seinem neuen Gefährten in ganz andere Bereiche eingeführt, was den König dazu veranlasste, Gaveston vorübergehend zu verbannen. Er erhielt eine jährliche Zahlung unter der Bedingung, »sich in Gebieten jenseits des Meeres aufzuhalten, solange der König es wünscht, und auf seinen Rückruf zu warten«. Offenbar versuchte der König, ihn von seinem Sohn fernzuhalten – eine Strafe, die wohl eher den Prinzen treffen sollte.
Behauptungen zufolge waren die jungen Männer kein Liebespaar, sondern sworn brothers, also in Schwurbrüderschaft verbunden. »Als der Blick des Königssohns ihn traf, empfand er just so viel Liebe, dass er einen Bund der Bruderschaft mit ihm einging und fest entschlossen war, sich vor allen Sterblichen mit einem unlösbaren Band der Liebe an ihn zu binden«, berichtet ein anonymer Chronist. Sie wurden zu wedded brethren – ein Bund, der tatsächlich vor dem Altar geschlossen werden konnte. Diese Erklärung gibt einerseits Aufschluss über die komplexen männlichen Beziehungen, die das frühe 14. Jahrhundert prägten. Andererseits unterstreicht sie die schmale bis gar nicht vorhandene Grenze zwischen Kameradschaft und gleichgeschlechtlicher Liebe. Chronisten beschreiben die Beziehung zwischen Eduard II. und Gaveston als »ausschweifend« und »maßlos«, was darauf hindeutet, dass sie über ritterliche Freundschaft hinausging. Auch Richard II. machte man die »obszöne Vertrautheit« mit seinem Günstling Robert de Vere zum Vorwurf. Anschuldigungen dieser Art gehörten also geradezu zum Berufsrisiko junger Könige und ihrer Gefährten.
Als sein Vater im Jahr 1307 starb, rief Eduard II. Gaveston zurück, ernannte ihn zum Grafen von Cornwall und überhäufte ihn mit Reichtümern. Die beiden Männer waren unzertrennlich und zogen zunehmend den Zorn der mächtigen Barone auf sich. Als der König nach Frankreich aufbrach, wurde Gaveston in seiner Abwesenheit als Regent (custos regni) eingesetzt, was seine Rivalen nur noch mehr gegen ihn aufbrachte. Die Hochzeit von Eduard und Isabelle von Frankreich zeigte deutlich, wie nahe sich König und Graf standen: Bei den Feierlichkeiten zur Krönung des Paares nahm Gaveston eine entscheidende Rolle ein und zog die Aufmerksamkeit des Königs in so hohem Maße auf sich, dass Isabelles Verwandtschaft das Fest entrüstet verließ.
Ein Ende mit Schrecken war vorprogrammiert. Im Jahr 1308 forderten die Barone des Reichs, den Günstling einmal mehr ins Exil zu schicken und drohten unterschwellig mit einem Bürgerkrieg, sollte der König die Verbannung nicht anordnen. Er war gezwungen nachzugeben, ernannte seinen Schützling aber bereits einen Monat später zum Leutnant in Irland. Gaveston kam nach England zurück, wurde aber 1311 abermals ins Exil gezwungen. Doch die Liebe des Königs war ihm noch immer gewiss, sodass er zu Beginn des Jahres 1312 ein letztes Mal wiederkehren durfte. Daraufhin wurde er von den Baronen gestellt, verhaftet und am 19. Juni 1312 vom Grafen von Warwick enthauptet.
Der Fall ist der erste in der englischen Geschichte, bei dem Chronisten auf eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen König und Höfling anspielten oder hinauswollten. Der anonyme Autor einer Biografie Eduards II. merkt an: »Ich kann mich nicht erinnern, je von einem Mann gehört zu haben, der einen anderen so sehr liebte … zur Förderung in Maßen war unser König nicht fähig und Piers bewirkte wohl, dass er sich selbst vergaß. Und so hieß man Piers einen Zauberer.« Er konnte sich sicher sein, dass seine Leser die Anspielung auf Sodomie verstanden, die mit dem Vorwurf der Zauberei eng verknüpft war. Eine Chronik der Zisterzienser verzeichnet, dass Eduard in vitio sodomitico nimium delectabat, dass er also mit anderen Worten in Sodomie schwelgte. Das hielt ihn natürlich nicht davon ab, fünf Kinder zu zeugen, von denen eins unehelich war. Wir müssen unser modernes Verständnis von Begriffen wie »schwul« oder »queer« grundsätzlich überdenken, wenn wir die Vergangenheit verstehen wollen.
5 BRUDERLIEBE