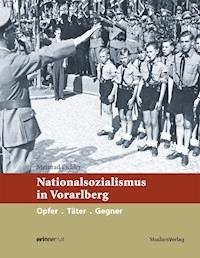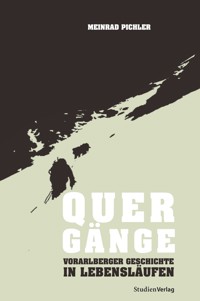
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Anhand von 16 Lebensläufen erzählt der Historiker Meinrad Pichler eine Vorarlberger Regionalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Es geht um Wanderarbeiter und Stadtdamen, um Industriepioniere und Landstreicher, um kämpferische Engagierte und Kollaborateure, um Diener und Herren. Kurz: um bewegte Biografien, die jeweils auch die Hinter- und Abgründe ihrer Zeit widerspiegeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2019 by Studienverlag Ges.m.b.H., Erlerstraße 10, A-6020 Innsbruck
E-Mail: [email protected]
Internet: www.studienverlag.at
Unveränderte Neuauflage der 2007 im Bucher Verlag Hohenems erschienenen Ausgabe.
Gestaltung: Rita Bertolini, Bregenz
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7065-5738-2
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.studienverlag.at
INHALT
DER QUERGEIST WEHT, WO ER WILL
Zu Meinrad Pichler und seiner Geschichtsschreibung Kurt Greussing
IM DIENSTE SEINER MAJESTÄT
Kammerdiener Kaspar Kalb (1756–1841) aus Wolfurt
ABGESCHOBEN – ABGEHAUEN
Von einem Leben auf Straßen und in Kasernen, auf Schub und auf der Flucht: Josef Anton Breuss (geb. 1826) aus Feldkirch
KAFFEE MIT BEIGESCHMACK
Lazarus Gruber (1811–1899) aus Lochau und die Durchsetzung der Industrialisierung auf dem Dorfe
DER GESCHEITERTE PHILOSOPH DER FREIHEIT
Augustin Lorenzi (1822–1853) aus Bludenz
VOM OBSERVIERTEN REVOLUTIONÄR ZUM EHRENBÜRGER
Der ungewöhnliche Landpfarrer Johann Georg Hummel (1808–1888) aus Bregenz
DER EINSAME RUFER AM MISSISSIPPI
Johann Josef Rhomberg (1836–1899), der Dichter aus Dornbirn
FELDERS FREUND, DER „FREMDLER“
Josef Natter (1846–1928) aus Schoppernau
SELBSTVERWIRKLICHUNG IM DIENST AN ANDEREN
Leben und Werk der Bregenzer Sozialarbeiterin Agathe Fessler (1870–1941)
EIN BOHEMIEN IN DER KLEINSTADT
Professor Paul Pirker (1880–1963) aus Bregenz
„… WEIL WIR DER ANSICHT SIND, DASS AUCH EIN GETAUFTER JUDE NACH WIE VOR EIN JUDE BLEIBT“
Regina Guggenheim (1875–1956) aus Bregenz: Stationen eines Kreuzwegs
BREGENZ – BERLIN
Ortswechsel für den Standpunkt: Franziska Vobr (1910–1987)
DER VORZUGSSCHÜLER IM WIDERSTAND
Gelebte Humanität, praktiziertes Christentum: Josef Anton King (1922–1945) aus Hörbranz
ZWISCHEN ALLEN FRONTEN
Aufstieg und Fall des Arbeiterfunktionärs Meinrad Hämmerle (1901–1973) aus Dornbirn
BAUEN UM JEDEN PREIS
Dipl.-Ing. Alois Tschabrun (1900–1994) aus Nenzing und die Selbsthilfe
DER FREMDE
Der weite Weg des Adolf Mayer (1918–1996) von Bludenz nach Götzis
GRENZ-ERFAHRUNGEN
Die Fluchten des Hilar Huber (1920–2001) aus Höchst
Nachweise und Abkürzungen
Ortsregister
Personenregister
DER QUERGEIST WEHT, WO ER WILL
ZU MEINRAD PICHLER UND SEINER GESCHICHTSSCHREIBUNG
Kurt Greussing
Mit dem Hegelschen Weltgeist, der durch die Geschichte weht und sie angeblich zu einem vernünftigen Ende führt, hat Meinrad Pichler nichts im Sinn. Dabei ist auch die Vorarlberger Geschichtsschreibung vom Wehen dieses Weltgeistes nicht verschont geblieben, allerdings eher in seiner Vorstufe eines Regionalgeistes: Auch hierzulande wurde und wird Geschichte unter den Auspizien eines vernünftigen Endes geschrieben, wobei natürlich die Vernunft je nach Schreiber und Zeitläuften immer wieder andere Gestalt annimmt: als Vorstellung alemannischer Identität und Selbständigkeit (so die herrschende Geschichtsschreibung nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der achtziger Jahre), als das Zusammenwachsen mit dem Hause Österreich und die folgende Mitarbeit am Aufbau der Republik, schließlich als die Entfaltung von Industrie und wirtschaftlicher Modernisierung.
Man kann nun freilich auch einen anderen Blick auf die Geschichte entwickeln: nicht von den großen Entwicklungstendenzen ausgehend, sondern von den Möglichkeiten, sich herrschenden Zwängen zu widersetzen; nicht von den Fesseln der jeweiligen sozialen Lage eines Menschen, sondern von dessen Anstrengung, eben diese Fesseln zu sprengen; nicht von den großen Gestalten, die meist erst im Rückblick zu solchen geworden sind, sondern von den unbedeutend und oft ungenannt Gebliebenen, deren Leben dennoch prall von Geschichte ist. Das ist ein vorweggenommenes Resümee der historiographischen Arbeit von Meinrad Pichler: Der Quergeist weht, wo er will, in der Gesellschaft wie in ihrer Beschreibung – wenn der Historiker sich denn die Mühe macht, dessen eigenständigen, darum auch immer eigenartigen Wegen nachzuspüren.
Nicht der Geist der vorherbestimmten und vorherbestimmenden Vernunft, sondern der Quergeist wehte auch im Leben von Meinrad Pichler. Er stammt, 1947 geboren, aus einer Bauernfamilie. Den elterlichen Hof in Hörbranz hat der ältere Bruder übernommen. Dass der Zweitälteste nun nicht einfach einen anderen dörflichen Beruf ergriffen hat, dazu haben seine Eltern Josefine und Franz Pichler wesentlich beigetragen. Sie haben ihm eine Gymnasialausbildung und ein Studium ermöglicht – letzteres auf seinen Wunsch in Wien, also nicht auf der damals vorgegebenen, sicher scheinenden Bahn der „Landesuniversität“ im nahen Innsbruck.
Der Vater war lebenslang „Legitimist“, das heißt bekennender Monarchist, und damit gerade in der nationalsozialistischen Zeit, aber auch nach dem Krieg ein ortsbekannt lautstarker wandelnder Widerspruch zu den herrschenden Verhältnissen. Die Mutter, mit ausgeprägtem literarischen Interesse, hätte vielleicht die Ausbildung des Sohnes zu einem Geistlichen im Sinne gehabt – noch in den sechziger Jahren eine verbreitete Variante von Bildungskarrieren aus dem bäuerlichen Milieu heraus. Doch damit ist es bei Meinrad Pichler nach seiner Matura am Bregenzer Gymnasium und durch sein Deutsch- und Geschichtestudium in Wien nichts geworden, zu dominant war wohl das zugrunde liegende väterliche Erbe der Quergeistigkeit.
Woher er kam, hat er aber nie vergessen, und das spielt vor allem in seinen historischen Arbeiten eine Rolle: Ihr Thema sind immer wieder die „einfachen Leute“ – besonders nachdrücklich in seinem Text-Bild-Band „Bei der Arbeit Bilder aus der Vorarlberger Arbeitswelt von 1880 bis 1938“ (Bregenz 1989), aber nicht weniger in den weitgreifenden historischen Themen, die er bearbeitet hat: Widerstand und Verfolgung im Nationalsozialismus, Vorarlberger Auswanderung in die USA bis 1938 – und immer wieder neu: Biographien ungewöhnlicher, weithin unbekannter Frauen und Männer, deren Lebensschicksale über das Individuelle hinaus jeweils von Vorarlberger Geschichte berichten.
Der vorliegende Band vereint mit seinen sechzehn Beiträgen über einen Zeitraum von zweihundert Jahren Herausragendes, wenngleich lange nicht Erschöpfendes aus diesem Schaffen. Methodisch ist das keine Strukturgeschichte, bei der die einzelnen Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen individuellen Schicksalen hinter den großflächigen sozialen Entwicklungen verschwinden, sondern eine stark auf einzelne Lebensläufe bezogene dichte Beschreibung, bei der allerdings immer auch das Typische und Exemplarische der sozialen Verhältnisse und der herrschenden Ideologien und Mentalitäten herausgearbeitet wird.
Angefangen hat Meinrad Pichlers quergeistige Beschäftigung mit Vorarlberger Geschichte 1982 mit einem bahnbrechenden Aufsatz in dem von ihm herausgegebenen Sammelband „Nachträge zur neueren Vorarlberger Landesgeschichte“ (Bregenz 1982, 2. Auflage 1983). Dieses Buch kann überhaupt als der Beginn einer kritischen Betrachtung der Landesgeschichte für den Zeitraum nach der Entstehung einer modernen Parteienlandschaft und einer diskutierenden Öffentlichkeit ab 1867 gewertet werden. Pichlers Beitrag unter dem Titel „Eine unbeschreibliche Vergangenheit“ hat dabei inhaltlich prägnant und stilistisch mitreißend den bis dahin herrschenden Umgang mit der Vorarlberger NS-Vergangenheit seziert: das Verschweigen der Opfer, die Beschönigung des Terrors, das (gewollte) Unwissen über die Breite des Widerstands und der Verfolgung, die Verleugnung der einheimischen Mittäterschaft und die Delegierung von Schuld an „Landesfremde“.
Das Thema wurde noch einmal prominent und in viel größerem Umfang in dem Sammelband „Von Herren und Menschen – Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1933–1945“ (Bregenz 1985) aufgenommen. Hier entstand, in einer Kooperation von Meinrad Pichler mit Hermann Brändle, Gernot Kiermayr-Egger und Harald Walser, durch eine minutiöse Quellenarbeit, aber auch durch geschichtsschreiberische Neugier und die Bereitschaft, mit vielen Dutzend Frauen und Männern lebensgeschichtliche Interviews zu führen, ein ganz neues Bild der Geschichte der NS-Herrschaft in Vorarlberg.
Das alles war nicht eine Auseinandersetzung hoch oben in den Wolkenregionen der akademischen Forschung und des regionalwissenschaftlichen Disputs, sondern das war auch eine politische Beschneidung des historiographischen Deutungsmonopols, das Landesbeamte, Lehrer und Heimatforscher in der Öffentlichkeit bis dahin innegehabt hatten. Es ging also um die Neuverteilung von symbolischem Kapital, und um dieses wird meist nicht weniger erbittert gestritten als um materielle Ressourcen.
Folgerichtig wirkte Meinrad Pichler vom Herbst 1979 bis zum Frühjahr 1980 an vorderster Stelle der „Vorarlberger Pro Österreich“, jener Initiative von Literatinnen und Literaten, Künstlerinnen, Künstlern und Medienschaffenden, die der alemanno-nationalistischen „Pro-Vorarlberg“-Bewegung das öffentliche Terrain streitig machten. Ebenso war er eine treibende Kraft bei der Gründung der Johann-August-Malin-Gesellschaft 1982, jenes „Historischen Vereins für Vorarlberg“, der nun seit rund 25 Jahren sowohl publizistischem Wirken als auch öffentlicher Auseinandersetzung zu lange und immer wieder neu vernachlässigten Themen der Vorarlberger Landesgeschichtsschreibung – wie Antisemitismus, Austrofaschismus, Nationalsozialismus und dem noch nicht gewonnenen Kampf für die Aufklärung – ein Forum bietet.
Weil solche Auseinandersetzungen um symbolisches Kapital manchmal recht erbittert geführt werden und sie durchaus auch materielle Konsequenzen haben können, etwa die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Beschäftigungsmöglichkeiten im staatlichen oder staatsnahen Bereich, haben sich viele nicht in diese Arena gewagt. Doch die Expansion des Bildungswesens in Vorarlberg ab dem Anfang der siebziger Jahre und die rot-schwarze Machtkonkurrenz zwischen Bund und Land schufen in jenen Jahren, zumindest im Kultur- und Bildungsbereich, Freiräume, die man mit einigem persönlichen Mut nutzen konnte. Das wesentlichste Druckmittel gegen unangepasste Gymnasiallehrer bestand darin, solche freieren Denker und Akteure nicht Direktoren werden zu lassen. Und selbst da gab es, nach allerhand Streit, ein paar – ganz wenige – Ausnahmen. Meinrad Pichler ist eine davon.
Als Pädagoge unterscheidet er sich vom Historiker nur durch die Zeitperspektive, nicht durch die Wahl des Standpunkts: Menschen sollen ihre Begabungen möglichst frei entwickeln und realisieren können. Aus den vielfachen Beengungen von Lebensläufen in der Vergangenheit lässt sich lernen, wie eine andere Zukunft der heute Lebenden, der Schülerinnen und Schüler zumal, gestaltet werden soll.
Bloß auf den ersten Blick eine Verlagerung des Interesses ist Meinrad Pichlers anhaltende Beschäftigung mit den Vorarlberger Auswanderern in die USA, die 1993 zu dem großformatigen Standardwerk „Auswanderer. Von Vorarlberg in die USA 1800–1938“ geführt hat. Die ist nicht nur seiner eigenen Begeisterung für Menschen und Landschaften der USA geschuldet, sondern wiederum der Neugier auf Lebensläufe, die sich anscheinend vorgezeichneten Bahnen nicht fügen, und dem Interesse an Menschen, die als Auswanderer, also in heutiger Diktion als Wirtschaftsflüchtlinge, durch Mut und unkonventionelle Entscheidungen ihren eigenen Lebensweg zu bestimmten suchten.
Rund 90 Einträge im Katalog der Vorarlberger Landesbibliothek bezeichnen Breite und Intensität von Meinrad Pichlers geschichtswissenschaftlicher Arbeit. Alle seine Bücher und Aufsätze, besonders aber die in diesem Band versammelten, handeln von den Grenzen persönlicher Auflehnung gegen drückende politische und soziale Verhältnisse, aber vielmehr noch von den Möglichkeiten solcher Auflehnung; von der Prüfung politischer Ideologien, vor allem der herrschenden, auf ihren Wahrheitsanspruch im Handeln der Akteure; vom Umgang mit Minderheiten und Außenseitern als Prüfstein einer humanen und aufgeklärten Gesellschaft.
Meinrad Pichler ist ein formulierungsstarker und pointenreicher Erzähler, dem die Schicksale von Menschen gerne auch zu einem Stück unerwarteter Politik- und Sozialgeschichte werden. Man kann ihm Abende lang zuhören und erfährt Erstaunliches über weit zurückreichende Familiengeschichten, verwandtschaftliche und politische Netzwerke (die einander oft durchdringen und bedingen) und damit auch über ansonsten unpublizierte persönliche Hintergründe von Vorarlberger Gemeinde- und Landespolitik.
Sollte er dereinst pensioniert sein – er wird im Jahr der Herausgabe dieses Buches sechzig –, so tun sich also jungen Historikerinnen und Historikern bei ihm weite Möglichkeiten für Oral-History-Projekte auf. Dies vor allem dann, wenn ihnen, im Gegensatz zu Meinrad Pichler, die Mühen des Quellenstudiums im Archiv und das Lesen der Kurrentschrift nicht mehr Teil ihres Berufsbildes sind.
Trotz seiner Aversion gegen die politischen Forderungen des aufkommenden Bürgertums ließ sich Kaiser Franz I. um 1820 in der Wiener Hofburg ein Arbeitszimmer im Stil des Biedermeier, also nach bürgerlicher Mode, einrichten. An dem Stehpult beim kaiserlichen Schreibtisch (links) dürfte zeitweise auch der Kammerdiener Kaspar Kalb gearbeitet haben, der selbst nach seinem Tod noch Akten produzierte.
(Bildquelle: Architectural Digest)
Der Rest ist Schweigen.
– Shakespeare
IM DIENSTE SEINER MAJESTÄT
KAMMERDIENERKASPAR KALB (1756–1841)AUS WOLFURT
Das Pochen auf Kontinuität und das starre Festhalten am Überkommenen zählten zu seinen hervorragendsten Lebensund Regierungsprinzipien: Dennoch setzte der erste österreichische Kaiser Franz I. gezwungenermaßen den tiefsten Einschnitt in der langen Geschichte der habsburgischen Herrscher. Er war es nämlich, der 1806 das römisch-deutsche Kaiserreich liquidierte, nachdem er bereits zwei Jahre zuvor das Erzherzogtum Österreich zum Kaisertum ausgerufen hatte. Insgesamt war die erste Hälfte seiner über vierzigjährigen Regentschaft (1792–1835) von schweren politischen und militärischen Niederlagen und von persönlichen Demütigungen, zugefügt vom revolutionären Frankreich und seinem Schwiegersohn Napoleon, bestimmt. Die Restaurierung seiner voraufklärerischen Ideale war erst nach der Niederwerfung Napoleons und mit Hilfe seines Regierungschefs Fürst Metternich möglich. Die Jahre ab 1814 stehen für totale Reaktion, durchgesetzt mit polizeistaatlichen Methoden und schärfster Zensur. Und so wie Metternich diesem Kaiser und dessen Sache bis über dessen Tod hinaus diente, tat es zwar ohne Macht und Öffentlichkeit, aber vielleicht mit Einfluss auch ein Wolfurter: als kaiserlicher Kammerdiener.
Voraussetzung für einen solchen Posten waren neben verschiedenen Kenntnissen und Fertigkeiten vor allem Ergebenheit und absolute Diskretion. Diese Eigenschaften scheint Kaspar Kalb aus Wolfurt in sich vereinigt zu haben. Anders wäre sein beruflicher Aufstieg am Wiener Hof nicht denkbar gewesen. Ein Dasein im tiefsten Schatten des strahlenden Monarchen machte den Höfling allerdings zu seinen Lebzeiten nahezu unscheinbar, und das schlägt sich auch in der Quellenlage nieder: Wer von Berufs wegen kaum in Erscheinung treten und ja kein Aufsehen erregen darf, hinterlässt auch kaum Spuren. Massiv aktenkundig wurde der diskrete Diener erst nach seinem Tode, als sich die Erben um die Nachlassenschaft stritten.
Erstmals auf den ungewöhnlichen Sohn der Gemeinde hingewiesen hat der Wolfurter Ortshistoriker Siegfried Heim, der auch den familiären Hintergrund ausgeleuchtet hat.1 Demnach wurde Kaspar Kalb als neuntes von 17 Kindern am 9. Jänner 1756 als Sohn des Anton Kalb und der Benedikta, geb. Metzler, im Wolfurter Ortsteil Strohdorf geboren, und zwar in einem der wenigen wirklich alten Häuser, die heute noch stehen (Kirchstraße 7). Da die in der Sippe gängigen Vornamen Franz Josef, Johann Georg, Benedikt, Andreas und Anton schon vergeben waren und seine Ankunft kurz nach Dreikönig geschah, taufte man ihn Kaspar. Ein Melchior und ein Balthasar sollten bald noch folgen.
ZÄHES STUDIUM
Dass gerade Kaspar von den elf Söhnen für eine Bildungslaufbahn ausgewählt wurde, mag damit zusammenhängen, dass die Eltern selbst schon zur damaligen Dorfelite gehörten (der Vater konnte beispielsweise schreiben) und dass ebendieser Knabe von den Eltern oder vom Pfarrer als besonders begabt angesehen wurde.
Wo Kalb das Gymnasium absolviert hat, ist nicht bekannt. Jedenfalls scheint er aber eine Zeitlang in der Mehrerau gewesen zu sein. Denn der dortige Oberamtmann erhielt im Jahre 1771 aus einer Ausbildungsstiftung der Pfarre Bildstein 27 Gulden, und zwar „für Caspar Kalb an sein Handwerkdeputat für erlernte Rechnungskunst“. Und weil es im darauf folgenden Jahr keine Ansuchen um handwerkliche Ausbildungsunterstützungen gab, erhielt Kalb nochmals 28 Gulden.2
Ab 1775 finden wir Kaspar Kalb als Student der Philosophie in Wien. Die Reichshauptstadt war damals für alle, die nicht Theologie oder Medizin studierten, die erste Adresse, weil man hier am ehesten mit Hausunterricht oder im Gastgewerbe das Geld für das Studium verdienen konnte. Die Reise nach Wien war etwas beschwerlich, aber billig. Die Vorarlberger Studenten begaben sich meist zu Fuß nach Ulm und trachteten, von dort auf einem Floß oder Schiff gegen ein geringes Entgelt donauabwärts mitgenommen zu werden. Eine solche Wienreise dauerte manchmal mehrere Wochen.
Den Aufzeichnungen der Willischen Stipendienstiftung der Pfarre Bildstein ist zu entnehmen, dass Kaspar Kalb in den folgenden Jahren kein besonders eifriger Student war: Das Philosophiestudium brach er nach einigen Jahren ab, um mit Jus zu beginnen, und seine Studien zogen sich sehr lange hin, ohne dass sie mit einer akademischen Würde abgeschlossen wurden. Mehrmals mussten väterliche Garantien die fehlenden Zeugnisse ersetzen. 1784 wurde ihm das Stipendium schließlich aberkannt, da
„das Verhalten und Vorhaben des dermaligen Stipendiati Johann Caspar Kalb so, wie seine wanckelmütige Bestimmung von solcher Art und Beschaffenheit, dass selbe in allem Betracht der frommen Absicht und Meinung des Stifters zuwiderlaufet“3.
Im Jahr darauf wurde die Unterstützung allerdings wieder gewährt, „da nun gedachter Stipendiat sich über sein fortgesetztes Studium mit guten Attestatis ausgewiesen hat“.
Nach dreizehnjähriger Studienzeit verschwindet Kalb 1787 endgültig aus dem Rechnungsbuch der Pfarre Bildstein. Auffällig an diesen Eintragungen und Vergaben ist, dass Kalb im Gegensatz zu anderen Studenten nie selbst den Geldempfang quittiert hat, sondern stets sein Vater. Dies deutet darauf hin, dass er selten oder nie auf Heimaturlaub weilte.
ANSTELLUNG BEI HOF
Wie und wovon der wohl gescheiterte Student in den folgenden zwölf Jahren in Wien seinen Lebensunterhalt bestritten hat, war bisher nicht herauszufinden. In der Regel waren unbemittelte Studenten und Akademiker, die nicht Theologie oder Medizin studierten, als Hauslehrer tätig. Gerade im Wien der Aufklärungszeit, als neben wohlhabenden Bürgern auch immer mehr Adelige ihren Kindern eine angemessene Bildung zukommen ließen, waren gute Hofmeister – so die Berufsbezeichnung der privaten Erzieher – sehr gefragt. Da es zu dieser Zeit eine akademisch-pädagogische Ausbildung noch nicht gab, waren besonders Generalisten begehrt, die Sprachen beherrschten und zugleich über philosophische, literarische und naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügten. Jedenfalls muss Kalb berufliche Erfahrungen und Verbindungen vorzuweisen gehabt haben, die ihn für die kommende Aufgabe am kaiserlichen Hofe qualifizierten und auch dorthin brachten. Denn ab 1799 diente er ohne Unterbrechung bis zu seinem Tode im Jahre 1841 in verschiedenen Positionen und unterschiedlichen Kammern des Wiener Hofes.
In den ersten drei Jahren war er in der Kammer „Ihrer Königlichen Hoheiten deren jüngsten durchlauchtigsten Erzherzogen“4 als Kammerdiener zugeteilt. Diese Verwendung spricht auch dafür, dass er sich als Hofmeister verdient gemacht hatte und deshalb als Ausbildner engagiert wurde.
Insgesamt bestand der innere Hof damals aus vier männlichen Kammern: der des Kaisers, der des Erbkronprinzen Ferdinand, der des Erzherzogs Karl (Feldherr) und eben jener der jungen Erzherzoge Joseph, Johann, Rainer und Ludwig. Im Jahre 1803 drang Kalb in den innersten Kreis vor, indem er in die kaiserliche Kammer berufen wurde. Kurze Zeit darauf bewarb er sich um die Stelle des kaiserlichen Burginspektors. In seinem in gestochen schöner Handschrift verfassten Ansuchen vom 16. Juni 1807 begründete er seinen Anspruch,
„indem Bittsteller erstens in der Architektur nicht unerfahren ist, und sich durch Studium und Erfahrung deutliche Begriffe von Recht und Unrecht erworben hat“5.
Die umworbene Stelle wurde allerdings anderweitig besetzt; sei es, weil man Kalb in der Kammer behalten wollte oder weil ein anderer Bewerber bessere Qualifikation oder bedeutendere Protektion vorzuweisen hatte. So verblieb Kalb also in seinem Kammerdienst.
DIE HOFDIENSTE
Die kaiserliche Kammer war eines von vier Obersthofämtern: Neben dem Oberstkämmerer gab es den Obersthofmeister, der für Buchhaltung, Hofbaudirektion, Gärten und Leibgarde zuständig war; weiters den Obersthofmarschall (Quartiermacher) und schließlich den Oberststallmeister, welchem Hofstallungen, Hofreitschule und Gestüte unterstanden. Die jeweilige Oberst-Position konnte nur von Adeligen bekleidet werden, die sich in unbedeutenderen Hofämtern bereits bewährt und eine einschlägige Familientradition vorzuweisen hatten. Alle wichtigen österreichischen Adelsfamilien versuchten, zumindest ein Familienmitglied in einem hohen Hofamte zu plaztieren, um auf diese Art einen direkten Zugang, wenn vielleicht nicht zum Kaiser selbst, so doch zum innersten Hofe zu haben. Zur Zeit Kalbs dienten Mitglieder der Geschlechter von Starhemberg, Stadion, Taaffe, Montcuccoli, Hoyos, Auersperg, Khevenhüller, Strachwitz und Leiningen in führenden Kämmererfunktionen.
Das Oberstkämmereramt versah alle Dienste in den Privatgemächern des Kaisers, hatte die Aufsicht über Wohnung, Garderobe, Möbel und alles, was „im Bereich des Hauswesens zum physischen und geistigen Wohlergehen des Fürsten gehört“6. Deshalb unterstanden ihm auch die Beichtväter, Leibärzte und Barbiere, die vom Rang her den bürgerlichen Kammerdienern gleichgestellt waren. Ihnen standen für Besorgungen und Ausfahrten zwei Pferde zu; den in der Hierarchie darunter angesiedelten Kammertürhütern, -heizern, -schneidern und -schustern dagegen nur eines.
Das Oberstkämmereramt verwaltete natürlich auch die Privatkassa sowie die künstlerischen und wissenschaftlichen Privatsammlungen des Kaisers – Franz I. war beispielsweise begeisterter und kenntnisreicher Botaniker – und führte Inventare über Kleider und Pelze und die damit verbundenen Etikettevorschriften. Insgesamt umfasste die innere Kammer 20 Kammerdiener, die in den genannten Betätigungsfeldern die Tagesarbeiten erledigten. Innerhalb der Dienerschaft gab es wiederum eine Hierarchie, was die Tätigkeit und die Nähe zum Kaiser anlangte. Kaspar Kalb hat nie im kaiserlichen Schlafgemach gedient, ist aber im Jahre 1837 zum 1. Kammerdiener aufgestiegen und war damit für die gesamte Diensteinteilung zuständig. Zu seinem Jahresgehalt von 1200 Gulden erhielt er deshalb noch eine „Personalzulage“.7 Etliche Indizien deuten darauf hin, dass Kalb im Bereich der kammerlichen Finanzverwaltung tätig war. So hat er nicht nur die eigenen Ersparnisse auf recht professionelle, zum Teil riskante Art vermehrt, sondern auch das ansehnliche Vermögen seines aus Sulzberg stammenden Landsmannes Konrad Blank verwaltet und diesem zum Kauf von Obligationen geraten.
UNGEWOLLTE ÖFFENTLICHKEIT
Ein Leben als Kammerdiener bedeutete ein Leben im Hintergrund. Wenn nun Kaspar Kalb doch zu publizistischer Bekanntheit gelangte, war das ungewollt – und in seinem Falle auch äußerst unerfreulich.
In den Mittagsstunden des 13. Februar 1827 wurde in seiner Wohnung im vierten Stock des Hauses Johannesgasse – Ecke Seilerstätte im 1. Wiener Gemeindebezirk der 70-jährige Mathematikprofessor Johann Konrad Blank ermordet. Geboren 1756 in Sulzberg, hatte es dieser nach einer theologischen Laufbahn zum Professor für Mathematik an der Akademie der Bildenden Künste in Wien gebracht, war Autor etlicher Lehrbücher und kaiserlicher Rat. Obwohl sehr zurückgezogen lebend und vom Wesen her misstrauisch, zeigte Blank einem polnischen Adeligen, der einmal sein Schüler gewesen war, seine Wertpapiere. Dieser hatte sich beim alten Lehrer eingeschmeichelt und ihn gebeten, ihm die Anlageform der Obligation zu erklären. Als der gutgläubige Alte seine Wertschatulle, die er Stunden zuvor bei seinem Freund Kaspar Kalb abgeholt hatte, öffnete, wurde er hinterrücks vom polnischen Baron erstochen. Das Verbrechen erzeugte im vormärzlichen Wien derartiges Aufsehen, dass Metternich persönlich die Berichterstattung darüber unter Zensur stellte.8
Das außergewöhnliche Interesse an dieser Mordtat konnte er damit aber nicht abstellen. Es war das Boulevardstück schlechthin, da der Mörder mit der damals bekanntesten Wiener Sängerin liiert war. Außerdem bedeutete die Verhaftung des Mörders nur zwei Tage nach der Tat auch einen aufsehenerregenden Fahndungserfolg der Wiener Polizei – und wichtigster Helfer dabei war Kaspar Kalb. Er ward von Blank in einem in der Wohnung gefundenen Schriftstück als Testamentsvollzieher genannt. Bei seiner sofortigen Einvernahme konnte er der Polizei mitteilen, dass Blank ihm beim Abholen der Wertpapiere von einem polnischen Edelmann, einem ehemaligen Schüler am Privatinstitut Pleban, erzählt hatte, der die Wertpapiere studieren wolle. Das war der entscheidende Hinweis zur Identifizierung des Mörders.9 Mit seiner Freundschaft zu Konrad Blank und seiner Rolle bei der Aufklärung des Verbrechens kam der diskrete Kammerdiener nicht nur in die Polizeiprotokolle, sondern auch als Nebenfigur in den Roman „Therese Krones“ von Adolf Bäuerle.
VERWANDTE UND LANDSLEUTE
Kaspar Kalb war zu seiner Zeit keineswegs der einzige Vorarlberger in der Reichshauptstadt bzw. am Wiener Hof, und er scheint innerhalb der kleinen Vorarlbergerkolonie eine dominierende Rolle gespielt zu haben. Er verkehrte nicht nur mit dem genannten Konrad Blank und dem Sprachwissenschafter Johann Raphael Khüny aus Bludenz, sondern auch mit den beiden Kustoden des kaiserlichen Münzkabinetts Franz Fidel Wachter und Joseph von Bergmann. Ebenso ist anzunehmen, dass Kalb auch mit dem berühmten Staatsrat Martin Lorenz aus Blons (1748–1828) bekannt war. Dieser spielte bei Hofe eine besondere Rolle, weil er – obwohl selbst Priester – das josephinische Staatskirchensystem auch unter Kaiser Franz theoretisch gegenüber Rom rechtfertigte und praktisch aufrecht erhielt.10
Auch die beiden jüngeren Künstler Gebhard Flatz aus Wolfurt (1800–1881) und Johann Fessler aus Bregenz (1803–1875), die beide in den 1820er Jahren bei Blank an der Akademie der Bildenden Künste studierten und Kostplätze und Hauslehrerstellen benötigten, werden von Blank und Kalb unterstützt worden sein.
Dem Bregenzer Bernhard Kiene war der Kammerherr bei der Besorgung einer Hofknechtstelle behilflich, und auch sein Wolfurter Dorf- und Namenskollege Mathias Kalb kam vermutlich in den Genuss seiner Protektion. Dieser war zuerst beim Magistrat der Stadt Wien als „Schätzmeister bei den Handschuhmachern“ angestellt, ehe er in gleicher Funktion 1832 an den kaiserlichen Hof wechseln konnte.11
Schließlich ist mit Sebastian Kalb ein Neffe des Kammerdieners nach Wien nachgereist, der ihm im Alter offensichtlich eine große Hilfe war und dafür vom betagten Onkel finanziell unterstützt wurde. Sebastian Kalb war selbständiger Bortenmacher, konnte aber offensichtlich ohne die Unterstützung seines Onkels von diesem Geschäft kaum leben. Jedenfalls wurde er nach dem Tod Kaspar Kalbs in den 1850er Jahren verarmt per Schub in seine Heimatgemeinde Hard zurückgebracht.
EIN LEBEN UND STERBEN OHNE AUFSEHEN
Seinem Beruf entsprechend, in welchem Unterordnung, dauernde Präsenz und Diskretion die Grundtugenden zu sein hatten, scheint Kaspar Kalb ein zurückgezogenes und sparsames Leben geführt zu haben. Bis 1824 war er verheiratet und lebte in einer Privatwohnung in der Mariahilferstraße. Kinder hatte er nicht. Nach dem Tod seiner Frau zog Kalb in das Kirchbergsche Stiftungshaus für Hofbedienstete am Spittelberg, wo er bis zu seinem Tode am 16. April 1841 blieb. Er beschäftigte eine Hausmagd, die in den letzten beiden Monaten seines Lebens von einer Krankenpflegerin unterstützt wurde. Bis zu seinem 85. Geburtstag im Jänner 1841 hat Kalb in der kaiserlichen Kammer gearbeitet.12
In seinem Testament hatte er eine „Stille Beerdigung“ gewünscht, mit dem einzigen Zusatz, dass zehn Armen, „die beim Ceremonial erscheinen, je 20 Kreuzer“ zu geben seien. Auch die übrigen Bestimmungen des kurzen Testaments waren recht unspektakulär: Die Magd sollte die Einrichtung ihres Zimmers und der Küche erhalten, seinem Neffen Sebastian Kalb, der die letzten Verfügungen zu vollstrecken hatte, wurden alle übrigen Einrichtungs- und Kleidungstücke zugesprochen, wobei diese nur einen Schätzwert von 260 Gulden ausmachten.13
Seine Ersparnisse hatte der Erblasser in relativ komplizierten und – wie sich für die Erben erweisen sollte – unsicheren Transaktionen angelegt. Insgesamt hatte der Kammerdiener ein enormes Vermögen von 40.000 Gulden angespart, die zu gleichen Teilen an alle zwölf lebenden Kinder seiner Brüder Johann Georg (Wolfurt), Benedikt (Hard), Andreas (Bregenz) und Balthasar (Wolfurt) gehen sollten. Allerdings meldete ein Wiener Kaufmann, dem Kalb einen Kredit von 20.000 Gulden gewährt hatte, wenige Tage nach der Testamentseröffnung seine Insolvenz an, und aus der Masse war nicht mehr viel zu holen. Auch ein gewisser Freiherr von Bendern, der Kalb 4000 Gulden schuldete, zögerte lange mit der Rückzahlung.
Erst 50 Jahre nach Kaspar Kalbs Tod wurde der komplizierte Verlassenschaftsakt geschlossen. Wie viel die Erben tatsächlich erhalten haben, lässt sich nicht mehr exakt feststellen. Jedenfalls haben drei Generationen von Wiener Notaren und Bregenzer Rechtsanwälten ordentlich mitverdient. Dies umso mehr, als 1885 der Erbfall neu aufgerollt werden musste, da man bei der Erstabwicklung eine Harder Nichte vergessen hatte.
Zumindest auf diese Art blieb der diskrete Kammerdiener Kaspar Kalb noch weit über seinen Tod hinaus in vieler Leute Munde – und zu unserem Glück in den Akten.
Anmerkungen
1 Siegfried Heim: Kammerdiener des Kaisers. In: Heimat Wolfurt 19/1997, S. 46–50
2 Vorarlberger Landesarchiv, Hs. U. Cod. Pfa. Bildstein 11
3 Ebenda
4 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Akten des Oberstkämmereramtes 507/1807
5 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Akten des Oberstkämmereramtes 864/1807
6 Ivan Zolger: Der Hofstaat des Hauses Österreich. Wien 1917, S. 52
7 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Akten des Oberstkämmereramtes 172/580/1837
8 Ludwig Altmann: Aus dem Archiv des Grauen Hauses. Eine Sammlung merkwürdiger Wiener Straffälle. Wien 1924, S. 51
9 Ebenda, S. 9 ff.
10 Vgl. Ferdinand Maaß: Staatsrat Martin von Lorenz und der Josephinismus. In: Jahresbericht des Bundesgymnasiums Bregenz 1956/57. Bregenz 1957, S. 5–14
11 Hof- und Staats-Schematismus des österreichischen Kaiserthums (Jahre 1799 bis 1841)
12 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Akten des Oberstkämmereramtes 37/8/1841
13 Stadtarchiv Wien, Verlassenschaften 2/2408/1841
„Hier mit wird das Protokoll geschlossen und gefertigt“, lautet die Schlusszeile der ausführlichen Vernehmung des Josef Anton Breuss durch den Feldkircher Bezirksrichter am 31. Oktober 1862. Der Betroffene konnte die Richtigkeit nur mit drei Kreuzen („Handzeichen“) bestätigen. Schreiben konnte er nach nur dreijährigem Schulbesuch nicht. Trotz dieses Mankos war Breuss weltläufiger und weltgewandter als die meisten seiner Feldkircher Zeitgenossen – und er ist ein Beispiel für den unkonventionellen Umgang eines Mittellosen mit hartleibigen Behörden.
(Original im Vorarlberger Landesarchiv)
Korn, das auf der Straße wächst, reift nie.
– Afrikanisches Sprichwort
ABGESCHOBEN – ABGEHAUEN
VON EINEM LEBEN AUF STRASSENUND IN KASERNEN,AUF SCHUB UND AUF DER FLUCHT:JOSEF ANTON BREUSS (GEB. 1826)AUS FELDKIRCH
Sein Leben war ein weitgehendes Ärgernis, und sein Tod die trostlose Konsequenz. Dies war jedenfalls die Einschätzung des Feldkircher Stadtpfarrers, die er dem verstorbenen Krämer, Hausierer und Schmuggler (Schwärzer) Josef Anton Breuss als ungewöhnlich ausführlichen Eintrag am 12. September 1831 im pfarramtlichen Sterberegister nachrief:
„In dieser Nacht solle er zu seiner Frau gesagt haben, heut muß ich wieder schwärzen, gieb mir zu essen, Nachts 2 Uhr sprang er zum Bett hinaus, eilte in die Kuchel, schüttete Wasser über seinen Kopf hinab, der Blutsturz kam, verstreckte ihn, fiel nieder, und lage vom Blute umgeben, tod in der Kuchel, während dieser Trauerscene ware nicht ein Funken Licht vorhanden. Nach allgemeiner Aussage war er ein Prinzipal Schwärzer (Oberschmuggler; Anm. M.P.), war auch eingesperrt, und soll er wenig, oder gar keine Religion gehabt haben, sie lebten stets in Unfriede, wie ich selbst mit meinem seelsorglichen Amte dieser Sache sehen und verbürgen musste.“
Dabei hatte Breuss nach seiner Rückkehr aus dem Militärdienst durchaus die Ambition, eine bürgerliche Existenz zu gründen. Doch sein Ansuchen um eine Lizenz zum Hausierhandel mit Uhrenzubehör und Uhrmacherwerkzeug wurde von der Verwaltung abgelehnt,1 und seine Braut wurde schwanger, bevor der behördliche Ehekonsens eintraf. Trotzdem bezog er mit seiner Frau Anna Maria Matt aus Frastanz, die ihm ein gütiger Kapuziner angetraut hatte, im Zentrum von Feldkirch eine Wohnung. Er firmierte als „Handelsmann“, der aber offensichtlich mit Textilschmuggel mehr zum Lebensunterhalt verdiente als mit dem Verkauf von Uhrenbestandteilen. Gerade um 1825 konnte man mit Garnschmuggel für die aufkommende Textilindustrie, die sich durch Zölle behindert fühlte, pro Tag das Vierfache eines Tagelöhners verdienen.2
Die Taufpaten der Kinder, die in der Folgezeit mit jährlicher Regelmäßigkeit geboren wurden, waren respektable Gewerbetreibende. Doch mit dem jähen Tod des Familienerhalters brach alles, was die Familie einigermaßen zusammengehalten hatte, nieder. Die Witwe verfügte weder über wirtschaftlichen Möglichkeiten noch über einen sozialen Rückhalt, um sich und die drei überlebenden Kinder über Wasser zu halten. Die Erfüllung der Bitte „um gnädigste Unterstützung aus der Armenkasse der Gemeinde Altenstadt“3, wohin die Familie zuständig war, wurde von der Behörde mit unterschiedlichen Einwänden hinausgezögert. Diese Sparsamkeit sollte die Altenstädter Gemeindeoberen noch teuer zu stehen kommen.
Nach ihrem ersten Diebstahl wurden die Kinder der Armenverwaltung und wurde die Mutter dem Strafvollzug übergeben. Bis zu ihrem frühen Tod im Jahre 1838 wurde Anna Maria Breuss wegen Diebstahls und Prostitution drei Mal zu je einem Jahr Gefängnis in der Strafanstalt Schwaz verurteilt, weil sie für „körperliche Züchtigung“ zu schwach erschien. Etliche Monate verbrachte sie in Spitalsbehandlung, da sie mittlerweile an Syphilis erkrankt war.4 Anlässlich ihrer letzten Einlieferung ins Gefängnis gab ihr das Bregenzer Kreisamt eine vernichtende Beschreibung mit an die Anstaltsleitung:
„Sie wurde schon 4 mal wegen Diebstahl und zwar 3 mal im Kriminalwege und 1 mal schwer polizeilich abgestraft. Hang zum Müßiggang und Unsittlichkeit ist bei ihr vorherrschend, im höchsten Grade frech, leichtsinnig und ausgeschämt“.5
Ähnliche behördliche Punzierungen werden wir auch zu ihrem Sohne, um den es im Folgenden geht, zu lesen bekommen.
Im Juni 1838 wurde Anna Maria Breuss aus der Strafanstalt Schwaz in das Innsbrucker Spital eingeliefert, wo sie bald darauf an „allgemeiner Schwäche“ verstarb. Ihre Kinder hatte sie im Jahre 1834 zum letzten Mal gesehen. In etwa sieben Jahren – von ihrer Hochzeit bis zur ersten Inhaftierung – hat diese bedauernswerte Frau nicht nur sechs Kindern das Leben geschenkt, sondern eine tragische soziale und damit auch moralische Verwahrlosung erfahren. Noch kurz vor ihrer Verheiratung war ihr von der Frastanzer Gemeindevorstehung bestätigt worden, dass sie „sich allzeit friedlich, arbeitsam und gut betragen habe“6.
Das war also die Welt, in die Josef Anton Breuss jr. am 21. November 1826 hineingeboren wurde. Den bewusst erlebten Teil seiner Kindheit und Jugend hat er anlässlich einer späteren behördlichen Einvernahme selbst folgendermaßen dargestellt:7
SCHWABENLAND STATT SCHULE
„Als kleiner Knabe kam ich unter fremde Leute, die sich um mich Waisen nicht kümmerten, nur so wuchs ich ohne Erziehung heran. Ich habe nur zwei bis drei Winter die Schule genossen, und mußte im Sommer vom Jahre 1834–1840 mich im Württembergischen als Hirteknabe verwenden lassen. Im Jahre 1841 kam ich, ob auf Gemeindekosten oder nicht, kann ich nicht sagen, in die Lehre bei einem Schmied um das Schmiedehandwerk zu lernen; man hat mich sozusagen in der Gemeinde einer Versteigerung unterworfen und derjenige bekam mich in die Lehre, der mich um den mindesten Lehrlohn annahm. Weil mich dieser Meister nur mit Schlägen traktierte und mich, statt mich etwas zu lehren, bei der rauhesten Jahreszeit hinausjagte um Holz zu sammeln und nicht duldete, daß ich mich beim kältesten Winter nur einen Augenblick in der Schmiede aufhalte, ging ich demselben um Lichtmeß 1842 davon. Dann kam ich in der Folge meiner Bitten, daß man mich nicht mehr zum alten Meister hingeben soll, zum Schuhmeister Bucher in Rankweil, bei dem ich die Schusterprofession unter zahlreichen Schlägen und Mißhandlungen durch eine Lehrzeit von beinahe drei Jahren völlig erlernte. Nach vollendeter Lehre wanderte ich als Handwerksbursche aus nach der Schweiz, wo ich mich ungefähr anderthalb Jahre meistens mit Beschäftigung aufhielt; von da fort kam ich durch die österreichischen Lande bis nach Ungarn und arbeitete dort den ganzen Sommer des betreffenden Jahres und begab mich dann nach Hause wo ich gerade eintraf, als die Losung zum Militär im Jahre 1847 stattfand. Ich zog damals eine der frühesten Nummern, darauf ging ich wieder fort und kam ich nach Graz und ließ mich zu den steirischen Freischützen anwerben.“
Tatsächlich ist Josef Anton Breuss, der zu einem stattlichen Mann von 1,80 m Größe und mit breitem Kinn8 herangewachsen war, am 1. Juli 1848 in Graz in das „1. Steyermärkische Freiwilligen-Schützen-Bataillon“ eingetreten. Diese Einheit war nur Wochen zuvor zusammengestellt worden, um einen Beitrag zur Niederschlagung der nationalen Aufstände in Oberitalien zu leisten. Zuerst war die Truppe im Piemont, dann in Novara stationiert, ohne aber in den Kampfeinsatz zu kommen. In kriegerische Auseinandersetzungen wurde das Freiwilligenbataillon im Frühjahr 1849 in Ancona und Bologna verwickelt, ehe es zu Jahresbeginn 1850 wieder aufgelöst wurde.9 Am 2. Februar 1850 erhielt Breuss seinen Abschied und dazu einen zusätzlichen Monatssold.
SOLDATEN GEFRAGTER ALS SCHUSTER
Wieder begab er sich auf die Walz, und wieder suchte er nach einiger Zeit des sich Durchschlagens die relative Geborgenheit des Militärs. Am 22. Jänner 1852 trat er als Freiwilliger im siebenbürgischen Hermannstadt (heute Sibiu) für acht Jahre in das dortige österreichische Kaiserjägerregiment ein. Doch bald musste er feststellen, dass auf diesem fernen – damals ungarischen – Außenposten auch die Freiwilligen nicht wie weiland die steirischen Freischützen behandelt wurden, sondern die gemeinen Soldaten „unter das Tier gestellt wurden“10. Für kleinste disziplinarische Verfehlungen gab es Stockstreiche. Dabei vollzogen so genannte Stöcklknechte die über ihre Kameraden verhängten Strafen. Ein Bataillonskommandant konnte im Disziplinarwege bis zu vierzig Stockschläge verfügen, ein Kriegsgericht bis zu hundert. „Der Stock war das Werkzeug in der Hand gemeiner Menschen, die eine Wollust darin fanden, den sich zu ihren Füßen windenden Wurm zu Tode zu quälen.“11 Erst im Zuge der Heeresreform nach der Niederlage von Königgrätz im Jahre 1866 wurde die Prügelstrafe zumindest offiziell abgeschafft.12
Wenn man seinen eigenen Angaben Glauben schenken darf, hat Breuss in den nun folgenden Jahren beim Militär insgesamt an die tausend Stockhiebe ausgefasst. Er ist nicht daran zerbrochen, aber mehrmals davor geflüchtet – erstmals im Sommer 1853, als er seinen ersten Heimaturlaub dazu nutze, sich in die Schweiz abzusetzen. Ohne gültiges Wanderbuch konnte er aber auch dort keine Arbeit finden, und die Schweizer Behörden waren mit dem polizeilichen Abschub vazierender Handwerksburschen schnell bei der Hand.
Der behördlichen Bedrohung entfloh Breuss ins französische Colmar. In seiner Orientierungslosigkeit und bedroht von Hunger und Verhaftung, sehnte er sich offensichtlich wieder nach regelmäßiger Verpflegung und festen Strukturen. Das versprachen ihm die Werber der französischen Fremdenlegion. Nach kurzer Ausbildung wurde der Haufen, der mit ihm angeheuert hatte, in die algerische Stadt Constantine verlegt. Hier hatten die Legionstruppen die Aufgabe, Aufstände der Bevölkerung des eben erst eroberten Gebietes niederzuschlagen.
Zeitgenössische Berichterstatter geben Zeugnis davon, „mit welcher zur Gewohnheit gewordenen Grausamkeit und Despotie“ die Kolonialherren die Algerier unter die französische Herrschaft zwangen.13 Der Vorarlberger Legionär dürfte dabei sein Repertoire an Gewalterfahrungen in einem Ausmaß erweitert haben, wie es sich die meisten Zeitgenossen in der Heimat kaum vorstellen konnten.
Dem Kolonialkrieg folgte alsbald Frankreichs erklärter Krieg gegen Russland. Im so genannten Krimkrieg (1853–1856) versuchten besonders England und Frankreich eine territoriale Ausbreitung Russlands auf dem Gebiet des schwächelnden Osmanischen Reiches zu verhindern. Neben regulären Truppen brachte Frankreich im Juni 1854 auch Teile seiner Fremdenlegion ans Schwarze Meer. Mit dabei war auch der Legionär Josef Anton Breuss. Und obwohl noch für den Sommer 1854 der Angriff auf die Krim unter den Alliierten beschlossen war, marschierten drei französische Divisionen einschließlich der Fremdenlegion in die Dobrudscha (im heutigen Südost-Rumänien und Nordost-Bulgarien gelegen) ein, weil man dort russische Truppen vermutete. Dieser militärisch sinnlose Gewaltmarsch kostete große Opfer, besonders durch Krankheiten. Zurück in der bulgarischen Hafenstadt Varna, wurde die Einschiffung der englisch-französischen Truppen in Richtung Krim für Anfang September festgelegt.14. Da hatte unser Legionär aber bereits genug vom französischen Kriegsdienst und entfernte sich von seiner Truppe
„in der Meinung die von S. Majestät dem Kaiser von Österreich bei seiner Vermählung im Jahre 1854 erteilte Amnestie erstrecke sich auch auf die Desertion. Ich irrte drei volle Monate in der Türkei herum immer unter freiem Himmel unter den mannigfachsten Entbehrungen und wurde während dieser Zeit zweimal von türkischen Gendarmen aufgegriffen, denen ich jedes Mal wieder entrann. Ich wurde nun ein drittes Mal eingefangen und nach Adrianopel (heute Edirne; Anm. M.P.) geliefert, wo ich die Gelegenheit fand, mich mit dem österreichischen Konsul zu besprechen. Er wirkte dahin, dass ich in der Gesandtschaft in Konstantinopel eingeliefert wurde, die mich auf einem Segelschiff nach Triest liefern ließ.“15
Die quasi Erholungsreise von Konstantinopel nach Triest dauerte vom 9. November bis zum 20. Dezember 1854. Die Kosten dafür wurden dem entlaufenen Kaiserjäger später von seinem großmütterlichen Erbe abgezogen.16 Auf welche Weise Breuss in den folgenden Wochen nach Vorarlberg gekommen ist, bleibt unbekannt, jedenfalls wurde er am 17. Jänner 1855 den Bregenzer Militärbehörden „präsentiert“ und mit vierzig Stockhieben seinen neuen Kameraden vorgestellt.
Doch schon im August desselben Jahres war es wieder soweit: Breuss verschwand, stellte sich aber vier Tage später in Innsbruck selbst den Behörden. Von hier aus wurde er mit Befehl vom 19. Februar 1856 der k.k. Disziplinarkompanie in Mantua zugeteilt, wo er am 6. März eintraf. In den drei folgenden Jahren, die er noch abzudienen hatte, ist er nicht mehr davongelaufen, kannte er doch inzwischen Schlimmeres als den Militärdienst. Ein angepasster Soldat war er allerdings noch immer nicht; er bezog weiterhin in regelmäßigen Abständen Stockstrafen wegen Insubordination.
Am 31. März 1859 wurde Breuss in Mantua aus dem österreichischen Heer entlassen. Damit hatte er für einmal großes Glück, denn drei Monate später wurde seine frühere Einheit in der Schlacht von Solferino nahezu völlig aufgerieben. Hier wäre er unter Umständen wieder auf seine Kameraden aus der Fremdenlegion getroffen, die auf italienisch-französischer Seite eingesetzt wurden.17
„ENTSORGUNG“ EINES SOZIALFALLS
Die Feldkircher Behörden wussten aus Erfahrung, dass jemand, der mehr als zehn Jahre beim Militär verbracht hatte, für eine arbeitsame bürgerliche Existenz kaum mehr taugte. Deshalb unterstützten sie den Plan des Heimkehrers, sich in Zukunft bei der holländischen Kolonialarmee zu verdingen. Um aber nach Holland zu gelangen, brauchte er Geld. Nun wurden mit Genehmigung der Bezirksbehörde die letzten Sicherheiten aufgelöst. Dem Breuss und seinen beiden Brüdern war bisher der Zugriff auf ihr großmütterliches Erbe in Frastanz verwehrt und nur die Abschöpfung des mageren Fruchtgenusses gestattet. Als aber nun die Finanzverwaltung des Militärs von der Heimatgemeinde immer drängender an die 100 Gulden an Desertions- und Transportkosten forderte, wurde das Fass geöffnet. Die nach Abzug des fremden Zugriffes noch verbliebenen 130 Gulden wurden Josef Anton Breuss ausgehändigt. Das war ein beträchtliches Reisegeld, mit dem er sich in Richtung Holland auf den Weg machte.
Der Vorsteher der Zuständigkeitsgemeinde Altenstadt hoffte, das Sozialproblem auf Dauer gelöst zu haben. Doch um das Neujahr 1860 war Breuss wieder da und das Geld weg. Wegen seiner Kurzsichtigkeit, die auch einem österreichischen Militärarzt bereits aufgefallen war, hatten die Holländer den Bewerber ausgemustert. Was blieb, war das mit weniger Sehkraft Vorlieb nehmende österreichische Militär, dem sich nun Breuss in Innsbruck nochmals für ein Jahr verschrieb. Das allerdings nur im übertragenen Sinne, denn wirklich schreiben konnte er nicht: Alle Kontrakte und Protokolle, die er zu unterzeichnen hatte, sind mit den drei Kreuzen eines Analphabeten unterfertigt.
Im folgenden Frühjahr beantragte der Rückkehrer bei der Feldkircher Bezirksbehörde ein Wanderbuch und begab sich außerhalb des Landes auf Arbeitssuche. Doch innerhalb weniger Monate wurde er zweimal per Schub der Heimatgemeinde zurückgestellt: einmal aus Bayern, wo er in einen Raufhandel verwickelt war, ein andermal aus Oberösterreich, wo er aus Not gebettelt hatte und deshalb inhaftiert worden war. Zudem hatte die Gemeinde noch einen Spitalsaufenthalt in Meran abzudecken. Deshalb wurde Breuss nun von der Gemeindevorstehung in das Armenhaus Nofels eingewiesen, wo er durch Mitarbeit in Haus und Feld seinen Unterhalt mitverdienen sollte. Doch wieder hatten die kalkulierenden Wirte die Rechnung ohne den anspruchsvollen und revoltierenden Gast gemacht. Der Armenvater und Hausverwalter Johannes Büchel hat das Verhalten des Josef Anton Breuss der Behörde drastisch geschildert:18
„Am 25. September d. J. trat Jos. Anton Breuss ins Armenhaus in Nofels auf Anordnung der Gemeindevorstehung ein. Bei seinem Eintritte schon kündigte er mir an, er komme nur um hier im Armenhause einige Wochen auszuruhen; hernach wolle er schon sehen, ob ihm die Gemeinde nicht eine andere Existenz verschaffen müsse; er lasse sich diesmal nicht so leichten Kaufs abspeisen wie das letzte Mal. Im weiteren war er die ersten 2 Tage ziemlich ruhig. Sooft ich ihn in der Folge zur Arbeit anhielt, sei es im Felde oder im Hause unterließ er nie dieselbe zuerst zu kritisieren; von der Hausarbeit ging er mitten im Tage weg, um sich mit einem anderen ebenfalls im Armenhause befindlichen Individuum zu unterhalten. Um der Arbeit loszuwerden ruinierte er die Werkzeuge, mit welchen er dieselbe ausführen sollte, so z.B. zerbrach er 2 Hauen und versuchte dasselbe an einer Schaufel wovor ihn nur andere Mitarbeiter hinderten. Wenn ich ihn ermahnte, und ihm sagte, er solle mir nur die anderen an der Arbeit nicht verhindern, ich wollte von ihm nichts anderes verlangen, dann hing er mir das Maul an und sagte, ich habe ihn nicht zu sekieren und besonders lasse er sich im Armenhaus nicht sekieren. Zu den anderen Bewohnern des Armenhauses predigte er ohne Unterlaß, sie seien dumme Kerle, daß sie sich so abmühen, die Gemeinde habe Geld genug und könne ihre Armen erhalten, ohne daß sie sich so abmühen. Über das verabreichte Essen, über welches früher niemand sich beschwerte, gingen die Klagen mit dem Eintritte des Breuss an; das sei kein ‚Fressen‘, das sei kein Kaffee, er wolle lieber frischweg Wasser trinken. So gings an einem fort. Als ich ihn hieß in die Kirche gehen, sagte er, von diesem sei keine Rede, bis ihn die Gemeinde vom Kopf bis zu den Füßen neu gekleidet habe und erst dann noch sei es eine Frage, ob er gehe, denn der Herrgott habe gesagt: ‚Bete in deinem stillen Kämmerlein‘.
Am letzten Sonntag den 26. d.M. verließ Breuss ohne Bewilligung das Armenhaus und ging nach Feldkirch herein und von da zum Vorsteher nach Altenstadt. Dieser wies ihn ob seines im Armenhause zur Schau getragenen Benehmens, über welches ich ihm bereits früher berichtet hatte, zurecht und schickte ihn mit dem Bemerken fort, daß nachmittags die Armenkommission herunterkomme und die Sache untersuchen werde. Lärmend und tobend kam Breuss ins Armenhaus Nachmittags 1/2 2 Uhr zurück und sagte, heute kommen die Spitzbuben von Altenstadt herüber, er werde mit ihnen ein Wort reden; er wolle schon sehen, wer Meister sei, er oder der Vorsteher müssen umkommen. Zugleich verfolgte er mich mit den Worten: ‚Wo ist der Spitzbub, er hat mich beim Vorsteher verschwärzt, ich werde ihn lehren was er zu tun hat, er sekiert mich von heute an nicht mehr‘. Hiebei hatte er ein Messer bei sich und behauptete, ich sei ein niederträchtiger Mann, sonst wäre ich nicht im Armenhaus um die Leute zu sekieren und zu schinden. Mittlerweile kam die Armenkommission, vor deren unmittelbarer Ankunft Breuss in meiner Abwesenheit furchtbar gewütet habe und gesagt haben soll, es soll sich keiner unterfangen mir zu helfen, sonst ginge es ihm nicht gut, heute noch müsse es etwas absetzen. Sämtliche Bewohner des Arbeitshauses flüchteten aus dem Hause.
Als der Vorsteher und der Pfarrer ankamen, begehrte er mit ihnen auf ohne Ende, nachdem er versehen mit einem Messer den Tisch ganz ruiniert hatte mit den Worten, er müsse, da er niemanden sonst habe, die Wut am Tisch auslassen. Der Vorsteher ließ ihn sofort arretieren und in die polizeilichen Arreste abführen.
Ich muß hier noch bemerken, daß ich unter keiner Bedingung mehr Armenvater bleiben würde, wenn der Breuss noch ferner im Armenhause bliebe; das ist dem Angeführten zufolge auch sehr begreiflich. Ich wäre hier des Lebens nicht mehr sicher. Ich habe bereits am letzten Sonntag der Gemeindevorstehung meinen allseitigen Austritte aus meinem Dienste erklärt, falls sie bezüglich des Breuss keine andere Verfügung treffe. Wenn ein Individuum zur Abgabe ins Zwangsarbeitshaus geeignet ist, so ist es Jos. Anton Breuss.“
Die Idee, den Breuss ins Tiroler Haus für Zwangsarbeit einzuweisen, versuchte nun auch die Gemeindevorstehung in aller Eile zu realisieren. Dem Bezirksamte schien jedoch eine andere Maßnahme zielführender, kostengünstiger und endgültiger:
„Nach der Ansicht des k.k. Bezirksamtes könnte sich die Gemeinde in keiner anderen Weise sicherer und für immer dieses Individuums entledigen, als durch dessen Auswanderung nach Amerika. Die Kosten würden ohne Zweifel für die Gemeinde nicht so hoch zu stehen kommen, als wenn dieselbe den Gemeindebeitrag für einen langjährigen