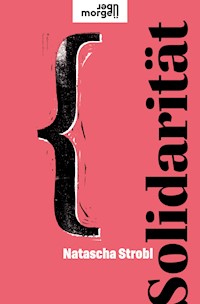15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von der Krise der Sozialdemokratie ist allerorten die Rede. Doch auch viele traditionsreiche Mitte-rechts-Parteien befinden sich im Niedergang oder zumindest in einer Zwickmühle: Sollen sie sich für progressive urbane Milieus öffnen? Oder lieber ihr konservatives Profil schärfen? Während Angela Merkel für das eine Modell steht, repräsentieren Politiker wie Donald Trump oder Sebastian Kurz das andere. Sie sind Vertreter eines radikalisierten Konservatismus.
Natascha Strobl analysiert ihre rhetorischen und politischen Strategien. Sie zeigt, wie sie Ressentiments bedienen, um ihre Anhängerschaft zu mobilisieren, oder eigene Narrative erschaffen, um »Message Control« auszuüben und Kritik als Fake News abzutun. Statt inhaltlicher Auseinandersetzung suchen sie die Konfrontation. In ihren eigenen Parteien reduzieren sie die Demokratie, setzen auf kleine Beraterzirkel und Personalisierung. Dabei greifen sie, so Strobl, immer wieder auch auf die Methoden rechtsradikaler Bewegungen und Organisationen zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Natascha Strobl
Radikalisierter Konservatismus
Eine Analyse
Suhrkamp
Widmung
Für Papa
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Einleitung
1. Rückblick: Konservative Bewegungen
Die Unordnung der (politischen) Welt
Die Neue Rechte
Rohe Bürgerlichkeit
Radikalisierter Konservatismus
Der Weg zur Macht
2. Eine Analyse in sechs Schritten
2.1 Erschöpfende Zerstörung Der bewusste Regelbruch
Bruch der formellen Regeln
Bruch der informellen Regeln
Es gibt keinen unsichtbaren Schiedsrichter
2.2 Polarisierung »Wir« und »die Anderen«
Kulturkampf von rechts
»Sing along with the common people«
Polarisierung mithilfe mehrerer Feindbilder
Eine überdrehte Gesellschaft
Der unmittelbare politische Feind – die Opposition
Der außerparlamentarische Feind – die AntiFa und Migrant:innen
2.3 Die Führungsperson Ich, Ich, Ich
Entmachtung der Parteistrukturen
Auf dem Weg zur identitären Demokratie
Märtyrer und Erlöser
Eine Regierung, die gar keine ist
Von der Staatspartei zur Leaderpartei
2.4 Antidemokratischer Staatsumbau Vormarsch auf die Institutionen
Demontage des Sozialstaats
Angriffe auf die Justiz
Sturm auf das Parlament
Medien
2.5 Mediale Inszenierung Politik im permanenten Wahlkampfmodus
Das Spiel mit den Medien
Aufregerproduktionsmaschine
Riding the News Cycle
»Flood the zone with shit«
2.6 Jenseits der Wahrheit Parallelrealitäten
Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt
Trump und
QA
non
Lösung von fiktiven Problemen
3. Ausblick: Weimar Calling
Konservative Revolution
Black Vienna
Rechte Feindbestimmung und intellektuelle Zweckbündnisse
Und wo bleibt das Positive? – Nachwort
Danksagung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Fußnoten
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Einleitung
Die Zeit liegt im Sterben. Bald wird sie begraben. Im Osten zimmern sie schon den Sarg. Ihr möchtet gern euren Spaß dran haben …? Ein Friedhof ist kein Lunapark.
(Erich Kästner)
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Der emotionale Ausnahmezustand scheint zur Normalität geworden zu sein. Diesen Eindruck hat die Pandemie mit ihren ganz realen Ausnahmezuständen nur noch verstärkt – die Risse aber waren vorher schon vorhanden. Einige ganz fein und kaum wahrnehmbar, andere klaffend. An manchen Tagen fühlt es sich an, als wäre die Welt, im doppelten Sinne, verrückt (ge)worden. Die Dinge passen nicht mehr zusammen.
Wie kann es sein, dass Nachrichten, die ein US-Präsident über die Sozialen Medien verbreitet, mit einem Warnhinweis versehen werden müssen, weil er schlicht die Unwahrheit über den Ausgang einer Wahl verbreitet? Wieso übernehmen ein konservativer Bundeskanzler und sein engster Kreis in Österreich auf einmal die Sprache der Identitären? Was ist eigentlich passiert?
Wir leben in einer Zeit, in der lange für selbstverständlich gehaltene Sicherheiten schwinden. Das liegt auch an einer Vielzahl von Krisen, die einander überlagern und verstärken. Die Nachwehen der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 sind längst nicht überwunden, die Klimakrise ist ein ständiger Begleiter, und schließlich hat eine Gesundheitskrise, die Corona-Pandemie, das öffentliche Leben für Wochen und dann viele Monate gelähmt – gleichzeitig aber wie ein Brandbeschleuniger bestehende Ungleichheiten weiter angefacht.
Aufgrund des Medienwandels und des Einflusses immer neuer Social-Media-Plattformen werden diese Krisen als globale wahrgenommen und politische Ereignisse in Echtzeit kommuniziert. Das setzt auch die bis dato gültige Art, wie Parteienpolitik und -kommunikation betrieben wurden, unter Druck. Neben die etablierten Medien sind eine Vielzahl an Blogs, Online-Zeitschriften und auch einzelne große Accounts auf Twitter, Instagram oder Facebook – ohne Herausgeber, Chefredakteurin oder Redaktion – getreten. Das Vorrecht von etablierten und anerkannten Journalist:innen auf Berichterstattung schwindet. Das bedeutet aber auch, dass sich politische Macht hin zu diffusen Netzwerken und Bubbles verschiebt. Es sind Online-Communities und Allianzen entstanden, die ohne die Sozialen Medien nicht möglich gewesen wären. Dazu gehören neue soziale Bewegungen wie Black Lives Matter, #metoo oder die Klimaschutzbewegung. Aber diese Dynamik gibt es nicht nur auf der Linken. In den letzten fünf Jahren haben sich diesseits wie jenseits des Atlantik große rechte bis rechtsextreme oder sogar faschistische Online-Communities gebildet.
Angesichts dieser Entwicklungen verharrten viele Parteien in ihren alten Strukturen. Das betrifft insbesondere die staatstragenden Parteien, die sich viele Jahre als Repräsentantinnen der Mitte begriffen haben. Es wird gerne von der Krise der Sozialdemokratie geschrieben. Konservative Parteien haben aber nicht weniger schwerwiegende Probleme. Das Erstarken der Neuen Rechten hat zu Erosionsprozessen innerhalb der konservativen Milieus geführt. Es entstand ein enormer Druck, sich dieser Herausforderung zu stellen. Sollte man entschieden auf Distanz zum außerparlamentarischen Diskurs des Rechtsextremismus gehen? Oder sich dessen Positionen zu eigen machen? Nirgends zeigte sich das im deutschsprachigen Raum deutlicher als in der Frage des Umgangs mit der »Flüchtlingskrise« 2015/16. Während ein Teil des konservativen Milieus (inner- wie außerparlamentarisch) im Konsens mit anderen gesellschaftlichen Akteur:innen versuchte, Lösungen zu finden, radikalisierte sich ein anderer und popularisierte sukzessive Positionen, die zuvor nur in der extremen Rechten zu hören waren. Fünf Jahre später raunt auch die österreichische Kanzlerpartei ÖVP in Presseaussendungen davon, dass mittels Masseneinwanderung die Mehrheitsverhältnisse im Land geändert werden sollen. Eine Aussage, die frappant an den von der Identitären Bewegung propagierten Verschwörungsmythos vom »Großen Austausch« erinnert, der just 2015/16 verbreitet wurde.
Diese Dynamik existiert nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Das permanente Entsetzen über das oft menschenverachtende Agieren Donald Trumps, dem es 2016 gelang, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt zu werden, wurde zur Normalität, und es verbreitete sich die Mär, das habe niemand ahnen können. Das stimmt natürlich nicht. Die Entwicklungen waren absehbar, und luzide Beobachter:innen haben sie vorhergesehen.
Womit wir es hier zu tun haben, ist ein neues Phänomen: der radikalisierte Konservatismus. Wie ist es ihm gelungen, innerhalb kürzester Zeit die politische und mediale Arena, in der wir handeln, denken, diskutieren, umzubauen? Um zu klären, mit welchen Ideologien er verwandt ist und wogegen er sich abgrenzt, lohnt es sich, zunächst einen Blick auf die Entwicklung des »klassischen« Konservatismus und verwandter Strömungen zu richten.
1. Rückblick: Konservative Bewegungen
Konservatismus ist eine der drei großen politischen Ideologien, die mit dem Aufkommen der modernen Nationalstaaten und des Nationalismus im 18. bzw. 19. Jahrhundert entstanden sind. Seine gesellschaftliche Basis hat er im Bürgertum. Die Wahrung der bestehenden Verhältnisse, im materiellen wie im ideellen Sinne, ist seine wichtigste Forderung. Damit richtet er sich gegen einen aufgeklärten Liberalismus, wie er sich im Zuge der Französischen Revolution herausgebildet hat, und zugleich gegen einen (revolutionären) Sozialismus, der die Besitz- und Vermögensverhältnisse infrage stellte.
Konservatismus ist nicht nur eine Abwehr- oder Gegenideologie, sondern verfügt über ein eigenständiges ideologisches Inventar. Zentrale Bedeutung darin hat die Vorstellung, Ungleichheit sei für das Funktionieren einer Gesellschaft konstitutiv. Klare Hierarchien sichern die soziale Ordnung. Gerät sie in Schieflage, kommt es zu Krisenerscheinungen.
Der konservative Antiegalitarismus steht gleichermaßen quer zu den ideellen wie materiellen Gleichheitsvorstellungen von Liberalismus und Sozialismus: Weder sind alle Menschen gleich, noch besteht eine untrennbare Einheit zwischen den Werten »Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit«.
Hierarchie qua Geburt ist also ein fester Bestandteil der konservativen Ideologie. Das wird spätestens im Erwerbsleben deutlich, wo den verschiedenen Berufsgruppen bzw. Kapital und Arbeit jeweils ihre bestimmte Rolle zukommt: Sie stehen einander komplementär und nicht konfrontativ gegenüber. Neben diese Vorstellung der Klassenharmonie tritt, ganz wie beim Liberalismus, die Betonung der Bedeutung von Privateigentum und dessen Schutz sowie – auf ideeller Ebene, wiederum in Abgrenzung zu Liberalismus und Sozialismus – ein programmatischer Antirationalismus: Der religiöse Glaube ist der menschlichen Vernunft zumindest gleichwertig, wenn nicht übergeordnet.
Kurz gefasst, verstehen wir unter Konservatismus also eine antiegalitäre, antirevolutionäre, klassenharmonisierende Haltung, deren höchste Werte Ordnung und Eigentum sind.
Deutlich jünger als Konservatismus, Liberalismus und Sozialismus sind Faschismus und Nationalsozialismus. Dieser Begriffskomplex bezeichnet politische Strömungen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt haben. Zugrunde liegt ihnen eine antidemokratische, antisozialistische, antiliberale, nicht aber antirevolutionäre Ideologie, die sich als Bewegung, Partei und Staat manifestiert.1 Zentral ist eine kriegerische und soldatische Weltsicht. Jeder Lebensbereich wird als Arena eines permanenten Kampfes betrachtet. Geschichte vollzieht sich dabei als dynamischer Prozess, in dem sich eine Gruppe – ein Volk oder eine Nation – gegen feindliche Kräfte zu behaupten hat. Dazu muss sie entsprechend durchorganisiert sein.
Vom Konservatismus unterscheiden sich Faschismus und Nationalsozialismus durch ihren dezidiert gesellschaftsverändernden, in gewisser Hinsicht revolutionären Charakter. Im Gegensatz zum Konservatismus wollen sie nicht (bloß) bewahren oder (reaktionär) ein altes Regime wieder errichten, sondern vorwärts in eine Zukunft, die jedoch auf Basis einer (fiktiven) mystifizierten Vergangenheit gedacht wird.2 Dieser Mythos ist zentraler Bezugspunkt und Selbstverständnis zugleich. Aus ihm speist sich die Vorstellung einer faschistischen Utopie, die es durch einen Umbau der Gesellschaft – entlang völkischer, nationalistischer, kultureller und biologistischer Determinanten – zu verwirklichen gilt.3
Es gibt breite und hitzig geführte Diskussionen über die korrekte Definition von Faschismus und über die Frage, wie er sich zum Nationalsozialismus verhält. Häufig werden die Gemeinsamkeiten betont; aus dieser Perspektive erscheint der Nationalsozialismus als extreme Form des Faschismus. Vertreter:innen einer sehr engen Faschismus-Definition zufolge ist der Begriff einzig auf die Staatsherrschaft des italienischen Faschismus (1922-1945) anwendbar.4 Damit wird er jedoch zu einem bloßen Eigennamen für dieses konkrete historische Phänomen – die Diktatur des »Duce« Benito Mussolini – und lässt sich weder auf ähnliche, zeitgleiche Phänomene noch auf aktuelle Bewegungen, Parteien und Organisationen übertragen. Umgekehrt ist es wichtig, keine zu weite Definition zu bemühen, unter die jedes Phänomen der (extremen) politischen Rechten fällt, da »Faschismus« dann zu einem reinen Schreckensbegriff wird, der keinerlei sinnvolle Präzision mehr zulässt.
Definitorische Schärfe ist auch bei Verwendung des Begriffs »Nationalsozialismus« notwendig, um die Differenziertheit und die strategischen Neuausrichtungen der extremen Rechten zu fassen. Alles mit den plakativen Labeln »faschistisch« bzw. »nationalsozialistisch« zu versehen, ist dabei nur hinderlich. Die in der Forschung am häufigsten angeführten Unterschiede zum Faschismus sind ein rabiater und eliminatorischer Antisemitismus, die herausragende Rolle des pseudowissenschaftlichen Rassismus sowie der singuläre Zivilisationsbruch des Holocaust bzw. der Shoah.5
Gegen die Auffassung, der Nationalsozialismus lasse sich (einfach) als eine (extreme) Form des Faschismus begreifen, gibt es wiederum überzeugende Argumente. Dabei stehen weniger ideologische Unterschiede im Fokus als die Divergenzen in der Praxis, die aus den materiellen Gegebenheiten (das hoch technologisierte Deutschland hatte andere Möglichkeiten als zum Beispiel das viel weniger industrialisierte Rumänien) und den Kräfteverhältnissen innerhalb der faschistischen bzw. nationalsozialistischen Parteien und Bewegungen resultieren.
Der rabiate Antisemitismus des Nationalsozialismus sticht aus einer ganzen Reihe von Eigenschaften hervor, die sich aus einer Ideologie der radikalen Ungleichheit und einer damit verbundenen Ungleichwertigkeit ableiten. Antisemitismus spielt in mehr oder weniger radikaler Form in nahezu jeder Erscheinungsform des Faschismus eine Rolle und ergibt sich aus dem jahrhundertealten Antijudaismus und Antisemitismus in Europa.6 Darüber hinaus existieren allerdings weitere geteilte Ideologeme der Ungleichheit und Ungleichwertigkeit, die auf völkischen Rassenvorstellungen beruhen wie Antiziganismus oder antislawischer Rassismus. Hinzu kommen soziale Ungleichheitskriterien wie Behinderung, Krankheit und soziale Deprivation (etwa Trunksucht). Daraus ergeben sich biopolitische Konzepte, die mithilfe von Sterilisation, Methoden der Eugenik oder Rassengesetzen die Reproduktion regulieren und (im Extremfall durch Euthanasie) die »Volksgesundheit« garantieren sollen. Allen Erscheinungsformen des Faschismus ist zudem eine radikale Geschlechterdichotomie inhärent: Frauen kommt vor allem die Aufgabe zu, für die Reproduktion des Volkes zu sorgen, das nur durch die Geburt von »rassisch« wünschenswerten Kindern wachsen kann.7 Die ständige Bedrohung des »Volkes«, der »Nation«, der »Rasse« führt zu einem als permanent gedachten Belagerungszustand, dessen man sich durch Krieg und Eroberung zu erwehren habe. Die Ausweitung des »Lebensraums« für das eigene »Volk« wird im faschistischen Denken so zu einem Verteidigungs- und Präventivakt.
Die soziale Basis des Faschismus ist ein unzufriedenes Kleinbürger- sowie Beamtentum, das sich in einer Zeit der Krise gleichermaßen gegen den herrschenden Machtblock oben wie gegen ein (revolutionäres) Proletariat unten wendet, aus Angst vor gesellschaftlichem Abstieg, vor dem Verlust kulturellen Einflusses und traditioneller Werte.8 Faschismus wird mit der Zeit zur klassenübergreifenden Koalition, die auch Teile des Proletariats sowie entscheidende Fraktionen aus Großbürgertum und Adel einschließt. Sie sammeln sich unter dem Versprechen eines völkisch-nationalistischen Umbaus der Gesellschaft mit der entsprechenden Ausgrenzung als nicht zugehörig definierter Gruppen.9
Das Verhältnis von Konservatismus und Faschismus ist prekär – weder stehen sie quer zueinander, noch liegen sie auf einer Linie. Beide sind auf klare Ordnungen und Hierarchien (zwischen den Geschlechtern, im Erwerbsleben etc.) ausgerichtet, antiegalitär und antisozialistisch. Doch neben solchen Überschneidungen gibt es signifikante Unterschiede. Konservatismus ist eine Herrschaftsideologie zur Absicherung bestehender (Besitz-)Verhältnisse. Faschismus ist eine Ideologie, die – durch einen (gewissen) Austausch der Machteliten – die bestehende politische Ordnung überwinden möchte.
Der Faschismus lehnt die Emanzipationsbewegungen der Moderne ab,10 was ihn mit dem Konservatismus verbindet, besitzt jedoch, anders als dieser, eine starke Affinität zu technischem Fortschritt, nicht zuletzt, was den Einsatz moderner Propagandatechniken betrifft.11 Der Religion kommt in den verschiedenen faschistischen Bewegungen – sei es aus Überzeugung oder Kalkül – ein sehr unterschiedlicher Stellenwert zu. Für den Konservatismus ist dieses Element aber nicht verhandelbar: Der antirationale Affekt speist sich hier direkt aus einem religiösen Weltbild.12 Im Faschismus hingegen folgt er aus einer metaphysischen Überhöhung des Volksgedankens, die mit dem Versprechen einer (überindividuellen) Unsterblichkeit einhergeht. Peter Berghoff hat sie als »profane Transzendenz« bezeichnet.13
Die Unordnung der (politischen) Welt
In der (historischen) Praxis sind politische Phänomene selten in Reinform zu betrachten. Einzelne Personen, Organisationen und historische Momente sind geprägt von einer Vielzahl von Einflüssen – Ideologien, den materiellen Umständen der Zeit (Wirtschaftskrisen, Währungseinbrüchen, Hungersnöten, Pandemien, Kriegen), Massendynamiken oder den Interessen einzelner Beteiligter. Betrachtet man historische Momente oder Prozesse durch eine einzige Linse, ergibt sich – ganz gleich, wie scharf man damit fokussiert – stets ein verzerrtes Bild. Realität ist komplex und unordentlich. Sie fügt sich nicht theoretischen Modellen, Beschreibungen und Definitionen.
Entsprechend existieren in der Realität neben Spektren, die sich jeweils um zentrale ideologische Kernelemente herum gruppieren, eine ganze Reihe von Halb- oder Mischspektren. Dazu zählen etwa liberal-konservative Parteien oder auch sozial-liberale Bewegungen. Die Geschichte der Sozialdemokratien vieler Länder ist geprägt von der Aufnahme und Aufgabe verschiedener Elemente. Auch die Entwicklung der Grünen folgt dem Versuch, verschiedene Ideologien unter einer Klammer (Ökologie) zu verbinden.
Nicht anders verhält es sich innerhalb des konservativen und des extrem rechten Spektrums. Neben dem Faschismus an der Macht gab und gibt es eine Vielzahl faschistischer Strömungen und Organisationen, die teils im Widerspruch zueinander standen und stehen. Einige sind von liberalen oder neoliberalen Ideen geprägt, andere reaktionär bzw. monarchistisch, wieder andere entstanden aus dem Konservatismus. Die Frage, wodurch sie sich voneinander unterscheiden, ist auch für Wissenschaftler:innen oft schwer zu beantworten. Häufig ist dieses Erkenntnisinteresse stark von politischen Befindlichkeiten überlagert.14 Statt zu versuchen, die einzelnen Strömungen analytisch fein säuberlich von verwandten Phänomenen zu trennen, um so eine Brandmauer zwischen ihnen zu errichten, ist es wichtig, sich diese fließenden Übergänge genauer anzuschauen und sie präzise zu benennen.
Wie bereits erwähnt, kann man solche Übergänge zwischen allen möglichen Strömungen aufzeigen. Das bedeutet nicht, dass diese jeweils die gleiche Relevanz in den jeweiligen Übergangsbereichen haben. So waren etwa die Versuche der Nationalrevolutionäre, Sozialismus und Nationalismus miteinander – auch theoretisch – zu verknüpfen, zwar interessant, aber überschaubar und wurden vorwiegend von Seiten der extremen Rechten unternommen.15 Das Mischspektrum zwischen Faschismus und Konservatismus hingegen bedarf einer näheren Betrachtung, da beide hier aktiv zusammenkommen.
Die Neue Rechte
Die durch die Medien verbreiteten Vorstellungen von der extremen Rechten sind oft sehr verzerrt. Dazu gehören Klischeebilder von kahlgeschorenen jungen Männern mit Bomberjacke und Springerstiefeln, die nach wie vor etwa in Illustrationen zu TV-Nachrichten ganz unironisch verwendet werden. Oftmals liegt zudem der Fokus auf einzelnen Organisationen oder Protagonist:innen der Szene. Aber so wichtig es ist, Netzwerke aufzudecken und sich näher mit einzelnen Personen und Organisationen zu beschäftigten, darf man darüber nicht vergessen, dass es sich bei Rechtsextremismus um (angewandte) Ideologie handelt. Das bedeutet auch, dass Menschen – etwa über gewisse (Sprach-)Bilder – rechtsextreme Logiken verbreiten können, ohne selbst rechtsextrem zu sein. Dementsprechend wichtig ist es, rechtsextremen Tendenzen in einer Gesellschaft nachzugehen, etwa, wie etwas öffentlich diskutiert wird oder wer mit welchen Frames und Begriffen operiert. Denn gerade der Teil der extremen Rechten, der ebenjenen veralteten Klischeevorstellungen nicht entspricht, versteht es, Sprache als Waffe einzusetzen.
Ende der sechziger Jahre entwickelte sich in Frankreich ein Zirkel innerhalb der extremen Rechten, der drei grundsätzliche Neuerungen brachte. Die Nouvelle Droite, also Neue Rechte, warf als Erstes den direkten Bezug auf den Nationalsozialismus über Bord – im Frankreich der Nachkriegszeit, das sich als Siegernation verstand, kam man mit NS-Nostalgie nicht weit. Stattdessen fanden die Akteur:innen neue Vorbilder: die »Konservative Revolution« der Zwischenkriegszeit (siehe Kapitel 3). Mit ihr konnte man sich sogar in eine Art rechte Widerstandsgeschichte einschreiben, ohne auf eine antidemokratische, autoritäre und faschistische Gesinnung verzichten zu müssen.
Hinzu kam, zweitens, dass sich die Nouvelle Droite eine neue Kampfarena aussuchte. Statt auf dem Feld der Politik im engeren Sinne, wo es gilt, Parteien zu gründen, Wahlen zu gewinnen und in Parlamente einzuziehen, wollte man im »vorpolitischen Raum« Erfolge erzielen.16 Für diese Strategie bediente sich die Nouvelle Droite beim italienischen marxistischen Theoretiker Antonio Gramsci und dessen Hegemonietheorie.17
Gramsci schrieb seine Überlegungen im Gefängnis des italienischen Faschismus nieder.18 Ihm zufolge genügt es in einer komplexen Industriegesellschaft nicht, sich an die Macht zu putschen. Um die eigenen Vorhaben und Ideen umsetzen zu können, müsse man ihnen zuvor breite gesellschaftliche Akzeptanz verschaffen. Erst dann könne der Wechsel an der Spitze des Staates dauerhaft erfolgreich sein.
Formelle Macht war für Gramsci nur der letzte Schritt einer tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzung. Er betrachtete es als demokratische Aufgabe einer progressiven Partei, die Kultur der Arbeiter:innenklasse sicht- und fühlbar zu machen. Dazu müssten Intellektuelle, die selbst aus der Arbeiter:innenklasse kommen und aus dieser Position heraus sprechen können (Gramsci bezeichnete sie als »organische Intellektuelle«), ein breites Bündnis schmieden: mit traditionellen Intellektuellen (Künstler:innen, Schriftsteller:innen, die sich als eigene Klasse außerhalb der Gesellschaft verstehen, aber sehr wohl eine wichtige Rolle in ihr spielen) ebenso wie mit allen anderen gesellschaftlichen Kräften, um schließlich als »historischer Block« an die Macht zu gelangen. Dazu braucht es aber eben kulturelle Hegemonie: Auf Ebene des öffentliches Diskurses oder im Bildungsbereich muss es eine Übereinkunft geben, dass die eigenen Ideen, die eigenen Praxen, die eigene Sprache das Empfinden einer Mehrheit treffen.19
Akteur:innen der extremen Rechten haben sich Gramscis Hegemonietheorie zu eigen gemacht. Dabei haben sie alles verworfen, was daran demokratisch oder marxistisch ist. Ihr Ziel war es nicht, die Umstände für die Mehrheit der Menschen (durch Überwindung des kapitalistischen Systems) zu verbessern, sondern Hegemonie zu erlangen, um selbst an die Macht zu kommen.20 Dieser Gramscianismus von rechts (der Gramsci unrecht tut) ist die theoretische Leitlinie, nach der die Neue Rechte agiert. Und die angepasste Strategie zeigt sich vor allem auf dem Feld der Sprache.
Während bei Gramsci Hegemonie viel mehr beinhaltet als bloße Diskursdominanz, konzentriert sich die Neue Rechte auf die Sprache und benutzt sie als Waffe. Nicht um zu überzeugen, sondern um den demokratischen Diskurs zu zerstören.21 Zu diesem Zweck hat sie sich ein ganzes Arsenal geeigneter Mittel zugelegt, von der Setzung bestimmter Frames über das Entwickeln von Narrativen bis zu Argumentationstechniken. Dazu gehört auch ein entsprechendes Auftreten: Um konservative Kreise nicht zu verschrecken, geben sich die Neuen Rechten betont angepasst und zivil.
Die Protagonisten der Nouvelle Droite waren allesamt Männer aus elitären akademischen Institutionen.22 Aus einer vermeintlichen Mitte der Gesellschaft kommend, sahen sie sich als organische Intellektuelle (im Sinne Gramscis) und bemühten sich, Angehörige der Bildungselite als »Multiplikator:innen« zu gewinnen.23
Aufgrund ihrer Herkunft, der gewählten Arena des öffentlichen Diskurses und der angepassten Strategie suchten sie – und darin besteht die dritte der erwähnten Neuerungen – eine Verbindung zwischen konservativen und faschistischen Kreisen herzustellen. Die Nouvelle Droite als Misch- oder Überlappungsspektrum zwischen traditionellem (völkischen, neonazistischen) Rechtsextremismus und staatstragend-bürgerlichem Konservatismus war geboren.24 Von Frankreich gelangte dieses Ideologieverständnis zunächst nach Deutschland, später nach Österreich und in den angelsächsischen Raum.