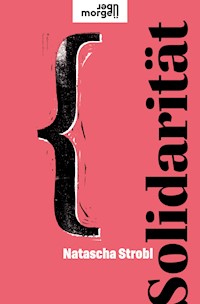
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: übermorgen
- Sprache: Deutsch
Wir haben nur uns. Solidarität ist die Einsicht, dass die Ausgebeuteten, die Verdammten dieser Erde nur eine einzige Möglichkeit haben, ihre Rechte durchzusetzen: indem sie Mehrheiten bilden. Unsere alten Gewissheiten zerbrechen aktuell an vielgestaltigen Krisen. Dem beizukommen wäre vornehmste Aufgabe der Politik. Doch die stellt sich kein gutes Zeugnis aus: Die einen klammern sich an den Glauben, dass die verlorene Normalität rückholbar ist. Die anderen wollen die Krisen mit Individualismus oder autoritären Maßnahmen meistern – und bedrohen damit den Rechtsstaat. Natascha Strobl plädiert für einen dritten Weg: eine gemeinsame, antikapitalistische Klammer. Denn die Art, wie wir leben, produzieren und wirtschaften, muss sich grundsätzlich ändern. Das muss nichts Schlechtes bedeuten, wenn die Lösung echte Solidarität ist – ein kollektiver Wert, der individuelle Befindlichkeiten überwindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 80
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Solidarität
Natascha Strobl
Inhalt
Vorwort
1 Zeitdiagnose: Was passiert hier gerade?
2 Autoritäre und neoliberale Krisenbearbeitung
3 Solidarität als dritter Pol
4 Was heißt Solidarität (und was nicht)?
5 Solidarität als Klammer
Ausblick
Beispiele für praktische Solidarität in der Gegenwart
Anmerkungen
Man muss nüchterne, geduldige Menschen schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens.
Antonio Gramsci
Vorwort
Die Idee für dieses Buch reifte mitten in der Corona-Pandemie, deren postuliertes Ende keine zurückgewonnene Normalität darstellt. Vielmehr mündete sie in einer erdrückenden Last aus Krisen, Krisen, Krisen. Es wird gleichzeitig zu viel und zu wenig über die Krisen geredet. Zu viel mit einer fatalistischen Angstlust an der Katastrophe. Zu wenig über Ursachen und Lösungsstrategien, die nicht nur Makulatur sind. Die Folge ist, dass ich eine Hoffnungslosigkeit wahrnehme, die dazu führt, dass sich viele Menschen als Einzelkämpfer:innen gegen Verschlechterungen in ihrem höchstpersönlichen Lebensbereich abstrampeln. Das laugt aus, das brennt aus, das ist nicht durchzuhalten. „Eigenverantwortung“ ist die Abwälzung der unbarmherzigen Krisenfolgen auf die Einzelnen.
Der Hoffnungslosigkeit möchte ich mit diesem Buch ein Plädoyer für Mut und Zuversicht entgegenstellen. Nicht aus Naivität, sondern mit dem realistischen Blick, dass die Zukunft holprig wird. Und aus der Notwendigkeit heraus, sie gemeinsam bestreiten, gestalten und herbeiführen zu müssen. Ich wollte mir „Solidarität“ im Lichte der verschiedenen Zeiten anschauen und kulturtheoretische Ansätze vorstellen. Das haben andere Leute aber bereits sehr lesenswert gemacht, ich darf hier zum Beispiel auf Kurt Bayertz1, Heinz Bude2 oder Susemichel/Kastner3 verweisen. Es gibt also sehr viel ausgesprochen gute und vor allem rezente Literatur, die den Solidaritätsbegriff und seine Praxis nachzeichnet.
Das Format der übermorgen-Reihe erlaubt mir, einen anderen Weg zu gehen und meine Gedanken in essayistischer Form festzuhalten. Es handelt sich beim vorliegenden Buch also nicht um eine methodische Untersuchung des Solidaritätsbegriffs, sondern um eine Anregung zur Debatte, um aus der Hoffnungslosigkeit hinauszukommen.
In einem ersten Schritt lege ich dar, wie wir überhaupt in die aktuelle Situation geraten sind. Was ist eigentlich passiert? Wie immer bei politischen und sozialen Zusammenhängen gibt es keine monokausalen Erklärungen. Ich gehe mehreren der vielen Krisenstränge nach und möchte zeigen, dass die Gegenwart eine Kumulation von vielen Vorbedingungen ist.
Als nächstes zeige ich die unterschiedlichen Formen der Krisenbearbeitung auf. Krisen lassen sich nicht nur auf eine Art lösen. Sondern auf viele. Es kommt darauf an, für wen und in wessen Interesse sie gelöst werden sollen.
Drittens plädiere ich dafür, sich weder eine liberale noch eine autoritäre Krisenbearbeitung zu eigen zu machen. Als dritten Pol muss es eine solidarische Krisenbearbeitung geben. Diese solidarische Krisenbearbeitung versucht nicht, den Kapitalismus einzuhegen und schön zu kleiden, wie es liberale Ansätze machen. Sie versucht aber auch nicht, den Kapitalismus in einer Kulturkampflogik (vermeintlich) zu überwinden.
Danach beschäftige ich mich damit, was Solidarität eigentlich heißt und wie sie sich von anderen, verwandten Begriffen abgrenzt. Solidarität ist eben nicht Charity, sondern ein eigener Wert, der, nicht zufällig, seinen Ursprung in der organisierten Arbeiter:innenklasse hat.
Fünftens möchte ich dazu anregen, Solidarität in den gegebenen Umständen als Klammer zu betrachten, innerhalb derer an vielen verschiedenen Ansätzen gearbeitet werden kann. Diese Klammer zu finden und zu definieren ist nicht einfach, aber nichts an der aktuellen Zeit ist einfach.
Abschließend hat mir eine Vielzahl an Personen, Organisationen und Initiativen Einblicke in das gegeben, was Solidarität für ihre tägliche, praktische Arbeit bedeutet. Diese hier wiedergeben zu dürfen ist mir eine besondere Ehre. Sie zeigen, dass sehr viele Menschen bereits an unterschiedlichen Hebeln ziehen, um eine solidarische, bessere Welt zu gestalten. Ich danke für die zahlreichen Beiträge.
Dieses Buch ist keine akademische Abhandlung, sondern soll Mut machen und ein Antidot gegen Fatalismus, Zynismus und Defätismus sein. Die Zeiten sind gruselig, ernst und oft nicht zu überschauen. Umso wichtiger ist es, sich auf das zu besinnen, was zählt. Das heißt weder, dass alle Antworten einfach sind, noch dass es nicht auch unterschiedliche Ansätze gibt, um an ein Ziel zu kommen. Die Basis des Handelns muss aber Solidarität sein. Innerhalb dieser Klammer lässt sich streiten und diskutieren. Ich hoffe, einen Beitrag hierfür geleistet zu haben.
1Zeitdiagnose: Was passiert hier gerade?
Zu sagen, wir leben in Krisenzeiten, ist eine grobe Untertreibung. Energiekrise, Inflation, Pandemie, Rezession, Krieg in der Ukraine und über allem die Klimakrise. Diese verkürzt zudem drastisch die Zeit, die bleibt, um alle anderen Krisen zu lösen. Es ist also nicht eine Krise, sondern es sind viele Krisen, die sich gerade entfalten. Sie gehen ineinander über, türmen sich auf, verstärken einander und werden so zu einem großen, scheinbar undurchdringlichen Nebel, der unsere Gegenwart ist. Das Ganze ist mehr als die Summe der einzelnen Teile. Denn sehr viele dieser Krisen sind nicht neu. Im Gegenteil, für viele Menschen waren sie schon immer präsent.
Neu ist allerdings, dass ein kollektives „Wir“ ihre Auswirkungen spürt. Das bedeutet, dass die Krisen so evident geworden sind, dass sie nicht mehr zu leugnen sind, da sie sich Tag für Tag vor einer globalen Öffentlichkeit abspielen. Die Krise ist die Normalität. Die Krisen sind die Normalität. Die Auswirkungen vieler Krisen sind für sehr viele Menschen aber längst nichts Neues. Die Klimakrise ist für zahlreiche Länder des Globalen Südens seit Jahrzehnten ein Problem. Soziale Krisen und prekäre Arbeitsverhältnisse sind innerhalb unserer Gesellschaft schon seit langer Zeit für jene spürbar, die nicht zu den privilegierteren Schichten gehören. Neu ist allerdings, dass diese Krisen aus dem Dunklen ins Licht gerückt sind. Neu ist auch, dass die Krisenerfahrung nicht mehr partikular, sondern kollektiv ist. Die Krisen (be-)treffen fast alle.
Krisen sind sehr viel Gegenwart und wenig Zukunft oder Vergangenheit. Das bedeutet, dass die (scheinbar) gute Vergangenheit kaum mehr erinnerlich ist. Wie war das vor der Pandemie? Es wirkt wie ein halbes Leben her. Dabei war das 2019. Genauso kommt uns aber auch die Zukunft abhanden. Es gibt keine auch nur halbwegs gesicherte Vorstellung davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Vieles ist möglich, nichts ist sicher. Gleichzeitig passiert an einem Tag so viel, kommen neue Unsicherheiten hinzu, sodass sehr viel Energie schon mit der Aufrechterhaltung der eigenen Normalität verbraucht wird. Krise bedeutet eben nicht die große Heldengeschichte, sondern (Über-)Leben. Irgendwie durchkommen. Irgendwie Mittel und Wege finden. Krise bedeutet auch, dass Selbstverständlichkeiten zur Disposition stehen. Laurie Penny beschreibt dieses Gefühl wunderbar in ihrem Pandemie-Essay This is not the Apocalypse you were looking for: „It’s the end of the world as we know it, and everything feels fine – not fine, like chill, but fine like China, like glass, like thread. Everything feels so fine, and so fragile, and so shockingly worth saving.“4
Wie ist es dazu gekommen, dass wir in einer stahlharten Glaswelt leben?
Die unmittelbare Nachkriegszeit brachte für Deutschland und Österreich die Aufgabe, die (neuen) Verhältnisse zu stabilisieren und demokratische Institutionen und Strukturen (wieder) aufzubauen. Sprich: Versorgung sicherstellen, Wirtschaften aufbauen und gesellschaftlichen Zusammenhalt erschaffen. Die Übereinkunft über diese Notwendigkeiten und einen Ausgleich verschiedener und teilweise gegensätzlicher Interessen wurde vor allem jeweils von zwei Großparteien getroffen – einer sozialdemokratischen und einer konservativen. Bei allen nationalen Spezifika haben sich Parteien dieser Parteienfamilien als jene herauskristallisiert, die das Nachkriegssystem aufbauten und stabilisierten. Der Nachkriegskonsens basiert auf der Balance zwischen einem Wirtschaftssystem, das auf ökonomischer Ungleichheit aufbaut, und einem politischen System, das versucht, möglichst viel Gleichheit herzustellen. Ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, gepaart mit starken Sozialstaaten. Dieser politische Konsens sorgte tatsächlich für Stabilität. Zumindest eine Zeitlang. Doch diese Stabilität war schon damals von Ein- und Ausschlüssen geprägt und hatte ihren Preis. So wurden Arbeitskämpfe in Verhandlungen nivelliert und wegverhandelt, statt am Arbeitsplatz ausgetragen zu werden.5 Der Konsens ging auch zulasten von Frauen, die in konservative Familienmodelle und finanzielle Abhängigkeiten gedrängt wurden. Der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt daheim. Vielleicht gönnt sie sich ein, drei, fünf Gläser Schnaps, um das Leben im konservativen Nachkriegsmief zu ertragen. Diese Zeit des „Wirtschaftswunders“ wird auch heute noch oft gesellschaftspolitisch verklärt. Die notwendigen Arbeitskräfte für den Wirtschaftsaufschwung kamen jedoch aus anderen Ländern, das „Wunder“ war nur mit ihnen möglich.6 Gastarbeiter:innen wurden händeringend gesucht und dann ohne Integrationsmaßnahmen oder Staatsbürgerschaftsrechte in west- und mitteleuropäische Länder gebracht. Die irrige Idee war, dass diese Leute nur zu Gast waren und „danach“ auch wieder zurückgehen würden. Was auch immer dieses „Danach“ sein sollte: Es ist so nicht eingetreten. Denn es kamen Menschen an, wie es der türkische Musiker Cem Karaca 1984 in seinem gleichnamigen Lied ausdrückte.7
Der wirtschaftliche Aufschwung der Länder West- und Mitteleuropas, insbesondere der Täterstaaten des Zweiten Weltkriegs, beruhte also auf klaren Rollenzuweisungen an Frauen und wurde auf den Schultern der Gastarbeiter:innen erarbeitet.
Die politische Stabilisierung, die mit der wirtschaftlichen einherging, basierte nicht zuletzt auf Verdrängung und Vertuschung. Gab es bei den ersten, von den Alliierten durchgeführten Prozessen gegen NS-Täter:innen noch klare Urteile bis hin zu Todesstrafen, so begnügte man sich bald mit einem symbolischen „Klaps auf die Finger“ und dem Wunsch nach Verzeihen, bis es in den 60er-Jahren zu den Auschwitz-Prozessen kam, für die Fritz Bauer als Chef der Anklagebehörden verantwortlich zeichnete.8 Dieses Verzeihen wurde allerdings den Täter:innen ausgesprochen. Symbolhaft dafür war das Ringen der Volksparteien um ehemalige NSDAP-Mitglieder oder die vielen ungebrochenen Karrieren von Teilen der wirtschaftlichen, akademischen und kulturellen Elite der NS-Zeit in Österreich oder der BRD. Die Opfer und ihre Hinterbliebenen mussten hingegen noch sehr lange um Würde, Anerkennung und Entschädigung kämpfen. Auch das ist eine Wahrheit der unmittelbaren Nachkriegszeit. So ist es auch zu verstehen, dass die alliierte Besatzung diskursiv lange mit der NS-Zeit gleichgesetzt wurde. Dabei wurde nicht etwa der 8. Mai 1945 symbolisch als Ende des Nazi-Terrors festgeschrieben,





























