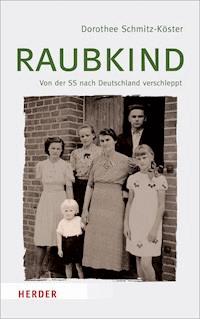
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Klaus B. ist Mitte Siebzig, als sein ordentliches Leben aus den Fugen gerät. Er erfährt, dass er als Kind Opfer eines Verbrechens wurde. Er selbst kann sich an nichts erinnern. Mit Hilfe einer Journalistin findet Klaus B. heraus, dass er in Polen zur Welt gekommen ist. Dass er 1943 seiner Familie geraubt wurde, vermutlich von der SS. Dass sein Name und seine Herkunft mit Hilfe des "Lebensborn" gefälscht wurden, der ihn dann bei linientreuen deutschen Pflegeeltern unterbrachte. Klaus B. und die Journalistin lernen: Dieses Schicksal teilten Zehntausende Kinder aus Polen und anderen osteuropäischen Staaten. Sie wurden von nationalsozialistischen "Rassenspezialisten" ausgewählt, ihren Familien entrissen und zur "Germanisierung" nach Deutschland verschleppt. Bis heute wissen viele "Raubkinder" nichts von ihrer Herkunft. Klaus B. macht sich auf die Suche nach seinen Wurzeln und findet eine Familie, die ihn seit sieben Jahrzehnten vermisst. Alles beginnt mit dem Anruf einer Journalistin, die Klaus B. telefonisch darauf anspricht, dass er 1944 als Pflegekind zu seiner Familie gekommen sei, aus dem Lebensborn-Heim in Bad Polzin. Ob er sich an dieses Heim erinnern könne? Ob er wisse, warum er dort gewesen sei? Darüber würde sie gerne mit ihm reden. Sie beschäftige sich nämlich mit dem Lebensborn, auch mit dem Heim in Bad Polzin. Er selbst hat erst mit neunzehn Jahren erfahren, dass die Familie ihn aus einem Lebensborn-Heim geholt hatte. Das war alles. Kein Wort darüber, warum er in diesem Heim war und was Lebensborn bedeutet. Klaus B. ist hin- und hergerissen zwischen Neugier und gleichzeitig dem Wunsch, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Obwohl er sich in den letzten Jahren immer wieder gefragt hat, ob die Informationen wirklich stimmen, die ihm die Stiefeltern mit auf den Weg gegeben haben. Warum hat er zum Beispiel keine Geburtsurkunde? Als junger Bursche hatte er nur einen Flüchtlingsausweis, das war alles. Und irgendwann war der Ausweis fort, verlegt, verloren, auf alle Fälle konnte er ihn nicht mehr finden. Es kann sein, dass die Urkunde wirklich auf der Flucht verloren gegangen ist, wie seine Stiefmutter gesagt hat. Seine Stiefgeschwister Inge, Uschi, Volker und Gero haben allerdings Geburtsurkunden... Nach dem Einmarsch der Wehrmacht und der Besetzung Polens zerschlugen die neuen Machthaber den polnischen Staat mitsamt seinen Strukturen. Politiker und Militärs, Juristen, Kleriker und Wissenschaftler – pauschal als Gegner klassifiziert – wurden fortgejagt, verfolgt, ermordet. Im Oktober 1939 teilten die deutschen Besatzer das Land in zwei Teile und Hitler kündigte einen "harten Volkstumskampf" an, um "das alte und neue Reichsgebiet zu säubern von Juden, Polacken und Gesindel." In diesem Kontext von Diskriminierung, Entrechtung und Enteignung, von Gewalt, Terror und Mord auf der einen und "sauberer" Bürokratie auf der anderen Seite stand die Verschleppung der polnischen Kinder. Auch dabei ging es um "Rassenpolitik" – aber mit den Mädchen und Jungen, die in die Hände der Nationalsozialisten gerieten, hatte man etwas anderes vor. Heinrich Himmler propagierte das Vorhaben, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Man werde Kinder "guten Blutes" im Osten aus ihrer Umgebung herausholen, notfalls "rauben und stehlen" und nach Deutschland bringen. Nach Prüfung aller vorhandenen Quellen geht die Historikerin Isabel Heinemann von 20 000 verschleppten Mädchen und Jungen aus. Bis heute ist dies die belastbarste Zahl. Damit bleibt Polen trotz allem dasjenige Land, das die meisten Kinder an das NS-Germanisierungsprogramm verloren hat. Bekannt sind Kinderraub und Kinderverschleppung nach Deutschland aber auch aus Slowenien und der Tschechoslowakei. Um die Anerkennung als Opfer der Nationalsozialisten und für eine Entschädigung für das erlittene Unrecht kämpften in den letzten Jahren immer wieder sogenannte Raubkinder vor Gericht – bisher erfolglos. Die Geschichte von Klaus B.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dorothee Schmitz-Köster
Raubkind
Von der SS nach Deutschland verschleppt
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2018
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Judith Queins
Umschlagmotiv: © privat
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, Torgau
ISBN (E-Book): 978-3-451-81306-1
ISBN (Buch): 978-3-451-38380-9
Inhalt
Aufgestört, beunruhigt, neugierig
Tausend offene Fragen: »Haben Sie Akten über Klaus B.?«
Die Stiefeltern – 1930–1944
Eine Sensation: Klaus heißt eigentlich Cseslaus
Polen unter deutscher Besatzung: Mord, Vertreibung, Kinderraub
Der Schock
Das Lebensborn-Heim »Pommern« in Bad Polzin
Stiefschwester Inge ist nicht erreichbar – und gibt indirekt doch Auskunft
Puzzlestück: Die Personalakte von Johannes Schäfer
Endlich: Große Neuigkeiten aus Arolsen
Dass ich mal so klein war! Klaus B. begegnet seiner Kindheit
Herzrasen: Klaus B. bricht zusammen
Die Stiefeltern – 1944–1945
Das erste Treffen mit Klaus B.
Plötzlich dreimal Bruder und achtmal Onkel
Die Stiefeltern – 1945–1964
»Du warst das Wichtigste«: Noch mehr Post aus Jarocin
Ein Stapel Dokumente: Die Kinderakte
Besuch aus Polen
Wie geht man mit einer neuen Familie um?
Puzzlestück: Der Nürnberger Prozess gegen das Rasse- und Siedlungshauptamt SS (RuSHA)
Fährt er? Fährt er nicht? Zweites Treffen mit Klaus B.
Eine Reise nach Jarocin und Rogoźno
Rogoźno im Krieg
Die Geschichte von Alojsy Twardecki
Datenwirrwarr: Wann wurde Czesław geraubt?
Puzzlestück: Janitscharen
Zweite Sichtung der Kinderakte: Ein Gespräch im ITS
»Wir sollten unsere Familien schnell vergessen«: Recherchen in polnischen Archiven
Puzzlestück: Psychologische Gutachten
Klaus B. macht Pause – und steigt wieder ein
Behördenchaos und Schäfers Lügen
Der Stiefvater – 1945–1973
Warum gibt es keine Entschädigung?
Gedankenspiele: Wie wäre Klaus B.s Leben verlaufen, wenn …
Lohnt es sich, nach der Wahrheit zu suchen?
Dank
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Über die Autorin
Aufgestört, beunruhigt, neugierig
Er wälzt sich auf die Seite, zieht die Beine an, macht sich wieder lang – nein, so wird das nichts. Also auf die andere Seite. Sofort spürt er sein Herz. Wieder auf den Rücken. Der Wecker tickt. Dreißig Jahre ist das Ding bestimmt schon alt. Und funktioniert immer noch. Sonja schnarcht leise. Eigentlich stört es ihn. Aber er hat sich daran gewöhnt. Wie er sich immer an alles gewöhnt hat, von klein auf.
Er kann einfach nicht einschlafen. Die Gedanken rasen durch seinen Kopf, springen hin und her, nichts lässt sich fassen und zu Ende führen, alles geht durcheinander. Und »Stopp« kann er auch nicht sagen.
Er muss einfach immer daran denken. Wenn er das Gras mäht, wenn er zum Einkaufen fährt, wenn er seine fünfhundert Meter schwimmt. Und wenn er mit Sonja zusammen ist sowieso. Dann reden sie darüber, immer und immer wieder. Bis Sonja meint: Lass uns doch mal über was anderes reden. Also reden sie über was anderes – aber für ihn ist es immer da, auch wenn er versucht, es beiseite zu schieben.
Kannst du wieder nicht schlafen, Klaus?, fragt Sonja plötzlich. Soll ich dir eine Tablette holen?
Nein, nein. Er wehrt ab. Entschuldigt sich, weil er sie geweckt hat. Liegt still, obwohl ihm das schwerfällt.
Als neulich dieser Brief im Kasten lag, wusste er sofort: Da kommt etwas auf ihn zu. Das wird ihn nicht mehr loslassen. Und wie auf Kommando hatte sein Herz angefangen zu holpern.
Dabei hatte die Journalistin nur geschrieben, sie sei durch ein Buch auf ihn aufmerksam geworden. Ein Buch über die SS-Familie Schäfer, das Ingeburg Schäfer verfasst habe, die älteste Tochter. »Mutter mochte Himmler nie« – er kenne das Buch sicher. Er sei doch 1944 als Pflegekind zu dieser Familie gekommen, aus dem Lebensborn-Heim in Bad Polzin. Ob er sich an dieses Heim erinnern könne? Ob er wisse, warum er dort gewesen sei? Darüber würde sie gerne mit ihm reden. Sie beschäftige sich nämlich mit dem Lebensborn, auch mit dem Heim in Bad Polzin …
Das will ich nicht!, war sein erster Gedanke gewesen. Ich weiß darüber gar nichts. Und ich will auch nicht darüber reden.
Jetzt muss er sich doch wieder umdrehen.
Fünfundsiebzig Jahre hat er jetzt gelebt, ohne etwas über die Zeit zu wissen, bevor er zu den Schäfers gekommen ist. Und schlecht waren diese Jahre nicht. Wirklich nicht. Aber so einfach lässt sich das Thema nicht beiseiteschieben.
Nein, Sonja ist nicht schuld. Sie hat natürlich nach dem Brief gefragt und ihn natürlich auch gelesen. Seitdem reden sie darüber. Nein – jetzt liegt er wieder auf dem Rücken –, er ist selbst schuld. Weil er sich immer wieder vorstellt, er würde sich auf die Journalistin einlassen. Er würde ihr seine Geschichte erzählen … Vielleicht könnte sie herausfinden, was damals passiert ist. Vor fünfundsiebzig Jahren. Mit ihm. Mit seinen richtigen Eltern, Friedrich und Maria B.
Die Schäfers haben ihm immer gesagt, die beiden seien tot, der Vater gefallen, die Mutter kurz nach der Geburt gestorben. Deshalb hätten sie ihn als Pflegekind in ihre Familie aufgenommen. Deshalb hätte er auch einen anderen Nachnamen. Er hat das geglaubt. Lange. Aber irgendwann fing er an zu zweifeln …
Jetzt ist er so wach, dass er aufstehen muss. Am liebsten würde er sich jetzt an eine Werkbank stellen und hobeln. Die gleichmäßige Bewegung täte gut. Oder mit einem Hund durch die Straßen laufen – wenn sie einen Hund hätten. Er wird uns überleben, sagt Sonja immer. Außerdem macht er Dreck. Sie hat sowieso schon genug Arbeit mit der Wohnung.
Im Flur schaut er kurz in den Werkzeugschrank. Streicht zärtlich über die schönen Hobel, die ihm ein alter Schreiner überlassen hat. Die Griffe glänzen, so glatt ist das Holz. Ja, er hat immer gerne gearbeitet. War ein guter Beruf. Und praktisch. Die Anbauwand, den Couchtisch, den Musikschrank – alles hat er selbst gebaut.
Er legt sich aufs Sofa, schaltet den Fernseher ein, schaut hin, ohne etwas zu sehen. Wer ist überhaupt diese Journalistin? Ob sie seine Geschichte ausschlachten will? Es gehe ihr um den Lebensborn, hat sie gestern am Telefon gesagt. Und was in den Heimen der SS-Organisation wirklich passiert ist. Mit den Müttern und vor allem mit den Kindern. Er ist also nur einer von vielen, mit denen sie redet. Das hat ihm gefallen. Da konnte er ihr nicht einfach absagen, sondern hat um Bedenkzeit gebeten. Jetzt macht sie sich natürlich Hoffnungen.
Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er etwas mit dem Lebensborn zu tun hat? In Inges Buch ist davon nicht die Rede. Oder doch? Er steht auf und holt sich das Buch, das die Stiefschwester über ihre Familie geschrieben hat. Wie immer schaut er sich zuerst die Fotos im Mittelteil an. Das letzte Bild zeigt ihn mit den vier Schäfer-Kindern und der Stiefmutter. Damals war er acht oder neun und lebte schon ein paar Jahre bei ihnen. Er blättert nach vorn, wo ein Zettel steckt. Die Stelle, die ihn betrifft, ist rot angestrichen. Sie stammt aus einem Brief der Stiefmutter:
Ich war nämlich an diesem Tage nach Polzin gefahren, um mir aus dem Heim – nun setzt Euch erst einmal hin – unseren Pflegesohn Klaus zu holen. Er ist elternlos, im gleichen Alter wie Volker, kommt also mit ihm zusammen zur Schule, sieht nett aus, blond und blauäugig, und hat sich schon gut bei uns eingelebt. Da er lange in Heimen war, ist die Lage seiner Kleidung katastrophal. So renne ich täglich alle Geschäfte nach diesem und jenem ab …1
Das hat die Stiefmutter ihren Eltern geschrieben. Im Frühjahr 1944, kurz nachdem sie ihn aus dem Heim geholt hat.
Und ausgerechnet diese Stelle ist der Journalistin aufgefallen. Obwohl die Stiefmutter das Wort Lebensborn in ihrem Brief gar nicht erwähnt. Allerdings hat sie auch kein Wort darüber verloren, dass nicht nur der Zustand seiner Kleidung katastrophal war, sondern seine ganze Verfassung. Das hat Inge im Buch ergänzt. Er habe offene Wunden an Händen und Füßen gehabt, eine Folge von »Frostschäden«, schreibt sie. Dazu »seelische Schäden« … Ja, ja, er war Bettnässer. Er konnte doch nichts dafür. Heimkinder sind häufig Bettnässer.
Woher Inge das eigentlich weiß? Hat sie mit der Stiefmutter darüber gesprochen? Als das Buch herauskam, war Eva Schäfer doch schon lange tot.
Warum hat Inge dieses Buch überhaupt geschrieben? Er weiß bis heute nicht, was sie damit erreichen wollte. Den Vater anklagen, weil er in der SS war? Oder umgekehrt – den Vater entschuldigen? Wen interessiert es denn heute noch, dass Johannes Schäfer ein Nazi mit Dreck am Stecken war?
Die Journalistin offenbar schon, sonst hätte sie Inges Buch ja nicht gelesen …
Inge! Inge wird der Journalistin erzählt haben, dass das Heim in Bad Polzin ein Lebensborn-Heim war. Er selbst hat das ja erst mit neunzehn erfahren, als er nach Süddeutschland gegangen ist. Lange her. Damals haben die Stiefeltern ihm einen Brief mitgegeben – zu einer Aussprache waren sie wohl zu feige. In dem Brief stand kurz und knapp, sie hätten ihn aus einem Lebensborn-Heim geholt. Das war alles. Kein Wort darüber, warum er in diesem Heim war und was Lebensborn bedeutet. Trotzdem war er so erschrocken, dass er den Brief sofort zerrissen und weggeworfen hat. Als hätte er nie existiert. Vergessen konnte er ihn allerdings nie.
Er rappelt sich hoch. Doch, eigentlich würde er gerne wissen, was damals geschehen ist, warum er im Heim war, in diesem Heim, und was mit seinen Eltern passiert ist. Vielleicht kann die Journalistin … Aber in die Zeitung will er nicht und ins Fernsehen erst recht nicht!
Er öffnet die Balkontür, atmet tief durch, macht ein paar Schritte nach draußen, schaut hinunter auf die Stadt. Wie immer hat er das Gefühl, als könnte er sich an die Hügel in seinem Rücken anlehnen. Die Luft ist mild. Es ist still, alle schlafen. Warum werden die Straßenlaternen nachts eigentlich nicht ausgeschaltet? Reine Verschwendung. Er holt sich eine Decke, wickelt sich ein, legt sich auf die Liege, schaut in den Himmel. Sind da Sterne? Dann schläft er ein.
Hoffentlich hast du dich nicht erkältet. Sonja guckt besorgt. Er ignoriert die Bemerkung, steht vom Frühstückstisch auf und holt sich Zettel und Stift. Sonja runzelt die Stirn. »Lebensborn-Heim«, schreibt er und trinkt einen Schluck vom dünnen Kaffee. Darunter setzt er »Bad Polzin« und »Entlassung nach Ostern 1944«. Schreibst du schon den Einkaufszettel?, fragt Sonja. Er reicht ihr das Blatt: Das ist das einzige, was ich sicher über die Zeit vor den Schäfers weiß. Ach, du bist schon wieder beim Thema, seufzt Sonja. Und was ist mit deinem Geburtsdatum und deinem Geburtsort? Sind die nicht sicher?
Doch, doch, nickt er. Das wird schon richtig sein. Obwohl er sich in den letzten Jahren immer wieder gefragt hat, ob die Informationen wirklich stimmen, die ihm die Stiefeltern mit auf den Weg gegeben haben. Warum hat er zum Beispiel keine Geburtsurkunde? Ein ordentliches Dokument mit Unterschrift und Stempel, mit Geburtsdatum und Geburtsort und mit den Namen seiner richtigen Eltern. Als junger Bursche hatte er nur einen Flüchtlingsausweis, das war alles. Und irgendwann war der Ausweis fort, verlegt, verloren, auf alle Fälle konnte er ihn nicht mehr finden.
Zum Glück hattest du nie Probleme ohne Geburtsurkunde, lacht Sonja. Bei unserer Hochzeit zum Beispiel. Und es kann doch sein, beschwichtigend legt sie ihre Hand auf seinen Arm, dass die Urkunde wirklich auf der Flucht verloren gegangen ist, wie Eva Schäfer gesagt hat. Er nickt. Dann fällt ihm ein, dass Inge und Uschi und Volker und Gero Geburtsurkunden haben. Die Dokumente ihrer richtigen Kinder hat Eva Schäfer auf der Flucht nicht verloren.
Jetzt steht er schon wieder auf. An ein ruhiges Frühstück ist wohl nicht zu denken, murmelt Sonja. Mach das doch später, versucht sie ihn zu bremsen. Aber er hat schon einen Ordner in der Hand, fischt zwei Blätter heraus, schiebt seinen Teller beiseite und liest vor:
Lebenslauf. Im Jahre 1939 am 11. August wurde ich in Dresden als Sohn des Friedrich B. und seiner Frau Maria, geborene G., geboren. Meine Mutter starb kurz danach, mein Vater fiel 1942 in Russland …
Ich weiß, unterbricht ihn Sonja, das haben die Schäfers dir diktiert, als du aus der Schule gekommen bist. Genau, plötzlich ist er aufgeregt. Der Punkt ist doch, dass sich diese Angaben nicht belegen lassen. Das hat unser Notar schließlich festgestellt, als er vor fünfzehn Jahren in Dresden nachgefragt hat.
Damals wollten sie ihr Testament machen, und der Notar hatte sich gewundert, dass sie nur Sonjas Verwandtschaft als Erben eingesetzt hatten. Ob Klaus denn keine Angehörigen habe? Nein. Ob er nachgeforscht habe? Nein. Also hatte der Notar in Dresden nach Unterlagen gefragt, über die Eltern Friedrich und Maria B. und ihr Kind Klaus. Aber die Antwort des Dresdner Standesamts war negativ ausgefallen. Klaus hat jetzt Blatt Nummer zwei vor sich, den Brief des Standesamts:
In Dresden wurden durch Kriegseinwirkungen fast alle Personenstandsbücher und Nebenakten vernichtet. Die Prüfung unserer noch vorhandenen Unterlagen aus den Jahren 1938 bis 13./14. Februar 1945 ergab, dass zu der genannten Person kein Personenstandseintrag mehr vorliegt.
Sonja nickt. 13./14. Februar 1945 – das war die große Bombennacht kurz vor Kriegsende. Klaus ist schon weiter:
Wir bitten Sie zu prüfen, ob die betreffende Person noch eine Geburtsurkunde und Eheurkunde der Eltern besitzt.
Sonja lacht laut heraus. Einmal im Kreis gedreht, spottet sie. Der Notar hat nach Urkunden gefragt und soll dazu genau diese Urkunden beibringen.
Sie hatten damals zwar nicht geglaubt, dass man in Dresden etwas finden würde. Aber enttäuscht waren sie trotzdem.
Einmal am Tag drehen Klaus und Sonja eine Runde. Am Waldrand entlang, ein Stück bergauf – dabei kommt er meistens außer Puste. Dann setzen sie sich auf eine Bank und schauen auf die Stadt. Sonja ist hier geboren, und er lebt seit gut fünfzig Jahren in R. Wenn er dann wieder bei Atem ist, beginnt der Redestrom von Neuem: Soll er in seine Geschichte einsteigen? Es wird nicht beim Thema Lebensborn-Heim bleiben, da sind sich die beiden einig. Wenn die Journalistin vorbeikommt, wie sie am Telefon vorgeschlagen hat, geht es erst richtig los. Hält er das aus, mit seinem kranken Herzen? Sie sind nicht belastbar, hat der Hausarzt erst vor wenigen Tagen wieder gesagt. Das weiß er selbst, und Sonja weiß es sowieso. Aber soll er sich deshalb in Watte packen? Er ist neugierig und ängstlich, gleichzeitig. Er hofft auf irgendetwas – und will sich nicht zu viele Hoffnungen machen. Lass sie kommen, die Journalistin, sagt Sonja plötzlich resolut. Dann werden wir sehen, ob du ihr vertrauen kannst. Er nickt. Gut.
Aber als die Journalistin ein paar Tage später anruft, zögert er doch wieder.
Sie habe in Süddeutschland zu tun und genügend Zeit, um ihn zu treffen, bietet sie an. Eigentlich könne er ihr nicht viel erzählen, gibt er zurück – jetzt hat er einen Dreh gefunden, um sie abzuhalten.
Aber die Journalistin lacht. Das sagten fast alle Lebensborn-Kinder, mit denen sie gesprochen habe. Und es stimme nie. Dann erzählt sie von ihren Recherchen, von den vielen Frauen und Männern, die sie schon interviewt hat … Er wisse doch sicher, was es mit dem Lebensborn auf sich hatte?
Ja, ja, bestätigt er, es ging um den »arischen« Nachwuchs. Er schaue regelmäßig die Sendungen von Guido Knopp.
Die Journalistin seufzt. Plötzlich wird ihr Ton eindringlich. Die wenigen Fakten über das Pflegekind Klaus, die seine Stiefschwester Ingeburg in ihrem Buch festgehalten habe, hätten sie alarmiert. Vor allem die Punkte Lebensborn-Heim, Bad Polzin, sein Alter und seine desolate Verfassung. In der Regel seien die Kinder, die in den Lebensborn-Heimen lebten, viel jünger gewesen und vor allem nicht in einem solchen Zustand. Sie vermute, dass er ein verschlepptes Kind ist. Vielleicht ein polnisches Kind. Viele von ihnen seien über das Lebensborn-Heim in Bad Polzin in deutsche Pflegefamilien vermittelt worden … Das habe er sich auch schon überlegt, unterbricht er sie.
Was?, ruft die Journalistin aufgeregt. Wie er auf diese Idee gekommen sei?
Er bleibt ganz ruhig. Das wisse er nicht, das sei ein Gefühl. Und die Guido-Knopp-Filme hätten ihn darin bestärkt.
Beide schweigen. Er würde jetzt am liebsten den Hörer auflegen. Er hat sich zu weit vorgewagt.
Aber dann sollten Sie wirklich …, setzt die Journalistin zögernd an.
Er unterbricht sie ein zweites Mal und sagt einfach: Okay. Von ihm aus könne sie recherchieren. Er sei jetzt so alt. Er wolle jetzt alles wissen. Aber deshalb brauche sie nicht bei ihm vorbeizukommen.
Schade, sagt die Journalistin leise. Sie hätte ihn gerne kennengelernt. Dann wird sie nüchtern: Sie könne nichts versprechen. Er müsse damit rechnen, dass die Recherche Wochen und Monate dauert. Und sie brauche seine Vollmacht, anders komme sie nicht in die Archive.
Sonja hat sich während des Telefonats unsichtbar gemacht. Jetzt steht sie da und schaut ihren Mann fragend an. Und, wann kommt sie? Alles in Ordnung, brummt er. Sie braucht eine Vollmacht. Sonja geht aus dem Zimmer, draußen schüttelt sie den Kopf. Hatten sie nicht besprochen, dass die Journalistin kommen soll? Aber so ist er, ihr Klaus.
Als sie am nächsten Tag die Vollmacht zum Briefkasten bringen, fragt sie vorsichtig: Bist du jetzt erleichtert? Er zuckt mit den Schultern. Er weiß es nicht. Wenn die Journalistin etwas herausfindet? Wird er das aushalten? Und wenn sie nichts findet? Wird er das aushalten? Das ist die neue Mühle, die sich in seinem Kopf dreht. Tagsüber und nachts, wenn er nicht schlafen kann. Und plötzlich taucht in diesem Gedankenwirbel seine allererste Erinnerung auf, an die er lange nicht mehr gedacht hat.
Er steht auf einem Tisch – und um den Tisch herum stehen schwarze Männer. Das ist alles. Er kann sich nicht an Gefühle erinnern. Ob er Angst hatte, ob er aufgeregt war – oder neugierig. Er weiß nicht, ob die Männer geredet haben, was sie getan haben. Es ist, als betrachte er ein Foto. Aber er ist sicher, seine erste Erinnerung ist kein Foto. Er hat wirklich auf diesem Tisch gestanden. Und auch die schwarzen Männer waren wirklich da.
Sonja ist die Einzige, die von dieser Erinnerung weiß. Als er ihr vor vielen Jahren davon erzählt hat, musste sie zuerst lachen. Mit Geschichten vom »Schwarzen Mann« habe man ihr als Kind auch Angst einjagt. Aber dann hat sie verstanden, welchen Schatz ihr Mann ihr da anvertraut hat. Als er sie jetzt daran erinnert, sagt sie nur: Das musst du der Journalistin erzählen! Das geht nicht am Telefon, gibt er zurück. Eben, sagt Sonja. Deshalb wollte sie ja kommen.
1 Ingeburg Schäfer: Mutter mochte Himmler nie. Die Geschichte einer SS-Familie. Reinbek bei Hamburg 1999, S. 109
Tausend offene Fragen: »Haben Sie Akten über Klaus B.?«
Dass eine Geschichte so beginnt, hat sie noch nicht erlebt. Dieses Zögern. Dieses Unentschiedene. Dieses Vertrösten. Er will keine Begegnung – aber wenn sie miteinander telefonieren, ist er offen, erzählt und ist kaum zu bremsen. Andere Lebensborn-Kinder, die keinen Kontakt wollten, haben einfach den Hörer aufgelegt oder auf Briefe nicht reagiert. Aber er lässt sich auf ihre Fragen ein. Ist das nicht eine Art Einverständnis?
Warum er wohl nie versucht hat, etwas über die Zeit herauszufinden, bevor er zu den Schäfers gekommen ist? Bisher wollten fast alle Lebensborn-Kinder, die sie kennt, irgendwann wissen, was mit ihnen früher passiert ist. Warum sie in einem dieser SS-Heime waren. Warum sie keine Geburtsurkunde besitzen. Warum die Erwachsenen sich in Schweigen gehüllt haben.
Also haben sie Behörden angeschrieben und Auskunft verlangt. Sind in Archive gegangen. Haben sich von Absagen oder Aktenbergen nicht abschrecken lassen. Ein Weg, für den sie einiges an Hartnäckigkeit, Zuversicht und Fantasie aufbringen mussten. Vom Geld, das die Recherchen gekostet haben, ganz abgesehen. Aber am Ende waren die dunklen Ecken ausgeleuchtet und die Geheimnisse entschlüsselt, mehr oder weniger.
Vielleicht wusste Klaus B. nicht, wie und wo er suchen sollte? Vielleicht hat er geahnt, welche Kraft eine solche Recherche kostet – und sich diese Kraft nicht zugetraut? Vielleicht hat er Angst vor der Unruhe, die damit in sein Leben kommt? Vielleicht hat er Angst vor der Wahrheit?
Oder hatte er einfach keinen Grund, an der Geschichte zu zweifeln, die man ihm über seine Herkunft erzählt hat? Denn irgendetwas werden die Schäfers ihm ja erzählt haben.
Und nun kommt sie und fängt an, nach der Wahrheit zu fragen. Versucht hartnäckig, ihn zu seinem Glück zu zwingen. Aber bedeuten Wissen und Wahrheit automatisch Glück? Vielleicht sind sie sein Unglück? Einmal vorausgesetzt, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommt …
An den Internationalen Suchdienst/International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Bitte, in Ihrem Archiv nach Dokumenten über Klaus B. zu recherchieren, schicke ich Ihnen seine Daten und seine Vollmacht.
Geboren am 11. August 1939, Geburtsort: Dresden. Ich habe Zweifel, dass diese Angaben richtig sind.
Geburtsort Dresden ist garantiert falsch. Wer etwas vertuschen, verschleiern oder verfälschen will, ist mit Dresden auf der sicheren Seite. Bei diesem Stichwort denkt man doch sofort: Da ist im Februar 1945 alles verbrannt.
Seine Eltern sind angeblich beide früh gestorben, ihre Geburts- und Sterbedaten sind nicht bekannt.
Friedrich B. …
Ein Allerweltsname. Damals gab es sicher Hunderte, die so hießen. Ohne ein Geburtsdatum gibt es wahrscheinlich keine Chance, den Richtigen zu finden. Wenn es den Richtigen überhaupt gegeben hat.
Friedrich B. soll 1942 in Russland gefallen sein, weitere Angaben fehlen. Maria B., geborene G., soll kurz nach der Geburt gestorben sein.
Klaus B. kennt von seinen Eltern wirklich kein einziges Datum. Keine Geburtsdaten, keine Todesdaten, nichts.
Im April 1944, wenige Tage nach Ostern, wurde Klaus B. von einer Eva Schäfer aus dem Lebensborn-Heim in Bad Polzin abgeholt und als Pflegekind in die Familie aufgenommen. Ihr Ehemann hieß mit Vornamen Johannes. Er war NSDAP-, SA- und SS-Mitglied und hatte zeitweise den Rang eines SS-Brigadeführers. Die Familie wohnte 1944 in Köslin, Mühlentorstraße 39. Klaus B. ist bei ihr aufgewachsen, aber nie adoptiert worden. Ich vermute, dass er eine andere Identität hatte, bevor er zu Familie Schäfer gekommen ist. Er könnte eins der verschleppten Kinder aus Osteuropa sein.
Mit freundlichem Gruß …
Der Internationale Suchdienst (ITS) in Bad Arolsen hat über dreißig Millionen Dokumente aus der Kriegs- und Nachkriegszeit gesammelt und archiviert. Wenn darunter nichts über Klaus B. zu finden ist … Vorausgesetzt, die Vermutung stimmt: dass er als Kind gestohlen, gekidnappt, geraubt wurde. Irgendwo in einem osteuropäischen Land.
Die Stiefeltern – 1930–1944
Die Journalistin nimmt sich noch einmal das Buch von Ingeburg Schäfer vor, in dem sie auf Klaus B. gestoßen ist: »Mutter mochte Himmler nie. Die Geschichte einer SS-Familie«. Auf dem Cover ein Hochzeitsfoto. Johannes Schäfer in SA-Uniform, Eva Krieger als romantische Braut in langem Kleid, mit Schleier und weißem Nelkenstrauß. Untergehakt marschieren die beiden durch eine Gasse uniformierter junger Männer, die den Hitlergruß zeigen. Eine echte nationalsozialistische Hochzeit – im Jahre 1932!
Ja, Eva und Johannes Schäfer waren überzeugte Nationalsozialisten. Ihre Tochter redet in ihrem Buch nicht darum herum. Und Ingeburg Schäfer tut noch ein Übriges: Sie gräbt in der Familiengeschichte nach Wurzeln für diese Weltanschauung.
Eva Krieger und Johannes Schäfer kamen aus reaktionären, nationalistischen Elternhäusern. Beide Väter waren schon früh in die NSDAP eingetreten. Vater Schäfer, ein Postbeamter, gehörte außerdem einem Freikorps an, das mit Gewalt die Weimarer Republik unterminierte. Vater Krieger war als »Pfarrer im Braunhemd« bekannt, er propagierte offensiv nationalsozialistische Ziele und geriet dabei immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Beide Väter prägten ihre Familien, ihre Kinder. Und die Mütter? Klar ist nur, dass Eva Krieger ihre Mutter mit zehn Jahren verlor und kurz nach dem Auftauchen der Stiefmutter in ein Internat geschickt wurde.
Die junge Frau war neunzehn, als sie 1930 den acht Jahre älteren Johannes Schäfer kennenlernte, auf einem Gauparteitag der NSDAP in Chemnitz. Sie arbeitete damals bei der Gauleitung Sachsen, er war SA-Führer in Halle und wie Eva schon einige Jahre Mitglied der Nazi-Partei.
Johannes Schäfer hatte Drogerie-Kaufmann gelernt, aber er hasste seinen Beruf und träumte von einem Soldatenleben. Deshalb trat er dem Freikorps bei, in dem sein Vater aktiv war, und ging 1925 zur Heeresfachschule der Reichswehr, musste aber aus Geldmangel die Ausbildung zum Offizier abbrechen. Als ihm eine Führungsrolle in der SA angeboten wurde, hatte Schäfer seinen Traumjob gefunden. Damals wurde die SA zur paramilitärischen Organisation ausgebaut. Damit war Schäfer quasi Militär.
Eva Krieger hatte keine Berufsausbildung, arbeitete aber als eine Art politische Sekretärin in verschiedenen NS-Organisationen. Gleichzeitig engagierte sie sich (wie Schäfer) im völkischen Bund der Artamanen. Der propagierte eine Rückkehr zum »einfachen Landleben« und war strikt antipolnisch eingestellt. Schon damals arbeiteten viele Polen als Saisonarbeiter in der deutschen Landwirtschaft. Sie standen offenbar dem einfachen Landleben im Weg.
Im August 1932 heirateten die beiden Gleichgesinnten. Drei Monate später gewann Schäfer ein Reichstagsmandat für die NSDAP und blieb vier Jahre lang Abgeordneter. Sein Hauptbetätigungsfeld war aber nach wie vor die paramilitärische Ausbildung der SA. Zuerst in Halle, dann in Wernigerode und Magdeburg. Nach dem Röhm-Putsch 1934 wurde Schäfer Mitglied der SS. Zuerst zog er nach Dresden, 1935 nach Frankfurt am Main. Dort war er Führer der 2. SS-Standarte und hatte damit etwa anderthalbtausend Mann unter sich. Eva übernahm bereitwillig die Rolle, die der Nationalsozialismus den Frauen verordnete. Sie folgte ihrem Mann von Stadt zu Stadt, hielt ihm den Rücken frei und bekam ihre ersten beiden Kinder, Ingeburg und Ursula.
In Frankfurt geriet Schäfer mit anderen SS-Führern aneinander. Man konkurrierte um Posten und Pfründe, aber offenbar ging es auch um so etwas wie Ehre und Ideale. Zusätzlich befeuerte Schäfers cholerisches Temperament die Auseinandersetzungen. Die Lösung lautete: Versetzung. 1936 kam Schäfer ins Berliner Hauptamt der Sicherheitsstaffel, von dort ging es weiter nach Königsberg. Anfang 1938 ernannte ihn Heinrich Himmler zum Standartenführer des 26. SS-Abschnitts in Danzig, der deutlich größer als der Frankfurter Abschnitt war. Im Sommer 1939 wurde ihm dann die gesamte Polizei und Hilfspolizei der Stadt unterstellt. Damit war Schäfer faktisch Polizeichef von Danzig – in einer Stadt, deren Konfliktpotenzial mit Händen zu greifen war: Seit dem Versailler Vertrag gehörte Danzig nicht mehr zum Deutschen Reich, sondern stand als »Freie Stadt« unter der Hoheit des Völkerbunds. Und sie lag mitten in Polen.
In Danzig hatte das Wanderleben der Familie vorerst ein Ende. Die Schäfers ließen sich nieder und führten ein großbürgerliches Leben, mit Ausflügen, Opernbesuchen, repräsentativen Einladungen. Doch hinter den glänzenden Kulissen war Schäfer mit den heimlichen Kriegsvorbereitungen des NS-Regimes gegen Polen beschäftigt.
Mittlerweile hat sich die Journalistin ein paar Geschichtsbücher herangeholt. Denn je mehr es um die große Politik und Johannes Schäfers Taten geht, desto vorsichtiger wird seine älteste Tochter Ingeburg. Häufig überlässt sie dann ihrem Vater und seinen legitimatorischen Lebenserinnerungen2 aus der Nachkriegszeit das Wort. Dabei ist klar: War Schäfer vorher Agitator und Organisator, Lehrmeister und Scharfmacher, wurde er in Danzig zum Planer und Organisator einer Aggression, die den Zweiten Weltkrieg auslöste. Mit Tricks und Täuschungsmanövern wurden Waffen und Menschen in die Stadt geschleust, bis Danzig einem Heerlager glich. Es hieß, die Stadt müsse vor einem polnischen Angriff geschützt werden, tatsächlich ging es um die Zerschlagung der polnischen Institutionen, die der Völkerbund dort zugestanden hatte (zum Beispiel Bahn, Zoll, Post- und Telegrafenverwaltung) – und um den Angriffskrieg.
Im August 1939 verließen viele Polen die Stadt, Johannes Schäfer ließ Frau und Kinder ausfliegen – mittlerweile waren es drei, kurz zuvor war ein Sohn auf die Welt gekommen, Volker, der »Stammhalter«. In der Nacht zum 1. September 1939 gab Hitler den Angriffsbefehl gegen Polen. Frühmorgens wurde die Westerplatte beschossen, eine Halbinsel am Danziger Stadtrand, auf der ein großes polnisches Munitionsdepot untergebracht war. Ein weiteres Angriffsziel waren die polnischen Institutionen. Die Post wurde besonders heftig verteidigt, die letzten Beamten gaben erst auf, als die Gebäude in Brand gesteckt worden waren. Wenige Tage später wurden sie als »Freischärler« zum Tode verurteilt und erschossen.
Johannes Schäfer trug die Verantwortung für die brutalen Einsätze. Drei Wochen später – der »Polenfeldzug« war noch nicht beendet – beförderte ihn Himmler höchstpersönlich zum SS-Brigadeführer. Mit dem vierthöchsten SS-Rang war Schäfer auf dem Gipfel seiner Karriere angekommen.
Wenig später wurde er nach Łođź versetzt, das zuerst in Lodsch und dann in Litzmannstadt umbenannt wurde. Die Familie blieb in Danzig, Eva hatte sich geweigert mitzugehen. Sie wollte nicht in einer besetzten polnischen Stadt leben – dabei hatte sie als junge Artamanin einmal von einer »Ostbesiedlung« geträumt und einer »Siedlungsmission« das Wort geredet. In Łođź übernahm Schäfer den Posten des Polizeipräsidenten. »Hier sollte nun Ordnung einziehen, so dass Deutsche dort leben und arbeiten konnten«3, so beschrieb er seine Aufgabe in seinen Lebenserinnerungen. Tatsächlich hatte die deutsche Besetzung die Stadt ins Chaos gestürzt. Die polnische Administration war vertrieben. Mitglieder des Volksdeutschen Selbstschutzes (einer paramilitärischen Terrororganisation unter SS-Regie, getarnt als Organisation in Polen lebender Deutscher) spielten sich als neue Herren auf und übten Selbstjustiz. Dazu kam der Terror der Einsatzkommandos von SS und Gestapo, die gegen Juden, Intellektuelle, politische Gegner, Roma und Homosexuelle massiv vorgingen. In der Nachkriegszeit schilderte Schäfer das so:
Die Einsatzkommandos machten, was sie wollten. Sie beschlagnahmten Wohnungen, fingen Juden auf der Straße ein … jeder regierte und bereicherte sich u. U. auch.4
Dagegen setzte Polizeichef Schäfer »die Befriedung der Stadt und Bildung des Ghettos mit 250 000 Juden.«5
Tatsächlich begann Schäfer, eine neue Infrastruktur aufzubauen. Dazu stellte er sogar die polnischen Polizeibeamten wieder ein. Für Juden war allerdings in seiner deutschen Stadt kein Platz. Im Februar 1940 befahl er die Errichtung eines Ghettos – es war das erste in Polen – und seine hermetische Abriegelung. 100 000 Menschen wurden gezwungen, sofort ins Armenviertel der Stadt umzuziehen. Ihr altes Leben mussten sie zurücklassen – und nach Monaten voller Angst, Drangsalierung, Ausbeutung und Hunger wurden die meisten in die Vernichtungslager von Kulmhof, Majdanek, Auschwitz, Treblinka und Sobibor deportiert.
Aus der Nähe erlebte Schäfer die schreckliche Konsequenz seiner Befehle nicht mehr mit. Nach rund neun Monaten verlor er den Posten des Polizeipräsidenten von Łođź auf Anweisung Himmlers, wenig später auch die Führung des SS-Abschnitts, der ihm dort unterstellt war. Der Grund: Schäfer lag wieder im Clinch mit anderen SS-Führern, und wieder ging es vor allem um Macht, Privilegien und Pfründe. Diesmal warfen sich die »Herren« gegenseitig Bereicherung vor. Später erklärte Schäfer immer, alles bezahlt zu haben, was er in Litzmannstadt erworben habe.
In Stettin, seiner nächsten Station, übernahm Schäfer wie früher einen Ausbildungsposten, diesmal war es das vormilitärische Training der Hitlerjugend. Seinen Rang als SS-Brigadeführer behielt er vorerst – trotzdem markierte die Versetzung den Beginn seines Abstiegs. Zwei Jahre später wurde er nach Köslin versetzt. Auch diesmal steckten interne Auseinandersetzungen dahinter: Der Gauleiter von Pommern hatte sogar ein Parteigerichtsverfahren gegen Schäfer angestrengt, wegen Kompetenzüberschreitung.
Fazit: Johannes Schäfer missachtete Hierarchien, agierte eigenmächtig und eigensinnig, nahm kein Blatt vor den Mund und teilte aus. Damit störte er den Betrieb – die Antwort hieß: Versetzung.
Eva und die drei Kinder – mittlerweile neun, sieben und drei Jahre alt – folgten dem Familienvater in die pommersche Kleinstadt Köslin und bezogen eine Acht-Zimmer- Wohnung in einem eleganten Bürgerhaus. Allerdings blieb Schäfer nicht lange bei ihnen. Nach einem Verfahren wegen »parteischädigendem Verhalten« ging Himmler Anfang 1943 einen Schritt weiter, leitete ein SS- und Polizeigerichtsverfahren gegen Schäfer ein und sorgte dafür, dass er zur Waffen-SS eingezogen wurde. Dort bekam er den Rang eines Feldwebels – und war damit seinen »SS-Brigadeführer« los. Ein steiler Absturz für den knapp Vierzigjährigen.
Eva und die Kinder blieben in Köslin, während Schäfer nun in Stralsund Rekruten ausbildete. Anfang Mai 1943 wurde er an die Front vor Leningrad verlegt, am Monatsende landete er wegen Sumpffieber in einem Lazarett in Riga. Schließlich kam er zu einer Genesenden-Kompanie in Holland. Unterdessen brachte Eva im Juli 1943 Gero zur Welt, ihr viertes Kind.
Gleichzeitig mit dem Baby trafen zwei weitere Personen im Kösliner Haushalt ein. Irmi, eine entfernte Verwandte, reiste als Pflichtjahrmädchen an. Und Großmutter Schäfer suchte im ruhigen Köslin Zuflucht, nachdem sie in Leipzig ausgebombt worden war. Irmi wurde für Eva eine zuverlässige Unterstützung, die Schwiegermutter allerdings zur permanenten Belastung.
Als wären vier kleine Kinder, die schwierige Versorgungslage und der Stress mit der Schwiegermutter nicht genug – die dreiunddreißigjährige Eva engagierte sich zusätzlich beim Roten Kreuz. Sie übernahm Büro- und Organisationsaufgaben, betreute Evakuierte und Flüchtlinge, gab Erste-Hilfe-Kurse. Und neun Monate nach Geros Geburt, am 11. oder 12. April 1944, fuhr sie nach Bad Polzin und holte ein Pflegekind in ihre Familie – laut Familienerzählung wollte sie immer fünf Kinder haben.





























