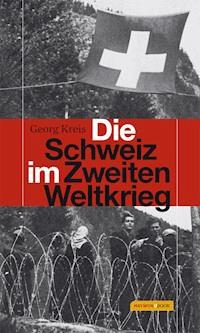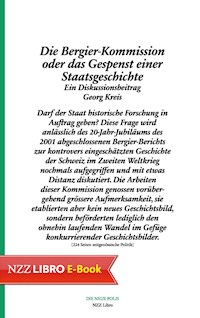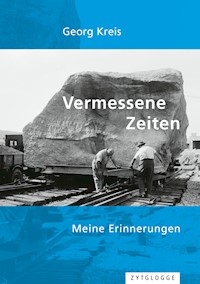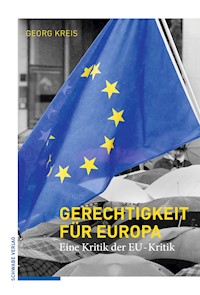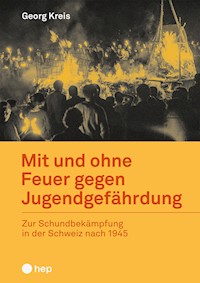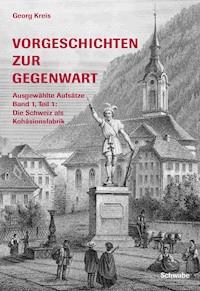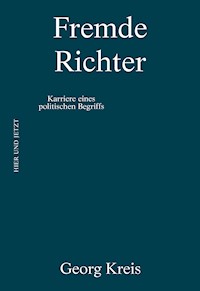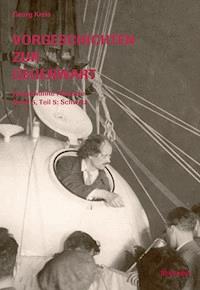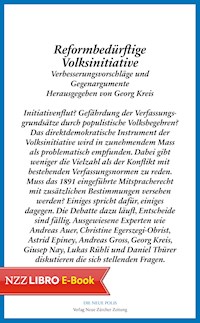
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Muss das 1891 eingeführte Mitspracherecht des Volkes mit zusätzlichen Bestimmungen versehen werden? Sind die Verfassungsgrundsätze durch populistische Volksbegehren gefährdet? Seit einiger Zeit wird in öffentlichen Diskussionen eine Revision des Initiativrechts gefordert und es werden Massnahmen erörtert, die der Vielzahl der Volksinitiativen entgegenwirken und insbesondere die Konflikte mit bestehenden Verfassungsbestimmungen vermeiden. Auch die Staatspolitische Kommission des Ständerats hat sich eingehend mit dem heissen Eisen befasst und im August 2015 fünf Reformvorschläge unterbreitet. Der aktuelle Band in der Reihe «Die neue Polis» umfasst acht Beiträge, in denen ausgewiesene Experten und Expertinnen aus historischer, politischer und vor allem aus juristischer Sicht die sich stellenden Fragen diskutieren. Mit Beiträgen von Andreas Auer, Christine Egerszegi- Obrist, Astrid Epiney, Andreas Gross, Georg Kreis, Giusep Nay, Lukas Rühli, Daniel Thürer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[DIE NEUE POLIS]
Herausgegeben von Astrid Epiney, Dieter Freiburghaus, Kurt Imhof (†) und Georg Kreis
DIE NEUE POLIS ist Plattform für wichtige staatsrechtliche, politische, ökonomische und zeitgeschichtliche Fragen der Schweiz. Eine profilierte Herausgeberschaft versammelt namhafte Autoren aus verschiedenen Disziplinen, die das Für und Wider von Standpunkten zu aktuellen Fragen analysieren, kontrovers diskutieren und in einen grösseren Zusammenhang stellen. Damit leisten sie einen spannenden Beitrag zum gesellschaftspolitischen Diskurs. Vorgesehen sind jährlich zwei bis drei Bände in handlichem Format und wiedererkennbarem Auftritt für ein breites, am aktuellen Zeitgeschehen interessiertes Publikum.
Verlag Neue Zürcher Zeitung
Reformbedürftige VolksinitiativeVerbesserungsvorschläge und Gegenargumente
Herausgegeben von Georg Kreis
Mit Beiträgen von Andreas Auer, Christine Egerszegi-Obrist, Astrid Epiney, Andreas Gross, Georg Kreis, Giusep Nay, Lukas Rühli und Daniel Thürer
Verlag Neue Zürcher Zeitung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
©2016 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2015 (ISBN 978-3-03810-155-0) Titelgestaltung: unfolded, Zürich Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts. ISBN E-Book 978-3-03810-174-1 www.nzz-libro.ch
Vorwort
Im Juni 2015 waren 14Initiativen im Verarbeitungsprozess hängig oder abstimmungsreif, und wiederum 14Initiativen waren im Sammelstadium. Die Zahlen könnten inzwischen noch gestiegen sein. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass von weiteren Initiativen mindestens die Rede ist. Darum sprechen manche von einer «Initiativenflut». Mehr als die Menge dürften indessen bestimmte Initiativinhalte irritieren – und die Erfahrung, dass sie angenommen wurden, sowie die folgerichtige Befürchtung, dass solche Initiativen wahrscheinlich weiterhin Erfolg haben könnten.
Das Mengenproblem ist von der Staatspolitischen Kommission des Ständerats so umschrieben worden: «Seit Bestehen des Instruments der Volksinitiative (1891) sind Volk und Ständen 200Initiativen zur Abstimmung unterbreitet worden. Gut ein Drittel dieser Volksabstimmungen fanden in diesem Jahrhundert statt, also in den letzten 15Jahren, was auf die grosse Beliebtheit dieses Instrumentes in jüngster Zeit hinweist. Noch markanter ist die Zunahme von Volksinitiativen, welche in der Abstimmung erfolgreich waren: Von den 200Volksinitiativen wurden insgesamt 22 von Volk und Ständen angenommen, wobei seit der Jahrtausendwende zehn erfolgreich waren.»1
Muss nun das Initiativrecht mit zusätzlichen, domestizierenden Bestimmungen versehen werden? Einiges spricht dafür, einiges dagegen. Eine dritte Frage ist, ob eine Reform, wenn sie denn als wünschbar und nötig erscheinen würde, politisch überhaupt realisierbar wäre. Dazu gibt es sehr skeptische Stimmen, die mit Blick auf die versandeten Reformbemühungen der letzten Jahre ernüchtert an der Reformierbarkeit der staatlichen Institutionen zweifeln und hinsichtlich der Volksinitiative der Meinung sind, dass nichts anderes übrig bleibt, als sich fallweise mit den Inhalten der Volksinitiativen auseinanderzusetzen und auf die Kraft der Argumente zu zählen.2
Die Debatte dazu läuft, Entscheide sind oder wären fällig. Der vorliegende Band umfasst acht Beiträge, in denen ausgewiesene Experten und Expertinnen aus historischer, politischer und vor allem aus juristischer Sicht die sich stellenden Fragen diskutieren. Dabei kommt es unvermeidlicherweise zu gewissen Überschneidungen, die aber aus Rücksicht auf die Argumentationsführung der einzelnen Beiträge bewusst nicht vermieden wurden.
In einem ersten Beitrag werden von Herausgeberseite die Anfänge des 1891 auf Bundesebene in einem Reformakt in das politische System eingeführten Instruments der direkten Mitbestimmung in Erinnerung gerufen und der inzwischen offensichtlich gewordene neue Reformbedarf aufgezeigt sowie die verschiedenen Reformvorschläge der jüngsten Zeit vorgestellt.
Andreas Gross würdigt, nachdem er den Eindruck der Vielzahl der Volksinitiativen relativiert hat, die für die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen wichtige Möglichkeit der direkten Einwirkung auf die Politik. Er will diese nicht auf allgemeine Anregungen beschränkt sehen und sieht in der Veranlassung von Gegeninitiativen einen konstruktiven Effekt. Gross hält aber auch eine Begrenzung der Volksinitiativen für nötig, wenn diese nicht «auf den Ball», sondern auf «Mitspieler», das heisst Mitglieder der Gesellschaft, zielen. Volksinitiativen, die mit den Menschenrechten kollidieren, sollen dies entweder explizit deklarieren müssen, oder sie sollen aber vor allem vom Parlament, gestützt auf einen noch in die Verfassung einzufügenden Vorbehalt dieser Art, an das Bundesgericht zur Nachredaktion weitergegeben werden.
Andreas Auer ist dezidiert der Meinung, dass sich das Problem der menschenrechtswidrigen Volksinitiativen ohne Verfassungsrevision, ohne Abbau der Volksrechte, ohne Verminderung des Grundrechtsschutzes, ohne Neuinterpretation klassischer Rechtsinstitute wie jenes des zwingenden Völkerrechts und auch ohne Ausbau der Verfassungsgerichtsbarkeit bewältigen lasse. Er setzt vor allem darauf, dass die Richter in Lausanne und Strassburg, wie das Bundesgericht bei kantonalen Volksvorlagen, grundrechtswidrigen Verfassungsbestimmungen im Einzelfall die Anwendung versagt. Grundrechte dürften von Volksinitiativen zwar eingeschränkt, aber nicht verletzt werden.
Daniel Thürer wirft einen Blick auf neuere, zum Teil fragwürdige Entwicklungen der direkten Demokratie und die moderne, oft verkannte Gestalt des Völkerrechts sowie auf das innere Spannungsverhältnis zwischen Volksinitiative und Völkerrecht. Er hebt insbesondere hervor, dass das Völkerrecht längst nicht mehr als «Machwerk» von Regierungsabkommen erscheint, sondern sich selbst als demokratisch begründete Ordnung versteht und den Staaten demokratische Ordnungsstrukturen vorschreibe. Thürer entwickelt zwei Vorschläge zur Verhinderung von Kollisionsproblemen und zur Vermeidung, dass Bürger tyrannische Entscheide über Nichtbürger, Mitglieder über Nichtmitglieder fällen. Die Richter sollen als Garanten von Fairness im demokratischen Prozess vermehrt angerufen werden können.
Astrid Epiney geht davon aus, dass nicht Bundesgesetze und Völkerrecht durch schwer umsetzbare Volksinitiativen «Massgeblichkeit» verlieren, sondern es die Volksinitiativen sind, weil sie nur in eingeschränktem Mass die angestrebte Rechtswirkung entfalten können. Diese Inkongruenz rufe dennoch nach einer Reform. Epiney diskutiert vier Reformvarianten und hält die vierte, die Initiative in Form einer allgemeinen Anregung, für die beste, weil sie den nötigen Umsetzungsspielraum zur Verfügung stellt. Auch könne diese Form der Initiative durchaus effektiv sein. Allerdings wäre eine derartige Beschränkung aus politischer Sicht wohl nicht ganz einfach zu verwirklichen, sodass auch darüber hinaus über eine Revision des Artikels139 BV nachgedacht werden sollte (z.B. über eine Erhöhung der Unterschriftenzahlen für die Volksinitiative in der Form der allgemeinen Anregung auf 200000).
Ausgehend davon, dass Rechte der Menschen nicht Rechte anderer Menschen beschneiden dürfen, betont Giusep Nay, dass nicht einzig ein Verstoss gegen das zwingende Völkerrecht, sondern auch gegen den Grundbestand der Bundesverfassung mit den Grundrechtsgarantien und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit ein Grund für die Ungültigerklärung einer Volksinitiative sein muss, weil Ersteres sonst nicht garantiert ist und sich das Volk als Gemeinschaft gleichberechtigter Menschen selbst disqualifiziert. Solche Initiativen sind – das ihr besonderer Ansatz – auch nicht umsetzbar, verschaukeln nur das Volk und verletzen so die Garantie der unverfälschten Stimmabgabe. Er befürwortet eine nicht bindende materielle (und nicht nur formelle) Vorprüfung von Initiativen vor der Unterschriftensammlung durch die Bundeskanzlei. Nay tritt aber auch für die Schaffung einer Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht gegen die Gültig- oder Ungültigerklärung von Volksinitiativen durch die Bundesversammlung ein.
Welche wirtschaftliche Bedeutung hat die Handhabung von Volksinitiativen? Lukas Rühli beurteilt in seinem Beitrag die Wirtschaftsfreundlichkeit von «Volksinterventionen» anhand der Parolen der wirtschaftsnahen Verbände. Demnach sei die grosse Mehrheit der Volksinitiativen wirtschaftsrelevant und davon seien fast alle wirtschaftskritisch. Bei den wirtschaftlichen Akteuren führe das derzeit zu einer gewissen Verunsicherung bezüglich der Stabilität der guten Rahmenbedingungen in der Schweiz. Allerdings habe sich nicht so sehr der Charakter der Volksinitiativen verändert, sondern vielmehr sei schlicht ihre Zahl gestiegen. Dem auch seines Erachtens bestehenden Reformbedarf könne man in mehrfacher Weise Genüge tun, zum Beispiel mit der Erhöhung des Unterschriftenquorums auf rund 211000 (was 4Prozent der Stimmberechtigten entspräche), mit der Beschränkung der Vorlagen pro Abstimmungstermin und mit der Einführung der Gesetzesinitiative.
Abschliessend würdigt Christine Egerszegi-Obrist nochmals die konstruktive Seite der Volksinitiativen, setzt sich dann aber eingehend mit den «Schattenseiten» auseinander. Dabei betont sie, dass der gegebene, vom Volk ebenfalls gutgeheissene Verfassungsbestand zu achten sei und die nach der Annahme von Volksinitiativen nötige Umsetzungsaufgabe des Gesetzgebers nicht mit Durchsetzungsinitiativen vorschnell beeinträchtigt werden dürfe. Die Reformvorschläge der Staatspolitischen Kommission des Ständerats, der sie selbst angehört hat, wertet sie als kleinen, aber wichtigen Schritt vorwärts.
Die hier vorgenommene Auslegeordnung verweist auf die in jüngerer Zeit akzentuiert in Erscheinung getretene Problematik und zeigt Lösungen auf. Letztere müssen, sofern die jetzige Regelung und ihre Nutzung als reformbedürftig eingestuft werden, im politischen Prozess weiterverfolgt werden.
Georg Kreis
[1]
Die Volksinitiative – eine historische Altlast?
Als der moderne Bundesstaat geschaffen wurde, war man überhaupt nicht der Meinung, dass die inzwischen als urschweizerisch verstandene Volksinitiative unbedingt dazugehören müsse. Die Schweiz ist nicht mit dem Initiativrecht zur Welt gekommen, dieses Recht stand ihr weder 1291 noch 1848 zur Verfügung.3 Es kam erst 700Jahre nach dem Bundesbrief und 43Jahre nach der Bundesverfassung hinzu. Und so, wie es gekommen ist, könnte es – theoretisch – auch wieder verschwinden oder wenigstens modifiziert werden. Spricht man von Modifizieren, muss man ehrlicherweise einräumen, dass damit domestizierende, ja zivilisierende Einschränkungen gemeint sind. Angesichts der derzeitigen wilden, ja wildwütigen Inanspruchnahme des Instruments der Volksinitiative genügt es jedenfalls nicht, festzustellen, dass der Souverän mitunter von sich aus so etwas wie weise Selbstbeschränkung übe.
Mit dem Hinweis darauf, dass diese Einrichtung einmal geschaffen wurde, also die Qualität von etwas Gemachtem hat, soll dem fundamentalistischen, auf Ewigkeit ausgerichteten und verabsolutierenden Umgang entgegengewirkt und so Raum für ein Nachdenken über die gegenwärtige Bedeutung und über bestehende Reformmöglichkeiten beansprucht werden. Jetzt gibt es dieses Volksrecht, darum muss man mit ihm leben. Seine Nutzungsmöglichkeiten sollten indessen auf eine Weise geregelt sein, dass die unbestreitbaren Stärken erhalten bleiben, seine potenziellen Schwächen aber neutralisiert werden. Worin die Stärken der Volksinitiative liegen, darüber kann man sich leichter einig werden. Uneinigkeit besteht im Eingestehen der Schwächen und im Abwägen zwischen Stärken und Schwächen.
Die Stärken der Volksinitiative würdigend, wird von diesem Instrument gerne gesagt, es signalisiere bis zu einem gewissen Grad, wo «dem Volk» der Schuh drücke; es leiste seinen Beitrag zur Kohäsion im Land und zum Glauben an das System; es setze dem zu sehr eingespielten Politbetrieb etwas Dampf auf und führe mit radikalen Vorstössen zur Entwicklung von «vernünftigen» und entsprechend annehmbaren Gegenvorschlägen; es stärke in allgemeiner Weise das Selbstwertgefühl der Bürger; es führe zu öffentlichen Debatten und ermögliche so kollektives Lernen, wenn es dieses auch nicht garantiere.4
Was die Staatsordnung und die Demokratie stärkt oder schwächt, hängt zum Teil gewiss vom persönlichen Ermessen ab. Das kann aber nicht heissen, dass nicht trotzdem darüber nachgedacht und öffentlich debattiert werden kann – ganz im Gegenteil. In der Diskussion um die konkrete Einzelnutzung des Initiativ-Rechts besteht die Tendenz, das Recht zu verabsolutieren und der inhaltlichen, auch ethischen Diskussion mit dem Argument auszuweichen, dass man ja nur von einem zustehenden Recht Gebrauch mache und sich dieses nicht streitig machen lasse.5
[1.1]
Wandel im Reformverständnis
Es bedeutete eine fundamentale Neuerung und einen grossen Schritt, dass 1848 mit Artikel112 der Bundesverfassung überhaupt die Möglichkeit geschaffen wurde, dass Bürger mit 50000Unterschriften eine Gesamtrevision der Verfassung verlangen konnten. Im Laufe der 1860er-Jahre zeigte sich allerdings das Bedürfnis, auch nur Teilrevisionen vornehmen zu können. So wurden von den Eidgenössischen Räten schon 1865 gleich neun neue Verfassungsartikel erarbeitet und im Januar 1866 dem Volk vorgelegt. Angenommen wurden indessen bloss die Vorlage zu Mass und Gewicht (Art.37) und zur Gleichstellung der Juden (Art.41 und Art.48); die anderen sieben (z.B. Art.54a zum Verbot bestimmter Strafarten, insbesondere der Prügelstrafe, die in einem konkreten Fall im Kanton Uri wegen Gotteslästerung verhängt worden war)6 schafften die benötigten Zustimmungsmehrheiten nicht. Bis 1890 folgten weitere fünf von Bundesrat und Parlament vorgeschlagene Partialrevisionen, die alle dem Volk vorgelegt und mit einer Ausnahme auch angenommen wurden. Die beiden Totalrevisionsvorlagen von 1872 und 1874 waren im Übrigen auch nicht über ausserparlamentarische Aktionen, sondern von Bundesrat und Parlament ausgelöst worden.7 Mit der schliesslich aber abgelehnten Revisionsvorlage von 1872 war das Initiativrecht für Bundesgesetze (nicht für Verfassungsartikel) und nur mit einfachem Volksmehr vorübergehend in Griffnähe. Es wurde dann jedoch aus der Vorlage von 1874 wieder herausgenommen, unter anderem weil es kein Ständemehr vorgesehen hatte. 1872 war die Volksinitiative als progressives Instrument8 und als Gegengewicht gegen das bremsende Referendum und als «Krönung des Systems» propagiert worden. Der grossbürgerliche Unternehmer Alfred Escher sah darin lediglich eine «Modetorheit», und die Bundesversammlung würde es kaum wagen, einem vom Volk geäusserten Wunsch nicht nachzukommen.9 Der Thurgauer Demokrat Adolf Deucher erklärte dagegen, ein Begehren, das 30000Unterschriften vereinige (es war da nicht von 50000 die Rede), müsse «etwas Überlegtes, Rechtes» sein und würde die Räte nicht zu «vergeblicher Arbeit» nötigen.10
Über die allererste infolge einer Unterschriftensammlung zustande gekommene Bundesvolksinitiative wurde im Oktober 1880 abge-stimmt, bevor es das Initiativrecht überhaupt gab.11 Nach dem damaligen Rechtsverständnis war ein Begehren bloss für eine Partialreform nicht regelkonform, darum wurde es als «konstitutionell unstatthaft» eingestuft, aber als Begehren für eine Totalrevision dann doch zur Abstimmung gebracht. Für die Zeit um 1890 kann man sagen, dass sich neben dem ursprünglichen Prinzip der Totalrevision auch die Praxis der Partialrevision bereits eingebürgert hatte, es aber noch einen weiteren Schritt brauchte, dass Einzelmodifikationen der Bundesverfassung auch über Unterschriftensammlungen gefordert werden konnten, wie das für eine Totalrevision bereits möglich war.
Der Fall von 1880 wie auch die Einführung von Volksinitiativen auf kantonaler Ebene seit den 1860er-Jahren verbesserten die Chancen einer Reform, welche Partialrevisionen auf dem Weg von Initiativbegehren vorsah. Es waren Nationalräte aus dem katholisch-konservativen Lager, die 1884 mit einer Motion mehrere Einzelrevisionen und darunter ausdrücklich die Einführung von Teilrevisionen einzelner Verfassungsartikel forderten.12 Es folgte eine Petition der Grütlivereine, die wiederum mehrere Revisionen und da auch eine Revision des Artikels120 in dem Sinne forderte, «dass 50000Schweizerbürgern das Recht eingeräumt werde, nicht nur eine totale, sondern auch eine partielle Verfassungsrevision anbegehren zu können».13
Der Bundesrat folgte in seiner Stellungnahme vom 13.Juni 1890 der Auffassung der Motionäre14 und erklärte, dass nicht nur in der Bundesversammlung, sondern «auch unmittelbar in Volkskreisen der Gedanke Platz greifen kann, es sei im Interesse der Entwicklung des Landes eine bestimmte hindernde Vorschrift der Verfassung zu ändern oder eine neue Bestimmung aufzustellen». Bezogen auf die vorgenommene Umdeutung des Vorstosses von 1880 räumte er ein, «dass für das Volk die Frage, ob die Bundesverfassung revidiert werden solle, eine ganz andere ist als die, ob dieser oder jener bestimmte Artikel aufgehoben, abgeändert oder ergänzt werden solle». Der Bundesrat stellte nicht nur auf die wachsenden Erwartungen von «Volkskreisen» ab, sondern behaftete auch die Bundesversammlung: Sie habe mit den von ihr selbst vorgenommenen Partialrevisionen beurkundet, «dass sie in denselben nicht nur keine Gefährdung des Wohles und der öffentlichen Ordnung des Landes erblickt, sondern solche successive, wohl geprüfte Einzelverbesserungen für gewöhnliche Zeiten für erspriesslicher hält als die Gesamtrevision». Und auf die vieljährige Erfahrung aller Kantone verweisend, beruhigte er, «dass diese demokratische Institution in praxi keineswegs zu zahlreichen, hastigen und unüberlegten Revisionsanregungen führt, und es ist kein Grund anzunehmen, dass sie im Bunde in ihren Wirkungen sich anders gestalten werde».15 Der Bundesrat versuchte hingegen sehr entschieden, einen Teil der Kompetenz bei sich und beim Parlament zu belassen, indem er nur allgemeine Anregungen (unformulierte Initiativen) zulassen wollte.
Die Neue Zürcher Zeitung, in dieser Frage grundsätzlich skeptisch, sah in der unformulierten Variante das geringere und in der ausformulierten Variante eben das grössere Übel; sie verwies auf die folgende Möglichkeit: «Irgend einige Politiker setzen sich in einem Hinterstübchen zusammen und arbeiten einen Vorschlag aus, der im Prinzip einer grossen Masse von Schweizerbürgern zusagt, der aber in einzelnen Ausführungen Anderen wieder nicht behagt und der sogar in diesen Einzelheiten mit bestehenden Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen im Widerspruch stehen kann.»16 Der Vorbehalt wegen der schweren Vereinbarkeit mit bestehenden Normen hat nichts an Aktualität eingebüsst (vgl. dazu insbesondere auch den Beitrag von Giusep Nay in diesem Band). Die Neue Zürcher Zeitung gab sich damit nicht zufrieden, sie doppelte wenige Tage später nach und stützte sich dabei auf Gottfried Kellers Spätwerk Martin Salander (1886). Darin liess Keller eine Figur auftreten, die meinte, dass «im Halbdunkel eines Bierstübchens» Millionen kostende Vorlagen fix und fertig ausgeheckt werden könnten.17
Aus den Beratungen in den Räten vom September und Dezember 1890 seien bloss zwei Argumente zitiert: Im grundsätzlich positiven Votum des nationalrätlichen Kommissionssprechers wurde der Befürchtung, dass Volksinitiativen zusätzliche Unruhe brächten, entgegengehalten, dass sie im Gegenteil eine rasche Wiederherstellung der Harmonie zwischen Volk und Behörden ermöglichten. Und gegen die Beschränkung auf die unformulierte Variante wurde gesagt, dass diese nicht viel mehr als eine Petition sei und das Parlament in seiner Selbstherrlichkeit bestätige.18 Schliesslich waren es die konservativen Kräfte, welche zusammen mit anderen Minderheitsgruppierungen von links bis rechts (Reformierte, Radikale, Demokraten, Sozialdemokraten, Bauern) in den Räten dafür sorgten, dass sich die Volksinitiative doch als ausformuliertes Begehren durchsetzte.
Die Bestimmung, dass mindestens 50000Unterschriften für eine Volksinitiative nötig seien, war kein vertieft diskutierter Punkt; sie entsprach der Bestimmung von 1848 für Totalrevisionen. Der Bundesrat machte sich aber kundig, was die Erfordernisse kantonaler Initiativen waren, und er stellte fest, dass nur Zürich mit erforderlichen Unterschriften von 6,3Prozent der Stimmberechtigten geringere Anforderungen hatte, während alle anderen Kantone, mit einem Maximum in Nidwalden von 28Prozent der Bürger, mehr hatten. Die bundesrätliche Botschaft von 1890 rechnete vor, dass man bei 50000Unterschriften, was 7,56Prozent der Stimmberechtigten entspräche, nur wenig über Zürich läge.
Die Mehrheit des Freisinns erwartete von der Einführung dieses aus-serparlamentarischen Mittels eine Beeinträchtigung seiner parlamentarischen Vormachtstellung und war schon deswegen gegen die Vorlage. Hinzu kam das im Grund konservative Argument der vormals fortschrittlichen Kräfte, dass ein fortwährendes «Herumflicken» an der Verfassung eine Gefahr für das Grundgesetz bedeute, weil es jederzeit infrage gestellt werden könne. Vereinzelt melden sich auch föderalistische Bedenken, weil – was heute deutlich spürbar ist – mit Volksinitiativen gesamtschweizerische Regelungen zustande kommen können, welche auf kantonale Unterschiede keine Rücksicht nehmen und diese einebnen. Kurz vor der Abstimmung warnte die Neue Zürcher Zeitung, dass das neue Volksrecht «für längere Zeit Aufregung und Unruhe» bringe (3.Juli 1891).
In der Volksabstimmung vom 5.Juli 1891 dürften es die gleichen Kräfte wie die der Parlamentsmehrheit gewesen sein, die dafür sorgten, dass gegen den noch immer grossen und starken Freisinn eine Gesamtmehrheit von 60,3Prozent Ja-Stimmen zustande kam. Die kantonalen Haltungen unterschieden sich stark von der maximalen Zustimmung im konservativen Wallis mit 87,9Prozent zur minimalen Zustimmung in der benachbarten freisinnigen Hochburg der Waadt mit nur 37,2Prozent. Alles in allem hatte die Vorlage jedoch wenig mobilisiert und eine Stimmbeteiligung von nur 49,3Prozent erreicht, was damals unüblich bescheiden war.19 Wenige Monate zuvor war mit einer beinahe 20Prozent stärkeren Beteiligung (nämlich mit 68,6Prozent) über ein Bundesgesetz betreffend arbeitsunfähige Beamte abgestimmt worden. Die Neue Zürcher Zeitung, die als freisinniges Blatt ohnehin gegen diese Reform war, urteilte am 7.Juli 1891: «Eine solche Gleichgültigkeit gegenüber einer eidgenössischen Angelegenheit, die so tief in unser Verfassungs- und Staatsleben eingreift, ist uns noch nie vorgekommen.» Ein Blatt der französischen Schweiz (die Revue) hielt sich ebenfalls über die geringe Stimmbeteiligung auf und deutete das geringe Interesse als in der Nähe von Geringschätzung («c’est presque du mépris») und bemerkte weiter: «Jamais le peuple suisse n’a témoigné autant d’indifférence.»20
Die Neue Zürcher Zeitung blieb auch nach der Annahme der neuen Verfassungsartikel (Art.118–123) der Volksinitiative gegenüber negativ eingestellt. In der bereits zitierten Stellungnahme vom 7.Juli 1891 bezeichnete sie die Volksinitiative als ein schwer auszusprechendes «Fremdwort» und in der Sache selbst nicht verstandenes Instrument für Unruhestifter: «Agitationen, öffentliche und geheime Verhandlungen abhalten, Unterschriften sammeln, überhaupt das Volk in beständige Aufregung versetzen: das ist ihr Lebenselement, darin erblicken sie alles Volkswohl, weil sie selbst darin am besten gedeihen.» Auch bei Niederlagen werde die Initiative für diese Kreise eine willkommene Reklame sein.
Mit der Einführung der Volksinitiative ging auch auf Bundesebene das Verfassungsideal in Erfüllung, das der Schriftsteller Georg Büchner 1836 eine seiner Danton-Gestalten (Camille) formulieren liess, dass nämlich die Verfassung ein dehnbares Kleid sein müsse, das jede Regung des Volkskörpers auf- und übernehmen soll.21 Hinter diesem breiten Desinteresse lauerten schon die Kräfte, die dieses neue Instrument schnell einsetzen wollten. Schon nach wenigen Monaten starteten Tierschützer die Anti-Schächt-Initiative, über die im August 1893 erfolgreich abgestimmt wurde.22 Zuvor waren für diese erste Initiative Prämien für gesammelte Unterschriften entrichtet worden.
[1.2]
Doppelter Reformbedarf
Der gegenwärtige Gebrauch des Instruments der Volksinitiative wird sowohl unter quantitativen als auch qualitativen Aspekten in zunehmendem Mass als problematisch empfunden. Die Vielzahl der Initiativen ist allerdings das geringere Problem als die Kollision mit bestehenden Verfassungsartikeln. Während das quantitative Problem in der Übernutzung des politischen Systems liegt, ergibt sich das qualitative Problem aus einer Nutzung, die sich nicht um den «Rest» der Verfassung kümmert. In der ersteren Variante belastet die intensive Nutzung unabhängig vom Ausgang der Abstimmung. In der zweiten Variante kann die Initiative nur zur Belastung werden, wenn sie angenommen wird – was neuerdings allerdings häufiger der Fall ist.23
Initianten nehmen ihr «gutes Recht», Volksinitiativen zu lancieren, mitzuunterschreiben und gutzuheissen, bedenkenlos in Anspruch und verursachen damit ebenso bedenkenlos erheblichen Aufwand: Nach vorliegenden Angaben wenden die Gemeinden pro Jahr rund 3700 Arbeitsstunden für die sogenannte Beglaubigung von Unterschriften auf. Weiterer Aufwand entsteht im gesamten Politbetrieb mit der Ausarbeitung der Botschaften, mit den Beratungen in den eidgenössischen Räten, mit den nötig werdenden Abstimmungskämpfen (wovon allerdings die Werbebranche gut lebt) und mit der Belastung des Abstimmungskalenders, der gleichzeitig Referenden zu Bundesvorlagen und auch für kantonale und kommunale Vorlagen zur Verfügung stehen muss. Der Berner Staatsrechtler Hans Huber kritisierte diese Belastung schon 1967: «Die Regierungsfähigkeit ist namentlich durch die Ablenkung der Behörden von ihren wichtigen und drängenden Aufgaben und die Versuchung zu taktischem Vorgehen (mit Gegenvorschlägen) in Frage gestellt, der Abstimmungskalender ist überfüllt, und die bedenkliche Stimmabstinenz wird noch gesteigert.»24 Dass das Mengenproblem auch anders beurteilt werden kann, zeigen die Ausführungen von Andreas Gross in diesem Band.
Das Mengenproblem kann auch ein Ordnungsproblem sein: Verfassungen sind ordentliche Gesamtkunstwerke, wenigstens in der Ausgangslage von 1848 und später durch die Totalrevisionen von 1874 und 1999.25 Die beiden letzteren Verfassungsordnungen wurden wegen erwünschter oder erzwungener Teilrevisionen schnell zu Flickenteppichen. Wegen der fehlenden Gesetzesinitiative wurden und werden Dinge in die schweizerische Bundesverfassung gebracht, die eigentlich auf die Gesetzesebene gehörten.26
Die qualitative Problematik bestimmter Bundesinitiativen ergibt sich aus der fehlenden Verfassungskonformität und aus der Unvereinbarkeit mit dem Völkerrecht.27 Die eidgenössischen Räte, die sozusagen anstelle des Bundesgerichts die Verfassungsmässigkeit prüfen sollten, scheuen davor zurück, ihre Kompetenz gemäss Artikel139 und 173 BV zu nutzen und verfassungswidrige Initiativen, zu denen die Unterschriften in nötiger Zahl bereits vorliegen, für ungültig zu erklären. So sind bestehende Verfassungsgrundsätze für die Beurteilung der Zulässigkeit von neuen Verfassungsartikeln weitgehend irrelevant. Neu über Initiativen angestrebte Verfassungsartikel werden tendenziell den bereits bestehenden Verfassungsbestimmungen als im Prinzip gleichgestellt eingestuft. Das führt beispielsweise dazu, dass wir einerseits den Artikel15 mit der Garantie der Glaubensfreiheit haben und andererseits den Artikel72 zum Verhältnis von «Kirche und Staat», der in Absatz