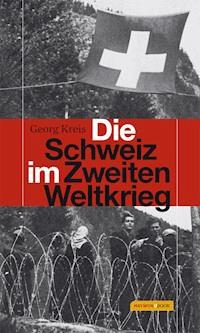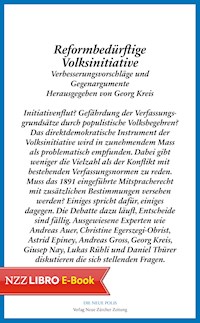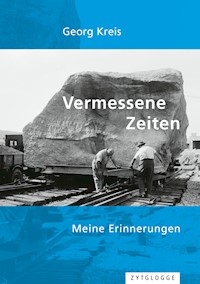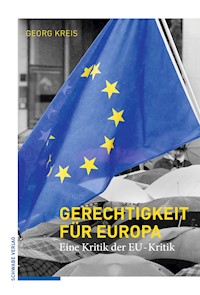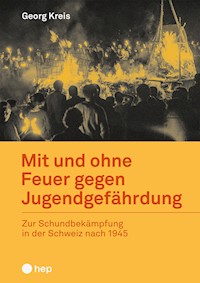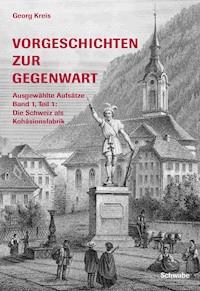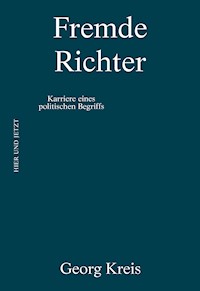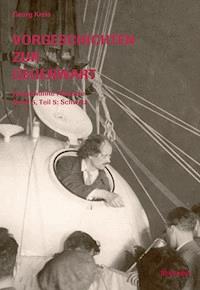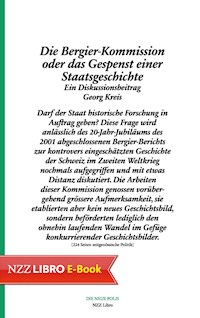
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: DIE NEUE POLIS
- Sprache: Deutsch
In der Geschichtsforschung gilt, dass das Geschichtsverständnis nicht Angelegenheit des Staats, sondern allein Sache der Gesellschaft ist. Verletzt infolgedessen der Staat dieses Prinzip, wenn er historische Fragen durch Expertenkommissionen klären lässt und diese mit besonderen Privilegien ausstattet? Die aus liberaler Sicht berechtigte Warnung vor staatlichen Engagements in historischen Abklärungen ist bisher vor allem aus grundsätzlichen Rechts-überlegungen abgehandelt worden. Dieses Buch behandelt die Problematik am konkreten Fall der Bergier-Kommission (eigentlich: Unabhängige Expertenkommission «Schweiz-Zweiter Weltkrieg» UEK) im Licht ihres realen politischen Kontexts ab. Die Abklärungen von Georg Kreis führen zu folgenden Befunden: Die Schaffung der UEK geschah nicht in der Absicht, eine bestimmte «Staatswahrheit» zu etablieren, und sie hatte auch nicht eine solche Wirkung. Die Arbeiten der vom Staat eingesetzten Kommission genossen wohl vorübergehend eine grössere Aufmerksamkeit, sie etablierten aber kein neues Geschichtsbild, sondern beförderten lediglich den ohnehin laufenden Wandel im Gefüge konkurrierender Geschichtsbilder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben von Astrid Epiney und Georg Kreis
DIE NEUE POLIS ist Plattform für wichtige staatsrechtliche, politische, ökonomische und zeitgeschichtliche Fragen der Schweiz. Eine profilierte Herausgeberschaft versammelt namhafte Autoren aus verschiedenen Disziplinen, die das Für und Wider von Standpunkten zu aktuellen Fragen analysieren, kontrovers diskutieren und in einen grösseren Zusammenhang stellen. Damit leisten sie einen spannenden Beitrag zum gesellschaftspolitischen Diskurs.
Die Bergier-Kommissionoder das Gespenst einer Staatsgeschichte
Ein Diskussionsbeitrag
Georg Kreis
NZZ Libro
Gedruckt mit Unterstützung der Berta Hess-Cohn Stiftung, Basel und der Elisabeth Jenny-Stiftung, Riehen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Text des E-Books folgt der gedruckten ersten Auflage 2021 (ISNB 978-3-907291-28-3)
© 2021 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Lektorat: Thomas Heuer, Basel
Umschlag: unfolded, Zürich
Gestaltung, Satz: Marianne Otte, Konstanz
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN 978-3-907291-28-3
ISBN E-Book 978-3-907291-29-0
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
[1]Einleitung
[2]Die Einsetzung der UEK
Wer wollte eine UEK?
Unterschiedliche Erwartungen
Die Unabhängigkeit der UEK
Die Suche nach «Wahrheit»
[3]Die längere Vorgeschichte der UEK
Der Ludwig-Bericht
Der Bonjour-Bericht
Der Favez-Bericht
[4]Die Reaktionen auf den UEK-Bericht
Die Erklärungen des Bundesrats
Die parlamentarischen Reaktionen
Reaktionen der Parteien und der Presse
Reklamationen von Zeitzeugen
Die Reaktionen der Fachkollegen
Reaktionen der Gegenpublizistik
[5]Die Wirkung des UEK-Berichts
Zur geschichtswissenschaftlichen Auseinandersetzung
Zur Auswirkung auf das gesellschaftlich-politische Vergangenheitsverständnis
Zur möglichen Auswirkung der UEK-Arbeiten auf Schulen
[6]Die Praxis nach der UEK
Südafrika
Deutsche Demokratische Republik
Administrative Fürsorgemassnahmen
[7]Schluss
[8]Bibliografie
[9]Abkürzungsverzeichnis
[10]Personenregister
Herausgeber und Autoren
Vorwort
In den Jahren 1996 bis 2002 wurden höchst engagiert und entsprechend auch aufgeregt die Fragen diskutiert, auf welche Weise die Schweiz – und einzelne schweizerische Akteure – in den Zweiten Weltkrieg verwickelt waren und wie in den Nachkriegsjahren mit dieser Verwicklung umgegangen wurde. Nicht weniger gross und zum Teil auch argwöhnisch war das Interesse an der Unabhängigen Expertenkommission, die von Bundesrat und Parlament mit der Klärung dieser Fragen beauftragt wurde. Inzwischen gehört diese vorübergehend intensivierte Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit und ihrer Verarbeitung selbst der Vergangenheit an. An dieser Front ist es ruhig geworden, aber von Zeit zu Zeit flackern doch noch positiv wie negativ eingefärbte Rückblicke auf. Das könnte auch in nächster Zukunft der Fall sein, wenn sich im Dezember 2021 die offizielle Abgabe des UEK-Berichts an den Bundesrat zum 20. Mal jährt.
Eine mit dieser Aufarbeitung verbundene Problematik ist uns auf jeden Fall erhalten geblieben: Verletzt der Staat, wenn er historische Fragen durch Expertenkommissionen klären lässt und diese mit besonderen Privilegien ausstattet, das liberale Prinzip, wonach Geschichtsforschung und Geschichtsverständnis in die Privatsphäre der Gesellschaft gehören? Die aus liberaler Sicht berechtigte Warnung vor staatlichen Engagements in historischen Abklärungen ist bisher vor allem aus grundsätzlichen Rechtsüberlegungen abgehandelt worden. Hier soll die Problematik am Fall der im Dezember 1996 eingesetzten Unabhängigen Expertenkommission «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» (UEK), bekannter als Bergier-Kommission, nochmals aufgenommen und im Licht ihres realen politischen Kontexts abgehandelt werden.
Der Autor kann als befangen eingestuft werden, weil er selbst dieser Kommission angehörte. Er hofft aber, dass die allenfalls problematische Nähe durch die besondere Vertrautheit mit der Problematik aufgewogen wird. Anstoss zu einer rückkehrenden Beschäftigung mit dieser Vergangenheit gab eine Einladung von Damir Skenderovic, im Rahmen seiner Vorlesung an der Universität Freiburg einen Vortrag zum Thema «Die geschichtspolitische Bedeutung der UEK ‹Schweiz – Zweiter Weltkrieg›» halten (19. Nov. 2019). Hilfreich waren die Gespräche, die er im Lauf dieser Arbeit mit Kollegen führen durfte, insbesondere mit Gregor Spuhler, Direktor des Archivs für Zeitgeschichte der ETH/ZH, Sacha Zala, Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bern, und Martin Lengwiler von der Universität Basel und leitender Mitverantwortlicher der UEK II. Ihnen sei hier, ohne sie für den schliesslich vorgelegten Text mitverantwortlich zu machen, herzlich gedankt. Ein weiterer Dank geht an die Berta Hess-Cohn Stiftung und an die Jenny-Stiftung sowie an den Verlag NZZ Libro der (und die) Verlagsgruppe Schwabe, die diese Publikation möglich gemacht haben.
GK
Oktober 2020
[1]
Einleitung
Die vor rund zwei Jahrzehnten engagiert geführte Debatte um die schweizerische Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg gehört inzwischen selbst der Vergangenheit an – einer anderen Zeit, die hier und jetzt als solche nicht rekapituliert werden soll. Eine kleine, leicht zeitverschoben geführte Nebendebatte ist uns hingegen erhalten geblieben und taucht von Zeit zu Zeit wieder auf. Sie gilt der Frage, ob und auf welche Weise sich der «Staat» an dieser Debatte beteiligen durfte und – allgemein – an historischen Abklärungen beteiligen darf. Verletzt der «Staat», wenn er historische Fragen durch Expertenkommissionen klären lässt und diese mit besonderen Privilegien ausstattet, das liberale Prinzip, wonach Geschichtsforschung und Geschichtsverständnis in die Privatsphäre der Gesellschaft gehören?
Die aus liberaler Sicht berechtigte Warnung vor «staatlichen» Engagements in historischen Abklärungen ist bisher vor allem aus grundsätzlichen Rechtsüberlegungen abgehandelt worden. Hier soll nun die Problematik am konkreten Fall der im Dezember 1996 eingesetzten Unabhängigen Expertenkommission «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» (UEK), bekannter als Bergier-Kommission, nochmals aufgenommen und im Licht ihres realen politischen Kontexts überprüft werden. Dabei sollen uns die folgenden vier Fragen interessieren:
1. Aus welcher Einstellung und mit welcher Absicht wurde die UEK 1996 geschaffen?
2. In welcher Tradition stand die 1996 geschaffene UEK?
3. Verschob sich das Kräfteverhältnis zwischen staatlicher und nicht staatlicher Deutung?
4. Wurde mit dem Bericht der UEK ein neues Geschichtsbild etabliert?
Vorweg sei festgehalten, dass die Bedenken, die insbesondere in der rechtswissenschaftlichen Studie von Stefan Schürer (2009) wegen der Beteiligung des «Staats» an der Aufarbeitung umstrittener Geschichte angemeldet werden, grundsätzlich einleuchtend und aus theoretischer Sicht gerechtfertigt sind, aber bei einer näheren Betrachtung der Vorgänge jedoch stark relativiert werden müssen. Die Vorstellung, dass «die Suche nach historischer Wahrheit von der Zivilgesellschaft zum Staat verlagert» worden sei, orientiert sich an einer Gegenüberstellung von zwei Sphären, die, bei aller Anerkennung bestehender Andersartigkeit, zu gegensätzlich aufgefasst werden. Die Fokussierung auf die jüngst erfolgten Auftragserteilungen an offiziöse Historikerkommissionen übersieht, dass Staat und Geschichte in manchen Varianten schon immer in einem engen Verhältnis zueinander standen und die Etablierung der modernen Geschichtswissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Dienst staatlicher Geschichtspolitik erfolgte.
Die vorgebrachten Bedenken lassen das Verhältnis von staatlich veranlasster und privat an die Hand genommener Geschichtsschreibung gegensätzlicher erscheinen, als es in Wirklichkeit ist. Die zwar in Anführungszeichen verwendete Formel von «Verstaatlichung» der Geschichte und die Formulierung «Geschichtsschreibung wird zur Aufgabe des Staats» und «Ausgreifen des Staats auf die Geschichte» (beides ohne Anführungszeichen) 1 suggerieren die Vorstellung einer weitgehenden oder gar vollständigen Übernahme der Geschichtsdeutung durch den «Staat». Das wird den realen Gegebenheiten nicht gerecht. Zutreffender wäre die Formulierung: Abklärungen zur Geschichte sind auch zu einer Aufgabe des «Staats» geworden. Denn erstens sind die Übergänge von «Staat» und Gesellschaft in einer pluralistisch funktionierenden Gesellschaft fliessend, was Schürer übrigens auch selbst einräumt. 2 Und zweitens war der «Staat» im konkreten Fall der UEK am Prozess der Aufarbeitung von Vergangenheit bloss beteiligt, als er ein halbstaatliches Gremium einsetzte, er war in gewisser Weise ein privilegierter Akteur, aber er agierte in einem gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsraum zusammen mit selbstständigen zivilgesellschaftlichen Akteuren. 3 Die Frage, ob und wie die Gesellschaft durch das staatliche Engagement eine inhaltliche Beeinflussung erfuhr, klammerte Schürer völlig aus und konzentrierte sich ganz auf den formalen Aspekt der «staatsnahen» Geschichtsschreibung. Dabei wäre doch die materielle, inhaltliche Auswirkung der staatlichen Beteiligung der zentrale Punkt für deren Beurteilung. 4
Die historische Beurteilung der staatlichen Beteiligung muss zwischen Absicht und Wirkung unterscheiden. Was die Absicht betrifft, kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass es den staatlichen Akteuren nicht darum ging, die Gesellschaft bezüglich der zu einem kontroversen Teil der Nationalgeschichte bestehenden Vorstellungen zu bevormunden. Das schliesst allerdings nicht aus, dass von der Arbeit der aus anderer Absicht geschaffenen UEK eine dominierende Deutung der Geschichte ausging und dies einen bevormundenden Effekt auf die Gesellschaft hätte haben können. Es sei nicht in Abrede gestellt, dass die UEK-Befunde, die mit besonderen finanziellen Mitteln und rechtlichen Möglichkeiten erarbeitet wurden sowie mit symbolischem Kapital ausgestattet waren, eine etwas höhere Beachtung erfuhren als private und persönliche Deutungen. Die Furcht, dass damit ein «vergangenheitspolitischer Leviathan» 5 installiert worden sei, erweist sich, wenn wir die gesellschaftlichen Realitäten berücksichtigen, jedoch als unbegründet. Von privater Seite eingebrachte Deutungen der gleichen Thematik genossen, gerade weil sie ein offiziöses Projekt kritisierten, eine dem Status des kritisierten Gegenstands entsprechende Beachtung und viel überproportionalen Kredit. Dies mit der Konsequenz, dass die sich für die Kontroversen überhaupt interessierenden Bürgerinnen und Bürger aus unterschiedlichen, ja gegenläufigen Verständnissen aussuchen und, um es in einer traditionellen Formel auszudrücken, nach ihrer «Fasson selig werden» konnten. 6 Die Wirkung unerwünschter Befunde hing und hängt in hohem Mass von der Rezeptionsbereitschaft der Gesellschaft ab; also davon, ob Fakten und Deutungen bestehende Grundeinstellungen bestätigen. Deswegen war und ist es möglich, dass unerwünschte Befunde nicht ankommen, obwohl sie von hochgestellter Warte verbreitet werden, und erwünschte Befunde, die bestehende Überzeugungen oder Neigungen bekräftigen, leicht übernommen werden, obwohl sie lediglich von Privatpersonen oder Kleinstgruppen vorgebracht werden, wie die Kontroverse um die Zahlen der abgewiesenen, wohl mehrheitlich jüdischen Flüchtlinge zeigt. 7
Der Autor dieser Schrift hat Verständnis für die Bedenken gegen eine staatliche Beteiligung an der Aufarbeitung kontrovers beurteilter Vergangenheit, und er teilt die Meinung, dass sich der «Staat» diesbezüglich grösste Zurückhaltung auferlegen muss. Er ist aber auch überzeugt, dass dies im Fall der UEK so gehandhabt wurde und auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft in ihren verschiedenen Vorstellungen zur Geschichte der umstrittenen Vergangenheit eigenständig blieb.
Anmerkungen
1Stefan Schürer, Die Verfassung im Zeichen historischer Gerechtigkeit. Schweizer Vergangenheitsbewältigung zwischen Wiedergutmachung und Politik mit der Geschichte. Zürich 2009. S. 12, 15 und 37. Die Arbeit wurde mit dem Dissertationenpreis 2009 der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich ausgezeichnet.
2«Die Arbeit zieht hier den Trennstrich nicht anhand der Stossrichtung der verschiedenen Werke, sondern differenziert entlang der verfassungsrechtlich bedeutsamen Bruchstelle von Staat und Gesellschaft.» Schürer hält fest, dass seine Ausführung den offenbar gegebenen «Grautönen» nicht Rechnung trägt. Die das ganze Werk bestimmende Betonung der «Bruchstelle» steht eigentlich im Widerspruch zur punktuell eingeräumten Erkenntnis, dass die «Grenzen fliessend» seien (Schürer, 2009, S. 53 ff.).
3Hier nicht weiter zu vertiefen, jedoch zur Hauptfrage gemacht im Sonderforschungsbereich 584 «Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte», Abschlussbericht 2008–2012, April 2013. https://www.uni-bielefeld.de/geschichte/forschung/sfb584/Abschlussbericht.pdf
4Peter Steinbach, Leiter der «Gedenkstätte Deutscher Widerstand» in Berlin, räumt ein, dass der Staat in westlichen Gesellschaften ein wichtiger Akteur in geschichtspolitischen Auseinandersetzungen ist, doch er betont, dass Regierungen ihre Interpretationen der Vergangenheit «in der Regel nicht ohne weiteres durchsetzen (können), denn bürgerliches Engagement führt zu Initiativen, die Korrekturen der Deutungen [bewirken und auf die Politiker nur reagieren können].» https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39789/geschichte-und-politik
5Schürer, 2009, S. 331. Mit «Leviathan» wird ein Bezug zu Thomas Hobbes’ gleichnamigem Werk aus dem Jahr 1651 zum absolutistischen Staatsverständnis hergestellt.
6Das geflügelte Wort geht auf eine Bemerkung Friedrichs des Grossen (1712–1768) aus dem Jahr 1740 zurück, mit der er die Zulassung des katholischen Glaubens im protestantischen Preussen kommentierte.
7Ruth Fivaz-Silbermann, Migrations, statégies, fuite, acceuil, efoulement et destin des réfugiés juifs venus de France. Calmann-Lévy, Paris 2020, mit einem Vorwort von Serge Klarsfeld; an der Universität Genf 2017 als Dissertation angenommen. Während die UEK rund 20 000 Rückweisungen von nicht ausschliesslich jüdischen Flüchtlingen annimmt (Schlussbericht, S. 120), stellt Fivaz für die schweizerisch-französische Grenze 3300 Rückweisungen jüdischer Flüchtlinge fest und kommt mit einer Hochrechnung zum sonderbaren Schluss, dass es gesamtschweizerisch zu rund 4000 Rückweisungen gekommen sei. Der Historiker Sascha Zala hält diese Extrapolation sowie die Fixierung auf Abgewiesenenzahlen für fragwürdig (Stichwort «Zahlenmystik»), zumal der Abschreckungseffekt der restriktiven Flüchtlingspolitik nicht beziffert werden kann (https://www.bernerzeitung.ch/schweiz/standard/ersatzschauplatz-fuer-nationale-empoerung/story/14900107). Die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG) hat sich im April 2013 eingehend mit den unterschiedlichen Einschätzungen auseinandergesetzt (http://www.sgg-ssh.ch/sites/default/files/files/uek-cie-2013-04-26_einladung_def_inkladresseundzeit.pdf). Die Medien haben ausführlich über die Infragestellung der UEK-Darlegungen berichtet.
[2]
Die Einsetzung der UEK
Dieses Kapitel zeigt zunächst, worin die Unabhängigkeit der UEK bestand und inwiefern sie doch begrenzt war. Im Weiteren zeigt es aufgrund der bisher kaum zur Kenntnis genommenen parlamentarischen Debatten, in welchem Sinn und Geist die UEK «Schweiz – Zweiter Weltkrieg» 1996 geschaffen wurde. Es wird deutlich, dass die Initiative für die ausserordentlichen Abklärungen von der Legislative kam und die Exekutive sich in dieser Sache zurückhielt. Die Einsetzung entsprach nicht einem autoritären, von der Gesellschaft abgehobenen Akt. Die Basis für die Einrichtung der UEK war in einem mit der Gesellschaft verbundenen Prozess geschaffen worden. Dabei war die UEK eine unbestrittene Nebensache, im Zentrum stand vielmehr die Einrichtung eines unbegrenzten Archivprivilegs. Der Bundesbeschluss wurde mit ausserordentlicher Einstimmigkeit verabschiedet, obwohl unterschiedliche Vorstellungen von den zu erwartenden Ergebnissen bestanden. Ziel war nicht die Etablierung einer bestimmten «Staatswahrheit». Man sprach sich insofern aber für «Wahrheitsfindung» aus, als man damit die Bereitschaft zu vorbehaltloser und uneingeschränkter Abklärung zum Ausdruck bringen wollte. Die «Wahrheitssuche» galt den faktischen Gegebenheiten in strittigen Finanzfragen und nicht dem weiteren Geschichtsverständnis.
[2.1]Wer wollte eine UEK?
Die Tatsache, dass der Bundesrat es war, der die UEK einsetzte, ihre Zusammensetzung bestimmte, ihr Pflichtenheft festlegte, ihr Ansprechpartner während der Arbeit und auch die Ablieferungsstelle für die anschliessende Berichterstattung war, dürfte mit zeitlichem Abstand zu den Beratungen von 1996 die Annahme begünstigt haben, dass die UEK einzig auf Betreiben des Bundesrats geschaffen worden war. Die Schaffung der UEK ging aber auf einen vom Parlament, und zwar von beiden Kammern, einstimmig gefassten Beschluss zurück. In aussergewöhnlicher Gleichgestimmtheit beschlossen der Nationalrat am 30. September 1996 mit 162:0 Stimmen und der Ständerat am 27. November 1996 mit 36:0 Stimmen die ausserordentlichen historischen Abklärungen. Insofern als das Parlament ein staatliches Organ ist, kann man das als Staatsaktion interpretieren. Das Parlament war und ist aber auch ein Teil der Zivilgesellschaft, also ein Bindeglied zwischen staatlicher und gesellschaftlicher Sphäre. Wegen der Dringlichkeit wurde beim Bundesbeschluss vom Dezember 1996 allerdings das Referendum ausgeschaltet. Wie eine Volksabstimmung ausgegangen wäre, kann man nur spekulativ einschätzen. Wenn die im Parlament abgegebenen Voten für die Stimmung im Land einigermassen repräsentativ waren, könnte man davon ausgehen, dass das Projekt einer historischen Klärung eine zustimmende Mehrheit gefunden hätte. Wahrscheinlich wäre das Format (die Zeit und die Kosten) als überrissen kritisiert worden, der Staatscharakter der Beauftragung hätte aber kaum gestört.
Der Bundesrat und die Verwaltung waren gegenüber der Idee, die Bedeutung des Finanzplatzes Schweiz während des Zweiten Weltkriegs durch eine UEK abklären zu lassen, zunächst eher zurückhaltend. Er reagierte erst im Nachvollzug zweier nicht von ihm geschaffener Voraussetzungen: Die eine bestand aus der Bereitschaft der von Lili Nabholz (FDP/ZH) präsidierten nationalrätlichen Rechtskommission, aus der parlamentarischen Initiative von Verena Grendelmeier (LdU/ZH) vom März 1995 eine weiter gefasste Rechtsgrundlage für eine vertiefte Abklärung der Rolle des Finanzplatzes Schweiz zur Zeit der Zweiten Weltkriegs und in den Folgejahren zu schaffen. 1 Die Rechtskommission befasste sich bereits am 28. August 1995 mit der Frage, und am 23. Oktober 1995 bildete sie dazu eine Subkommission. Die Absicht, eine UEK einzusetzen, entstand in dieser Subkommission auf Anregung von Paul Rechsteiner (SP/SG), der sich schon in anderen Fragen für eine kritische Aufarbeitung problematischer Vergangenheit eingesetzt hatte. Am 26. August 1996 verabschiedete die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats ihren Bericht und dazu in Form einer parlamentarischen Kommissionsinitiative gleich auch einen Entwurf für einen entsprechenden Bundesbeschluss. 2
Eine andere wichtige Voraussetzung war die am 2. Mai 1996 zwischen der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) und dem World Jewish Congress (WJC) privat getroffene Einigung, unter der Leitung eines paritätischen Komitees unabhängige Treuhandexperten in den Schweizer Banken nachrichtenlose Vermögen identifizieren zu lassen. Diese Abklärung erforderte aber, sozusagen als Ergänzung, eine vom «Staat» eingesetzte zusätzliche Kommission, weil der WJC eine Untersuchung auch der Raubgutproblematik erwartete und dazu Unterlagen einbezogen werden mussten, die ausserhalb der Banken lagen und von Treuhändern nicht studiert werden konnten. Carlo Jagmetti, Schweizer Botschafter in den USA, sah diese Konsequenz offenbar bereits in seinem Bericht über die getroffene Einigung (dem Memorandum of Understanding) und empfahl dem Bundesrat die Schaffung einer «unabhängigen Kommission vielleicht in der Art Norwegens». 3 In den vergangenen Jahren war es eine gängige Praxis geworden, zur Klärung historischer Fragen solche Kommissionen einzusetzen. 4 Eine dieser Kommissionen, die der Schweizer Militärhistoriker Hans-Rudolf Kurz präsidierte, wurde 1987 in Österreich zur Klärung der Waldheim-Affäre eingesetzt. 5
Am 10. Mai 1996 setzte der Bundesrat in einer ersten Reaktion aus Personalbeständen der Bundesverwaltung eine interdepartementale Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Klärung der sich stellenden Fragen ein, und am 29. Mai 1996 teilte er in einer zweiten Reaktion dem Parlament mit, dass er die parlamentarische Kommissionsarbeit zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die historischen Abklärungen unterstützen werde. 6 Im Nationalrat unterstrich Aussenminister Flavio Cotti den direkten Zusammenhang zwischen der privaten Verständigung der Streitparteien und der vom Parlament nun zu beschliessenden offiziellen Abklärungen. Er gab bekannt, dass sich der Bundesrat in seiner Sitzung vom 8. Mai 1996 sogleich darin einig gewesen sei, die vorgesehene Lösung zu unterstützen, dass er aber, was ihm sicher recht war, die Initiative für die ergänzenden Untersuchungen dem Parlament überlassen wollte. 7 Im Ständerat wiederholte er: «Wir sind im Mai 1996 ans Werk gegangen, als der World Jewish Congress und die Schweizerische Bankiervereinigung mit dem ‹Memorandum of Understanding› den Bundesrat dazu aufriefen, Klarheit über diese Vergangenheit zu schaffen. Das war interessant: aus Washington ein Auftrag, ein Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir hatten vorher von einem solchen Auftrag nie gehört. Wir sind ans Werk gegangen.» 8
Cotti betonte im Parlament, dass das Geschäft nicht vom Bundesrat initiiert worden sei. Er liess den Präsidenten des Nationalrats erklären, dass er bei der Detailberatung auf Interventionen zu den einzelnen Artikeln verzichten werde, «puisqu’il s’agit d’une initiative parlementaire». Dennoch verkündete er seine dezidierte Erwartung, dass sich der Rat der Bedeutung der Problematik bewusst sei und darum den vorbereiteten Bundesbeschluss «mit überwältigendem Mehr, ja mit Einstimmigkeit» annehmen werde. Und im etwas widerständigeren Ständerat verkündete er unumwunden: «Le Conseil fédéral accorde à ce projet une très haute priorité.»
Es waren die eidgenössischen Räte, die 1996 davon ausgingen, dass zur Bewältigung der Krise, die wegen der heftigen Kritik am Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und der damit verbundenen Nachfolgeprobleme eingetreten war, besondere Abklärungen vorgenommen werden mussten, und darum zu Händen des Bundesrats die nötige Gesetzesgrundlage schufen. Dabei gingen alle Beteiligten mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit, also völlig diskussionslos davon aus, dass eine ausserordentliche Expertenkommission einzusetzen sei. Weniger wichtig als die Schaffung einer solchen Kommission, die der Bundesrat auch ohne Parlament hätte vornehmen können, war die Schaffung einer Rechtsbestimmung, die Amtsstellen, Archive und Private zur Auskunft an die vom Bundesrat einzusetzende Expertenkommission verpflichtete und diesbezüglich die Amtsgeheimnisse sowie gesetz-liche oder vertragliche Berufsgeheimnisse ausser Kraft setzte.
Der Politologe Leonhard Neidhart erinnert in einer der wenigen Publikationen zum schweizerischen Parlamentarismus daran, dass im komplexen Gebilde «Parlament» drei verschiedene Eigenschaften zusammenkommen: Das Parlament ist eine Wählerschaften repräsentierende Versammlung von Individuen, eine beschlussfassende Organisation und Teil des Gesamtsystems, das wir «Staat» nennen. 9 In seiner ersten Eigenschaft ist das Parlament eine gesellschaftlich-staatliche Mischgrösse. Meistens wird die staatliche Seite betont. Henry H. Kerr hingegen hat sie 1981 als «microcosme de la société» bezeichnet, was allerdings auch nur eine Teilwahrheit ist, wenn man die Wahlabstinenzen und die Gesellschaftsangehörigen ohne Stimmrecht bedenkt. 10
Bei der Beurteilung des staatlichen Charakters der 1996 eingeleiteten Sonderforschung ist noch zu berücksichtigen, dass das Parlament, das zu einem Teil zwar ein staatliches Organ war, zu einem anderen Teil aber auch der Sphäre der Zivilgesellschaft angehörte, vor der Beschlussfassung ausgewählte Exponenten der Gesellschaft konsultierte und darüber hinaus sicher auch die Stellungnahmen der Medien zur Kenntnis nahm. Die Subkommission des Nationalrats führte zwei Hearings durch, in denen unter anderem Vertreter des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes und der Bankiervereinigung angehört wurden. Einem Votum von Ständerat Hans Danioth (CVP/UR) kann man entnehmen, dass der Ständerat auch den emeritierten Berner Geschichtsprofessor Walter Hofer, der 1963 bis 1979 SVP-Nationalrat und Experte in Fragen der schweizerischen Aussenpolitik war, zu einem Hearing eingeladen hatte. Ein Beispiel für die üblichen privaten Verbindungen von Parlamentariern zur Gesellschaft lieferte ebenfalls Danioth, als er im Rat erklärte, dass er in Bürglen im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung «40 Jahre Tell-Museum» den ETH-Geschichtsprofessor Jean-François Bergier getroffen habe, der damals allerdings noch nicht wusste, dass er einmal die UEK präsidieren würde. 11 Gemäss Danioth hätten sich Hofer wie Bergier von der «subjektivistischen Geschichtsdarstellung gewisser junger Historiker» klar distanziert. Damit waren die schon damals über 50-jährigen Kollegen gemeint, die später den wesentlichen Teil der UEK-Arbeit leisteten.
Der Entwurf des im Dezember 1996 genehmigten Bundesgesetzes wurde im Juli/August 1996 als Vorentwurf in das übliche Vernehmlassungsverfahren gegeben. In der Auswertung der Stellungnahmen kam der Bericht der nationalrätlichen Rechtskommission dann zum Schluss, dass die Zielsetzungen des Bundesbeschlusses in den insgesamt 18 eingegangenen Antworten ein durchwegs positives Echo gefunden hätten. Sämtliche Vernehmlasser hätten der Vorlage grundsätzlich zugestimmt und seien wie die Bundesbehörden «mit der gleichen Entschlossenheit» dafür eingetreten, dass das Verbleiben dieser in der Schweiz deponierten Vermögen «endgültig aufgeklärt» und das Ansehen des schweizerischen Finanzplatzes wiederhergestellt würde. 12 Gemäss diesem Echo aus der Zivilgesellschaft störte der staatliche Charakter der vorgesehenen Abklärung offenbar nicht. Mit der Zustimmung verband sich vielmehr die Erwartung, dass die historische Aufarbeitung der damaligen Rolle des schweizerischen Finanzplatzes, wie auch der Bericht des Rechtskommission festhielt, zu einer «abschliessenden und umfassenden» Klärung führen werde, was mit den fraglichen Vermögenswerten aus jener Zeit geschehen ist.
Die zivilgesellschaftliche Dimension des Parlaments zeigte sich auch im Informationsseminar, das im Juni 1997 im Nationalratssaal auf Einladung von Nationalratspräsidentin Judith Stamm durchgeführt wurde und an dem neben rund 50 Mitgliedern der beiden Kammern etwas mehr Journalisten und andere Interessierte – darunter die diplomatischen Vertreter der zehn im Eizenstat-Bericht ebenfalls genannten Länder – teilnahmen. Das Vorwort des von US-Unterstaatssekretär Stuart Eizenstat gezeichneten Berichts enthielt schwere Vorwürfe, die der vermeintliche Verfasser einiges später allerdings wieder halbwegs zurücknahm. 13 In dieser vom Schweizer Fernsehen übertragenen und in Presseberichterstattungen weitervermittelten Veranstaltung traten die Professoren William Z. Slany, Chefhistoriker des State Department und eigentlicher Koordinator des diskutierten Berichts, Jean-François Bergier, UEK-Präsident, Daniel Thürer, Zürcher Völkerrechtler, sowie Jean-Pierre Roth, Vizepräsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), auf. Anschliessend gab es unter der Leitung von Laurent Goetschel (Schweizer Friedensstiftung) eine Art Hearing. 14
Der «Staat», das heisst Parlament und Bundesrat, verfolgte mit der Schaffung der UEK einen doppelten Zweck: Er wollte sich in praktischer Hinsicht die im Auftrag genannte und als nötig erachtete Klarheit erschaffen. Und er wollte auf der symbolischen Ebene primär dem Ausland und sekundär der eigenen Bevölkerung zeigen, dass er das Problem ernst nahm und bereit war, uneingeschränkte Transparenz zu schaffen. Vielleicht wollte der Bundesrat mit dem auf fünf Jahre ausgelegten Auftrag auch Zeit gewinnen. Wenn dies auch nicht Absicht war, als praktischen und willkommenen Nebeneffekt hatte die Einsetzung einer Historikerkommission jedenfalls die objektive Funktion, dem Bundesrat in dieser Sache sozusagen eine Verschnaufpause zu geben: Die Exekutive musste, was die inhaltlichen Fragen betraf, nicht sogleich reagieren und konnte auf die für fünf Jahre eingesetzte UEK hinweisen – mithin gewissermassen auf später vertrösten. Es gab Stimmen, die gern sogleich eine grundsätzliche Stellungnahme gehabt hätten. 15 Aussenminister Flavio Cotti bemerkte indessen schon im September 1996 im Nationalrat: «Mögliche Schlussfolgerungen wird der Bundesrat ziehen, wenn der definitive Bericht der Experten vorliegt.» Wenn die Schaffung der UEK eine Instrumentalisierung zum Zweck des Zeitgewinns war, geschah dies nicht in der Absicht eines inhaltlichen Beeinflussungsversuchs. Bundesrat Cotti betonte noch vor der Einsetzung der UEK im gleichen Votum: «Wir müssen unsere Vergangenheit vorurteilslos untersuchen und uns den Ergebnissen, wie auch immer sie ausfallen mögen, stellen.» 16
[2.2]Unterschiedliche Erwartungen
In beiden Kammern war man sich durchgehend einig, dass zur Bewältigung der akuten Krise ein Archivprivileg und eine Untersuchungskommission geschaffen werden müssten. Bezüglich der zu erwartenden Ergebnisse der so ermöglichten Abklärungen gingen die Erwartungen jedoch stark auseinander. Diese unterschiedlichen Erwartungen sollten später die ebenfalls unterschiedliche Beurteilung der vorgelegten Ergebnisse bestimmen. Ein einstimmiges Abstimmungsergebnis kam übrigens auch darum zustande, weil die wenigen Opponenten offenbar für die Zeit der Abstimmung die Säle verliessen. Keine Fraktion und keine Einzelperson erlaubte sich, die Einsetzung einer Expertenkommission infrage zu stellen. In den Begründungen der Zustimmung spiegelten sich jedoch verschiedene politische Grundhaltungen. Das politische Zentrum sprach sich ohne Nebentöne für vorbehaltlose Abklärungen aus. Die politische Rechte erinnerte daran, dass die Kriegsjahre schwierig gewesen seien und man eine Abklärung nicht zu scheuen brauche. Die politische Linke erwartete, dass endlich die längst vertretenen kritischen Blicke auf die Vergangenheit nun von der Allgemeinheit übernommen werden. Während die Linke die Beauftragung einer Expertenkommission als Chance begrüsste, verstand die Rechte die Massnahme als Konsequenz einer unvermeidlichen Notwendigkeit. Die letztere Variante findet sich deutlich im Votum von Ständerat Carlo Schmid (CVP/AI): «Diese Zustimmung erfolgt, weil wir keine Wahl haben, etwas anderes zu beschliessen. Es fehlt uns die moralische, aber es fehlt uns auch die realpolitische Alternative zu diesem Bundesbeschluss.»
In Kenntnis der von der politischen Rechten bald einmal vehement vorgebrachten Kritik an der Arbeit der UEK kann es erstaunen, dass von dieser Seite nicht bereits bei der Einsetzung der UEK Vorbehalte angemeldet wurden. Im Nationalrat gab Theo Fischer-Hägglingen (SVP/AG) die Unterstützung des Bundesbeschlusses durch seine Fraktion bekannt. Diese Haltung entsprang der Erwartung, dass nicht belastende, sondern vielmehr entlastende Erkenntnisse zutage gefördert würden: «Sie [die SVP-Fraktion, d. Vf.] sagt ja zur Vorlage, weil sie glaubt, dass nur eine völlige Transparenz mithelfen kann, einerseits das Vertrauen in die Schweiz und in den Finanzplatz Schweiz zu stärken und andererseits auch all die masslosen Verdächtigungen zu widerlegen, die in letzter Zeit vor allem von Politikern geäussert wurden, die in den USA und England vor der Wiederwahl stehen.» 17 Theo Fischer stimmte am Schluss allerdings nicht für den Bundesbeschluss, sei es wegen Abwesenheit, sei es wegen Stimmenthaltung. Doch selbst von der äussersten Rechten kam Zustimmung. Michael Dreher von der Freiheits-Partei (ZH) erklärte für seine Gruppe: «Wir sind einstimmig und ohne irgendeinen Vorbehalt dafür, dass alles bis ins Detail ausgelotet wird.» Aber er wehrte sich dagegen, dass Schuldzuweisungen an eine Generation vorgenommen würden, die längst verstorben ist; dies auch dann, wenn sie moralisch nicht immer und überall korrekt und über alle Zweifel erhaben gehandelt habe.
Gemäss vorliegenden Unterlagen sah auch die Presse in der Einsetzung der UEK keinen problematischen Eingriff des Staates in die private Forschung. Einspruch erhob aber der Zürcher Universitätsprofessor Jörg Fisch in der NZZ im November 1996, also zwischen der nationalrätlichen und der ständerätlichen Beratung. Diese Stellungnahme formulierte aus prinzipiellen Überlegungen Bedenken, die einzelne Fachkollegen mit unterschiedlicher Entschiedenheit möglicherweise ebenfalls hegten. Im Zentrum stand die Ungleichbehandlung der Forschenden: «Alle Forscher müssen gleichen Zugang zu den gleichen Unterlagen haben. Das vorgesehene Verfahren widerspricht diesem Prinzip.» Die Gleichstellung wäre auch eine Voraussetzung für eine offene Geschichtsdebatte. Im Weiteren störte ihn die mit dem Auftrag verbundene und zum Pressetitel gemachte Vorstellung, dass eine «abschliessende Wahrheit» erarbeitet werden könne, sowie die Sonderregelung der Verbrechen der NS-Gewaltherrschaft, habe es doch im 20. Jahrhundert auch andere Gewaltherrschaften gegeben. 18
[2.3]Die Unabhängigkeit der UEK
Die im Dezember 1996 geschaffene Expertenkommission hatte einen ambivalenten Status: Einerseits war die UEK eine vom Staat eingesetzte, andererseits war sie explizit eine unabhängige Kommission. Die selbst im Titel betonte Unabhängigkeit bildete das Gegenstück zum Faktum, dass die Kommission kein völlig selbstständiges Gremium war und von der sie einsetzenden Autorität hätte abhängig sein können.
Wie waren die Kompetenzen der im Dezember 1996 geschaffenen Kommission geregelt? Die Unabhängigkeit wurde im entscheidenden Bundesbeschluss vom 13. Dezember 1996 nicht weiter definiert. Sie ergab sich einzig aus Art. 7 Abs. 1, wonach sich der Bund ausdrücklich verpflichtete, den Kommissionsbericht «vollständig» zu publizieren. In Richtung Eigenständigkeit ging sodann die Bestimmung, dass die künftige Kommission gemäss Art. 1 Abs. 3 beim Bundesrat eine Anpassung des Untersuchungsauftrags beantragen konnte. Davon machte die UEK Gebrauch, noch bevor sie offiziell eingesetzt war.
Eine implizite Voraussetzung für ihre Unabhängigkeit war der uneingeschränkte Zugang zu allen (auch privaten) Archiven, die sie für ihre Arbeit für relevant hielt. 19 Unabhängigkeit gewährleistete auch das Globalbudget zur Finanzierung der auf fünf Jahre ausgelegten Arbeit. Zunächst war es auf 5 Millionen Franken festgelegt, im folgenden Jahr aber bemerkenswert problemlos auf 22 Millionen Franken aufgestockt worden. 20 Dass der Staat für historische Forschung finanzielle Mittel zur Verfügung stellte, wurde grundsätzlich nicht beanstandet. Es gab aber Kritik an der Höhe des Betrags. Bekanntlich wollte Bundesrat Kaspar Villiger, gerade Chef des Finanzdepartements geworden und wegen seiner Haltung zu Fragen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs von gegensätzlicher Seite kritisiert, nur 3,5 Millionen Franken bewilligen lassen. Mit der wachsenden Kritik an der UEK wurde auch das ihr zur Verfügung gestellte Budget – Steuergelder! – beanstandet. 21 UEK-Präsident Jean-François Bergier pflegte die Kritik am UEK-Kredit mit dem Hinweis zu kontern, dass der zur Verfügung gestellte Betrag einem durchschnittlichen Kostenbetrag von 300 Metern Autobahn entspreche. 22 Nebenbei kann bemerkt werden, dass die 22 Millionen Franken gut investiertes Geld waren weil sie dazu beitrugen, aus dem Prügelknaben Schweiz international einen Musterknaben der historischen Aufarbeitung zu machen. Die von den Banken zu bezahlende Suche nach «nachrichtenlosen Konten» kostete rund 800 Millionen Franken. Das störte die Öffentlichkeit wenig, weil die von privater Seite bezahlt wurden, obwohl man den Beteiligungen insbesondere der Grossbanken halböffentlichen Charakter zuschreiben konnte. 23
Der Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 1996 nannte weitere Unabhängigkeitskriterien: Das Recht auf Selbstkonstituierung (Art. 4.1), das Recht, den Forschungsplan, die Arbeitsorganisation und den Zeitplan selbst festzulegen (Art. 5.4) sowie – ganz wichtig – das Recht, wissenschaftliches und administratives Personal selbst zu ernennen und wieder zu entlassen (Art. 5.5). 24 Diese Kompetenz wurde nicht infrage gestellt, doch wurde die Auswahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Leuten kritisiert, die noch vor der Publikation der Zwischenberichte die Arbeit der UEK beargwöhnten. 25 Der Arbeitskreis Gelebte Geschichte (vgl. unten, S. 106ff.) wollte in seinem Memorandum vom März 1998 Auskunft über die «weitgehend unbekannten Mitarbeiter und Gehilfen» der Bergier-Kommission und des Bundesarchivs. «Wer sind diese Leute, die durch die Auswahl der Akten die Wertungen der Historiker-Kommission massgebend beeinflussen? Wer hat sie nach welchen Kriterien ausgewählt (Curia in eligendo)? Nach welchen Grundsätzen arbeiten sie? Welche Ausbildung haben sie genossen? Welches war ihre bisherige Tätigkeit? Was haben sie bisher publiziert? Wo stehen sie parteipolitisch?» Die UEK war in diesem Punkt derart unabhängig, dass sie auf solche Fragen keine Auskunft geben musste.
Eine weitere Voraussetzung der Unabhängigkeit bestand darin, dass die UEK nur bedingt nach politischen Kriterien zusammengesetzt wurde und alle Mitglieder ausgewiesene Experten der zu bearbeitenden Fragen waren. Es gibt bekanntlich die Erfahrung, dass mit der Auswahl von Experten die Ergebnisse der Expertisen weitgehend vorweggenommen werden. Die für die UEK getroffene Auswahl lässt keine deutliche Tendenz in eine bestimmte Richtung erkennen, hingegen war mit der Berufung von Fachleuten der Geschichte eine Haltung zu erwarten, die gegenüber nationalen Geschichtsbildern kritisch eingestellt war. Die Wahl fiel auf Historiker aus der universitären Welt. Schon deswegen kam der ehemalige Geschichtslehrer, alt Stadtpräsident von Zürich und alt LdU-Nationalrat Sigmund Widmer, der sich gemäss Thomas Maissen «hartnäckig» um das UEK-Präsidium bemüht hatte, nicht infrage. 26 Widmer missbilligte wie Nationalrat Luzi Stamm die von Bundespräsident Villiger 1995 abgegebene Entschuldigung wegen der Flüchtlingspolitik der Kriegsjahre und gehörte später zu den Wortführern des die UEK kritisierenden Arbeitskreises Gelebte Geschichte (AGG). 27
Politisch mitbedingt, aber sachlich gerechtfertigt war, dass auch nicht schweizerische Fachleute für die Untersuchung der schweizerischen Verhältnisse beigezogen wurden. 28 Damit markierte die offizielle Schweiz ihre Bereitschaft für eine Abklärung ohne Rücksicht auf nationale Empfindlichkeiten. 29 Aus Rücksicht auf die Unabhängigkeit der UEK konnte Bundesarchivar Christoph Graf, der ein ausgezeichneter Kenner der Materie, aber als Chefbeamter des Bundes zu «staatsnahe» war, nicht Mitglied der UEK werden.
Zur Frage, ob die «richtigen» Historiker ausgewählt wurden, gab es zunächst keine öffentliche Diskussion. Hingegen gab es im Lauf der Zeit kritische Bemerkungen, weil die «interdisziplinäre» Kommission beinahe ausschliesslich aus Historikern zusammengesetzt war und sich die Interdisziplinarität der neunköpfigen Kommission darauf beschränkte, dass neben acht Fachleuten der Geschichtswissenschaft (allerdings mit unterschiedlichen Ausrichtungen) nur ein Jurist der UEK angehörte. 30
Schon bald wurde das angebliche Fehlen des ökonomischen Sachverstands bemängelt, dies aber nicht aus grundsätzlichen Überlegungen, sondern weil die im Mai 1998 präsentierten Befunde des Goldzwischenberichts politisch nicht passten (vgl. unten, Stamm, S. 92ff.). Vonseiten eines Soziologen wurde, naheliegend, der Nichteinbezug von Soziologen beanstandet. Nachvollziehbar war auch das Fehlen anthropologischer, psychologischer Kompetenz und von Spezialisten der kognitiven Wissenschaften. 31 Nach der Konstituierung der Kommission wurde die angeblich fehlende Vertretung der Aktivdienstgeneration (oder der Zeitzeugen) beanstandet (vgl. unten, S. 104ff.). Man hätte aber auch die Nichtberücksichtigung der jüngeren Historiker und die schwache Vertretung der Frauen und bestimmter Landesteile kritisieren können. Thomas Busset, anfänglich Mitarbeiter der UEK, bemängelte die schwache Vertretung der französischsprachigen Schweiz. Die Westschweizer Universitäten seien in der UEK nicht vertreten, und die Mitarbeiter aus diesem Landesteil würden «stets als zweite oder dritte Garnitur» gelten. Jean-François Bergier, der UEK-Präsident, obwohl Waadtländer/Lausanner, sei eigentlich auch keine Vertretung der Suisse romande, weil er in Zürich (an der ETH) tätig sei. 32
Blieb die UEK im Lauf ihrer Arbeit tatsächlich unabhängig? Die Einschätzung dieser Frage betrifft das Verhalten sowohl der einsetzenden Behörde als auch der eingesetzten Kommission. Die Befunde der UEK – und das war die Hauptsache – wurden in keiner Weise durch die Erwartungen der Behörden beeinflusst. Wieweit es trotzdem Beeinflussungsversuche gab, könnte das genaue Studium der UEK-Akten klären. Als problematische Nähe wurde der Doppelstatus des UEK-Generalsekretärs Linus von Castelmur empfunden, der aus dem diplomatischen Dienst kam und nach der UEK auch dort seine Zukunft hatte. Diese Konstellation führte denn auch aus einem konkreten Anlass am 20. März 2001 zu seiner fristlosen Freistellung und der anschliessenden Neubesetzung dieser Funktion durch Myrtha Welti.
Zwischen der UEK und der im Oktober 1996 geschaffenen, wirklich staatlichen Taskforce des EDA konnte es zu Irritationen kommen. Am deutlichsten zeigte dies eine Episode während der Washington Conference on Holocaust-Era Assets, die vom 30. November bis zum 3. Dezember 1998 stattfand. UEK-Präsident Jean-François Bergier verwies, als er 2005, also rückblickend, in einem Interview auf die Unabhängigkeitsproblematik angesprochen wurde, darauf, dass die Taskforce auf ein leises Vorgehen bedacht gewesen sei, die UEK dagegen ihr Verständnis «lautstark» habe verkünden wollen, nämlich Klarheit zu verschaffen und dabei die Schweiz weder anzuschwärzen noch reinzuwaschen. An der Washingtoner Konferenz habe das Aussendepartement der UEK das Verteilen ihres Papieres untersagen wollen und den aufgelegten Text sogar vorübergehend konfisziert; er sei erst nach Bergiers heftiger Reaktion wieder freigegeben worden. 33
Die UEK hatte ein paar formale Abhängigkeiten zu beachten: Gemäss Bundesratsbeschluss vom 19. Dezember 1996 stand sie in einem Auftragsverhältnis zum Bund. Als Ansprechpartner wurden bezeichnet: das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten für allgemeine Fragen, das Eidgenössische Departement des Innern für wissenschaftliche Fragen und das Eidgenössische Finanzdepartement für Fragen des Rechnungswesens. Die Kommission hatte den Bundesrat regelmässig, mindestens aber alle sechs Monate, über den Stand ihrer Arbeit zu orientieren, und der Bundesrat konnte Zwischenberichte zu besonderen Fragen anfordern. Im Weiteren bestand die Verpflichtung, den Bundesrat «umgehend» zu informieren, wenn sich im Lauf der Untersuchung konkrete Hinweise auf Vermögenswerte ergaben, die infolge der nationalsozialistischen Herrschaft in die Schweiz gelangt waren.
Als Einschränkung der Unabhängigkeit kann man die Bindung an das Amtsgeheimnis werten. Für UEK-Präsident Bergier war es aber selbstverständlich, dass es zwischen seiner Kommission und Kollegen ausserhalb der Kommission eine «weitestmögliche» Zusammenarbeit geben müsse; die UEK werde sich nicht in einen Elfenbeinturm einsperren, und Bergier sprach sogar von Synergieeffekten. 34 Bei Arbeitsbeginn im Juni 1997 machte die Kommission, was Fachkreise besonders interessiert haben dürfte und worauf auch reagiert werden konnte, ihren Forschungsplan öffentlich bekannt. Bereits im April 1997 erklärte UEK-Präsident Bergier, der schon zuvor zahlreiche internationale Kontakte gepflegt hatte, dass er mit anderen gleichartigen Kommissionen in Europa und ausserhalb von Europa Verbindung aufgenommen habe, um ein «reseau d’information» aufzubauen. 35 Die UEK lud am 28./29. Oktober 1997 eine Reihe von ausländischen Kollegen (aus Argentinien, Belgien, Kanada, Frankreich, den Niederlanden, Portugal, Schweden und den USA) nach Ascona auf den Monte Verità ein, dessen Name als Programm verstanden wurde. Die Absicht, den Ascona-Prozess fortzusetzen, wurde jedoch nur auf bilateraler Ebene und in eher privaten Kontakten umgesetzt. Zu einem weiteren internationalen Austausch kam es aufgrund einer Einladung der Bruno-Kreisky-Stiftung im Oktober 2001 in Wien, an dem der UEK-Präsident Jean-François Bergier und zwei weitere Mitglieder der schweizerischen UEK teilnahmen. 36 Der externe Austausch mit schweizerischen Fachkollegen war nur beschränkt möglich, informell in persönlichen Kontakten, formell auch einmal, im Juli 2000, in einer Gesprächsrunde mit Kollegen zum Thema Flüchtlingspolitik.
Der UEK-Präsident verstand es als zu einer seiner wichtigen Funktionen gehörend, in allen Richtungen Kontakte mit der Gesellschaft zu unterhalten. So bot er Hand zu Gesprächen etwa mit Exponenten der Aktivdienstgeneration 37 oder mit der SP-Fraktion der eidgenössischen Räte. 38