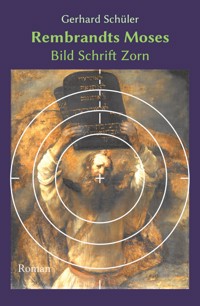
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Amsterdam, 1667: Eine Frau tritt als Heilerin, Modell, Lebensgefährtin und Chronistin in Rembrandts Leben. Sie hat die Ereignisse seiner letzten Lebensjahre in einem Tagebuch festgehalten. Ein Museumsvolontär hat das bislang unbeachtete Bündel alter Blätter in einem Amsterdamer Archiv entdeckt. Die Texte bringen endlich Licht in die Entstehungsgeschichte von Rembrandts Gemälde »Moses zerschmettert die Gesetzestafeln«. Sie gewähren neue Einblicke in das soziale Umfeld des Meisters. Wir begegnen Künstlern, Kunstfreunden, einem Rabbiner, einem Kabbalisten und dem Vorsteher der jüdisch-sephardischen Gemeinde. Beiläufig lassen ihre Handlungen und Gespräche die Umrisse einer Philosophie von Bild, Schrift und Wirklichkeit aufscheinen. Schließlich ist das Tagebuch Dokument der Persönlichkeitsentwicklung einer bemerkenswerten Frau des 17. Jh.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Schüler
Rembrandts Moses
Bild Schrift Zorn
Roman
Mit drei SW-Abbildungen
Impressum
Texte: © 2024 Copyright by Gerhard Schüler
Umschlag: © 2024 Copyright by Gerhard Schüler
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Gerhard Schüler
Zingster Str. 4
D-13357 Berlin
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-759881-45-8
*
Meiner Frau Doris Laidler-Schüler danke ich für das sorgfältige und anregende Lektorat.
Prolog
Er zerschmettert sie nicht! Das war mir schon beim ersten Besuch des Museums klar. Allein durch den Titel »Moses zerschmettert die Gesetzestafeln« war diese Deutung lange Zeit in der Forschung festgeschrieben. Dabei spricht alles an dem Bild dagegen. Immerhin wird inzwischen wieder eine weitere Version diskutiert.
Und hier kommt mein Beitrag: Während meines Volontariats bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz habe ich eine Entdeckung gemacht. Im Archiv des Rijksmuseums in Amsterdam stieß ich auf ein Konvolut von vergilbten Blättern, die mehrere hundert Jahre alt sein mussten, wie ich auf den ersten Blick erkannte. Der Kustos, den ich darauf ansprach, erklärte mir, die Papiere seien wissenschaftlich völlig wertlos.
Ich ließ mich dadurch nicht beirren und vertiefte mich in diese Blätter. Bald war mir klar, dass sie eine Sensation darstellen. Es handelt sich um Tagebuchaufzeichnungen mit Datumsangaben aus den Jahren 1667 bis 1669, geschrieben in einer zunächst ungelenken, dabei um Korrektheit bemühten, in der Folge immer sicherer wirkenden Schrift. Erkennbar ist auch ein Wandel der Sprache, die immer einfach bleibt, dabei aber zunehmend freier und differenzierter wird.
Nachdem ich mich eingelesen hatte, habe ich die Blätter eingescannt, den Text mit moderner Zeichensetzung ins Deutsche übertragen und digital erfasst. Die altertümliche Schreibweise der topografischen Angaben, hauptsächlich der Straßen- und Grachtennamen, habe ich beibehalten.
Die Aufzeichnungen werfen ein neues Licht auf Rembrandts Moses-Gemälde. Es steht nur in einem Teil des Materials, vor allem in der zweiten Hälfte, im Mittelpunkt. Da auch die anderen Passagen neue Facetten zum Bild des Malers beitragen können, insbesondere zum Verhältnis zu seinen Modellen und zu seinen ästhetischen Auffassungen, gebe ich den gesamten Text wieder.
*
Um die Orientierung im Dokument zu erleichtern, habe ich Überschriften hinzugefügt, die durch Fettdruck kenntlich gemacht sind.
Im Konvolut enthalten ist ein Blatt in etwas kleinerem Format (196 × 135 mm) mit hebräischem Text, geschrieben mit einer sepiafarbenen Tinte, wohl Bister. Die Textgestalt entspricht genau der zweiten Tafel der Zehn Gebote in der jetzigen sephardischen Synagoge. Diese Tafel ist vermutlich die im Konvolut erwähnte aus dem früheren Gotteshaus. Demnach handelt es sich bei dem besagten Blatt um eine unbekannte Zeichnung Rembrandts, die er in der damaligen Synagoge angefertigt hat. Sie diente mit Sicherheit als Vorlage für den Text der ersten Fassung des Gemäldes. Eine Ablichtung von ihr habe ich mit einer Übersetzung versehen und aufgenommen (Abb. 1).
In den Abschnitten zur Entstehung der zweiten Fassung des Gemäldes ist sehr detailliert von der Komposition des Bildes, auch von der Modifikation des Bibeltextes der Zehn Gebote und der Anordnung der Buchstaben die Rede. Diese Passagen sind ohne Grundkenntnisse des Hebräischen nicht ganz leicht nachvollziehbar.
Zum besseren Verständnis habe ich eine Abbildung des Gemäldes mit eingezeichnetem Kompositionsschema und Texthinweisen (Abb. 2) sowie eine Abbildung der Tafel mit Erläuterungen beigefügt (Abb. 3). Diese folgen exakt den Angaben in den Dokumenten. Damit unterstreiche ich auch den sensationellen Aspekt, dass uns hier eine kunsthistorische Formanalyse des 17. Jh. vorliegt, die direkt aus dem Entstehungsprozess des Werks hervorgegangen ist.
*
Mit dem Arbeitsergebnis, das ich heute vorstellen werde, wird endlich die Entstehungsgeschichte geklärt und der Streit um die richtige Interpretation entschieden. Auch wird man die Datierung revidieren müssen. Welche Konsequenzen mag dies für die Rembrandt-Forschung haben? Welche Optionen können sich daraus für mich ergeben?
*
Die Aufzeichnungen haben folgenden Wortlaut:
Der Auftrag
Sonntag, 4. September 1667
Ich soll schreiben üben, dann kann ich ihm noch auf andere Weise nützlich sein. Am Ende der Sitzung hat er mich gefragt: »Kannst du schreiben?«
Ich habe ihm erzählt, dass mein Vater mich schreiben gelehrt hat und sogar etwas Latein. Das ist ja bei einem Mädchen ganz ungewöhnlich. Der Unterricht ging bis zu seinem Tod, ich war damals zwölf Jahre alt. Auch habe ich dem Meister gesagt, dass ich in den letzten dreiundzwanzig Jahren nur wenig geschrieben habe. Wenn ich Besorgungen mache, muss ich mir nichts aufschreiben, weil mein Gedächtnis sehr gut ist. Ich will auch Papier sparen, einiges brauche ich ja, weil ich meinem Sohn das Alphabet beibringe.
Die Augenbrauen des Meisters gingen in seinem runden Gesicht für einen Augenblick leicht nach oben – wie bei einem Lehrer, wenn er mit einer Antwort zufrieden ist. Er griff in die Truhe neben seinem Arbeitstisch und nahm einen dicken Stapel Papierbögen heraus: »Schmierpapier, die Rückseite ist frei, die kannst du zum Üben benutzen, hier hast du ein paar Federkiele, wenn sie abgeschrieben sind, bring sie her, dann schneide ich sie nach. Und dort auf dem Regal, nimm eines der beiden Gläser mit Tinte. Wenn es leer ist, bring es zum Nachfüllen. Lass dir von der Magd auch ein paar Talglichter geben.«
Ich packte Papier, Federn und Tinte in meinen Korb und fragte ihn: »Aber was soll ich denn aufschreiben?«
»Hast du eine Bibel?«
»Ja, die hat mir mein seliger Vater hinterlassen; am Sonntag lese ich manchmal darin.«
»Dann schreib Geschichten aus der Bibel ab.«
Ich wünschte ihm eine gute Nacht, ging zur Magd, der ich von meinem Auftrag erzählte, und ließ mir die Lichter geben. Diese packte ich zu den anderen Dingen in den Korb und ging aus dem Haus. Für den Heimweg brauchte ich etwas mehr als eine Stunde, denn ich musste einen Umweg machen. Bei Gevatterin Kathrin, die auch außerhalb der Stadtmauer wohnt, aber in einer anderen Richtung als ich, holte ich Jacob ab. Wir plauderten noch eine Weile, aber ich sagte nichts vom Schreiben. Dann ging ich mit dem Jungen zu meiner Hütte. Als wir ankamen, konnten wir schon die ersten Sterne sehen. Ich versorgte das Kind und nachdem es eingeschlafen war, ging ich zum Schrank. In ihm sind meine Kleider und andere Dinge, die ich brauche, auch einige Andenken an meinen Vater. Auf dem mittleren Brett schob ich die Wäsche zusammen, damit Platz für die mitgebrachten Sachen war. Dann räumte ich auf dem Tisch eine Ecke frei. Darauf legte ich das erste Blatt, einen Federkiel und die Tinte und auch ein Talglicht. In der Kochecke fand sich ein Kerzenhalter; auf den steckte ich das Licht und zündete es an. Ich stellte es links oben neben das Blatt Papier, sodass es recht beleuchtet war. Die Öllampe an der Decke des Raumes löschte ich.
*
Ich setzte mich an den Tisch vor das Papier und drehte den Pfropfen des Tintenglases mit etwas Mühe heraus, denn an seinem Rand hatte sich eine Kruste gebildet und er saß fest. Dabei hatte ich Angst, durch eine falsche Bewegung den kurzen Hals des Glases zu zerbrechen. Den Pfropfen legte ich auf einen kleinen Teller, den ich aus dem Geschirr griff, das noch auf dem Tisch lag. Ich nahm einen Federkiel, der etwa so lang war wie meine Hand von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Bis auf einen winzigen Rest war die Fahne der Feder abgezogen. Der Kiel war leicht gebogen. Ich rollte ihn zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her. Dabei schmiegte er sich wie von selbst dem Zeigefinger an und der Mittelfinger stützte ihn von der Seite.
Das vordere Ende war in zwei Stufen von unten wie ausgehöhlt geschnitten. So war auf der Oberseite eine schlanke Spitze entstanden, mit leicht geschwungenen Rändern. In der Breite eines halben Fingernagels war sie längs eingeschnitten.
Ich tauchte den Federkiel in die grün-schwarze Tinte und hielt die Spitze an den Hals des Glases, damit die Flüssigkeit, die zu viel war, zurückfließen konnte. Dann schrieb ich sorgfältig den Buchstaben I auf das Papier, dann »c« und »h«, nach einem Zwischenraum »s« und »o« und zweimal »l«, nahm wieder Tinte auf, ließ wieder einen Zwischenraum und schrieb »s« und »c« und »h«, dann »rei« und »ben« und dann mit neuer Tinte »üben« und danach machte ich einen Punkt.
Es ist doch seltsam mit dem Schreiben. Du fügst ein paar kleine Linien zusammen und hörst einen Laut, du fügst einige Buchstaben zusammen und siehst ein Ding oder wie etwas gemacht wird, du fügst einige Wörter zusammen und du hast einen Gedanken auf das Papier gesetzt. Ich will keine Geschichten aus der Bibel abschreiben. Nein, ich schreibe die Geschichte auf, in die ich hineingeraten bin. Wenn sie gut ausgeht, kann mein Sohn, wenn er sie irgendwann einmal liest, sich ein Bild von mir machen. Wenigstens sieht er, dass ich nicht unehrenhaft war, zumindest nicht allzu sehr.
*
Es begann vor etwa zwei Monaten an einem Montagnachmittag. Ich war dabei, Gemüse für das Abendessen zu putzen, da klopfte jemand an die Tür meiner Hütte. Ich öffnete und vor mir stand der Sohn des Meisters. Er bot mir freundlich einen guten Tag und fragte: »Ihr kennt mich?«
»Ja«, antwortete ich, »an den Feiertagen sehe ich Euch vorn in der Kirche.«
»Erlaubt Ihr, dass ich eintrete?«
»Ich bitte Euch, kommt herein.«
Ich ließ ihn eintreten, schloss die Tür und ging zum Tisch. Schnell packte ich das Gemüse in zwei Körbe, die am Boden standen, und schob das Geschirr und die Messer zusammen. Jetzt war der halbe Tisch frei, ich wischte ihn mit einem Tuch sauber und bat den Besucher, Platz zu nehmen. Er setzte sich und legte seinen Hut auf den Tisch.
»Könnt Ihr Euren Jungen hinausschicken?«
Ich band Jacob einen Schal um und schickte ihn zum Spielen nach draußen. »Da ich auf Euren Besuch nicht vorbereitet bin, kann ich Euch nicht bewirten, wie es sich geziemt. Darf ich Euch ein Glas Milch, Honig und Brot anbieten?«
»Nein, ich danke Euch, aber wenn es hier draußen reines Wasser gibt, wäre mir ein Glas recht.«
Ich sagte ihm, dass wir eine tiefe Zisterne mit sauberem Wasser haben. Aus der Küche holte ich einen vollen Krug davon, goss ihm und mir einen irdenen Becher ein und setzte mich ihm gegenüber.
Er trank einen Schluck und begann nach einer kurzen Pause: »Ich komme in einer etwas heiklen Mission zu Euch. Wie Ihr vielleicht wisst – die Stadt war seinerzeit ja voll von Tratsch und Gerüchten – hat mein Vater vor etwa zehn Jahren großes Unglück in Geschäftsdingen gehabt. Seitdem lebt er als mein Angestellter bei mir im Haus. Vor einigen Jahren ist die Frau gestorben, die um ihn war, eine Stütze für ihn. Das hat ihn sehr getroffen und es befiel ihn eine große Niedergeschlagenheit. Die Ärzte nennen es Melancholie. Sie ist in den letzten Monaten immer schlimmer geworden und seit drei Wochen liegt er nur noch im Bett, mit dem Gesicht zur Wand. Einmal am Tag nimmt er etwas Essen zu sich, meist eine Suppe, die ihm die Magd reicht.«
»Das tut mir sehr leid für ihn und für Euch.«
»Ich habe mehrere Ärzte konsultiert, die zu dem Schluss kamen, dass eine seelische Kälte die Ursache für seinen bedauernswerten Zustand ist. Sie sehen nur ein Heilmittel, nämlich dass eine junge Frau ihm Wärme spendet.«
»Wie soll das geschehen?«
»Indem die Frau sich zu ihm ins Bett begibt und sich eng an ihn schmiegt, damit ihre Wärme auf ihn übergeht.«
»Ihr meint, dass sie sich nackt zu ihm legt?«
»Ihr habt begriffen.«
»Und warum erzählt Ihr mir das?«
»Warum wohl bin ich zu Euch gekommen? Wollt Ihr diese Frau sein? Es wäre nicht zu Eurem Schaden.«
»Was erlaubt Ihr Euch! Oder redet man so schlecht über mich, dass Ihr mir ein solches Angebot macht?«
»So sollt Ihr das nicht sehen. Kennt Ihr vielleicht die Geschichte von König David: ›Und der König David war alt, wohlbetagt; und sie bedeckten ihn mit Kleidern, aber er wurde nicht warm. Da sprachen seine Knechte zu ihm …‹«
»›… man suche meinem Herrn, dem König, ein Mädchen, eine Jungfrau; und sie stehe vor dem König und sei ihm eine Pflegerin, und sie schlafe an seinem Busen, dass mein Herr, der König, warm werde.‹«
»Meine Hochachtung, Ihr seid wirklich bibelfest! Ja, so sollt Ihr meinen Wunsch begreifen. Ich sehe darin nichts Unehrenhaftes. Ihr sollt meinen Vater von seiner tiefen Niedergeschlagenheit heilen. Und damit Ihr seht, dass ich es damit ernst meine, biete ich Euch den gleichen Lohn, den ein Arzt erhält.«
Er griff in einen Beutel, den er bei sich trug, nahm einen Gulden heraus und legte ihn auf den Tisch: »Dieser Gulden gehört Euch, wenn Ihr einwilligt. Und für jeden Besuch erhaltet Ihr einen halben Gulden. Die Ärzte meinen, dass fünf bis zehn solcher Besuche notwendig sind, um ihn von seiner Melancholie zu heilen.«
*
Mein Vater hat mir die Hütte hier draußen hinterlassen. Ich habe einen richtigen Schrank, zwei Betten, den Tisch, vier Stühle und noch ein paar kleine Möbelstücke. So lebe ich mit meinem Sohn. Außerdem habe ich ein kleines Vermögen von dreißig Gulden geerbt. Davon habe ich schon acht Gulden aufgebraucht. An der Hütte müsste einiges ausgebessert werden. Unsere tägliche Nahrung erwerbe ich durch Mithilfe in einigen Haushalten und verschiedene Botendienste. Für Jacob müsste bald Schulgeld gezahlt werden.
Wenn ich auf das Angebot eingehe und die Geschichte sich herumspricht, wird das meinem Ruf schaden? Was habe ich zu verlieren? Bei meinem geringen Vermögen und mit einem unehelichen Kind kann ich nicht hoffen, einen Mann zu finden, der mich heiratet. Dass er diese Geschichte aus der Bibel, von David und der Jungfrau, erwähnte, zeigt mir, dass er mich nicht demütigen wollte. Ich nickte.
Er schob den Gulden zu mir hin: »Das freut mich, dann kommt nächste Woche, Montagnachmittag gegen drei Uhr. Ihr kennt den Weg?«
Die ersten Besuche
Es war der zweite Montag im Juli. Der Sohn des Meisters begrüßte mich wie jemanden, der von gleichem Stand ist, und reichte mir den halben Gulden, den er aus dem Beutel zog. »Die Magd führt Euch zu ihm.«
Die Tür zum hinteren Zimmer war angelehnt. Sie öffnete sich und eine ältere Frauensperson, die aber aufrecht ging, kam auf mich zu. In ihrer Miene konnte ich nichts lesen. Mit der rechten Hand gab sie mir ein Zeichen, ihr zu folgen. Sie ging vor mir die Treppe hoch ins erste Obergeschoss. Am Ende der Treppe war ein Absatz mit einer Tür links und einer zweiten geradeaus. Diese öffnete sie und forderte mich mit einer Handbewegung auf, den Raum zu betreten. Sie schloss die Tür hinter uns und ging mit mir zu einem großen Bett, das links von uns mit dem Kopfende an der schmalen und mit der langen Seite an der breiten Wand stand. Die Läden vor den Fenstern an der Wand gegenüber waren fast ganz geschlossen, sodass nur wenig Licht in das Zimmer kam. Die schweren Vorhänge am Bett waren gerafft und an den hohen Bettpfosten zusammengebunden. In den Kissen lag unter einer Decke, die ihn bis zum Hals bedeckte, mit dem Gesicht zur Wand, der Meister. Er nahm keine Notiz von uns.
Die Magd wies auf einen Stuhl, der neben dem Bett stand, und sagte mit einer etwas kratzigen, aber nicht unfreundlichen Stimme: »Hier kannst du deine Kleider ablegen.« Ich zögerte, weil ich hoffte, sie würde den Raum verlassen, aber sie schaute mich nur an, ohne dass ich in ihrem Gesicht ein Gefühl lesen konnte. Langsam legte ich meine Kleider ab, den Umhang, mein Kleid, das Unterkleid, die ich eins über das andere auf den Stuhl legte, zuletzt meine Kopfhaube.
Als ich ganz nackt dastand, hob sie die Decke, unter welcher der Alte lag, der mit einem langen Nachthemd bekleidet war, und sagte: »Schmieg dich eng an ihn und leg deinen rechten Arm um ihn.«
Das Bett ist so groß, dass man mit angezogenen Beinen auf der Seite liegen kann. Ich stieg hinein und legte mich so hin, dass mein Bauch, die Vorderseiten meiner Oberschenkel und meine Brüste ihn berührten. Er blieb völlig regungslos auf der linken Seite seines Körpers liegen, auch als ich meinen Arm um ihn legte und meine Hand auf seinem weichen Bauch lag. Die Magd deckte mich mit dem Teil der Decke, den sie angehoben hatte, zu und stopfte sie so in meinem Rücken fest, dass kein Luftzug an uns kommen konnte. »Bleib so, einfach so, schlaf nicht ein, in drei Stunden komme ich wieder.« Die Bettvorhänge löste sie nicht. Sie verließ den Raum und schloss die Tür.
*
Das Nachtgewand des Meisters war von feinerem Stoff als meine Unterkleider und tat meiner Haut wohl. Der Geruch, der von ihm ausging, war ein wenig säuerlich, aber nicht unangenehm. Sein Atem war regelmäßig, nicht schnell, aber auch nicht langsam, nicht gerade leicht, aber auch nicht schwer. Um das Geräusch zu beschreiben, fehlt mir das richtige Wort, ich musste an die Brandung der See denken, wenn man sie aus weiter Ferne hört, so weit, dass man sie gerade noch wahrnehmen kann. Die Farbe seiner Haare konnte ich nicht genau erkennen – es war ja ziemlich dunkel im Raum. Ich hatte den Eindruck, dass seine Haare früher einmal braun, inzwischen aber zum Teil grau geworden waren. Sie standen am Hinterkopf in dichten Locken und zur Schädelmitte hin wurden sie dünner.
Da ich auf meiner linken Körperseite lag, musste ich für meinen angewinkelten linken Arm eine einigermaßen bequeme Stellung finden. Meine rechte Hand führte ich etwas nach oben, dorthin, wo sein Bauch in den Brustkorb überging. Hier machte meine Hand das Auf und Ab seines Atems mit. So blieb die Zeit nicht stehen, bis sich die Zimmertür wieder öffnete und die Magd hereinkam. »Du kannst jetzt aufstehen.«
Obwohl ich nicht eingeschlafen war, hatte ich das Gefühl, geweckt zu werden. Ich nahm meinen rechten Arm von ihm, drehte mich auf den Rücken, schlug mit meiner Linken die Decke zurück und setzte mich auf die Bettkante. So verharrte ich einen Augenblick, stand auf und wandte mich dem Stuhl mit meinen Kleidern zu. Die Magd trat an das Bett heran und richtete die Decke im Rücken des Alten so, dass dieser wieder vollständig eingehüllt war. Dann ging sie aus dem Zimmer und ließ die Tür einen Spalt offen. Ich zog rasch meine Kleider an und verließ den Raum. Die Magd, die draußen auf mich gewartet hatte, schloss die Tür hinter mir. Sie ging vor mir die Treppe hinunter und entfernte sich in die Stube, aus der sie bei meiner Ankunft aufgetaucht war.
Der Sohn, der an einem Tisch mit Aufzeichnungen beschäftigt war, legte den Federkiel auf eine Ablage, stand auf, öffnete mir die Tür nach draußen und sagte mit freundlicher Stimme: »Dann bis zur nächsten Woche um die gleiche Zeit.«
*
In der folgenden Woche öffnete mir die Magd. »Der Herr ist heute nicht zu Hause. Hier!« Damit gab sie mir den halben Gulden, den sie bereitgehalten hatte. Wortlos führte sie mich in das Zimmer des Meisters, wartete, bis ich mich entkleidet und meine Lage an der Seite des Alten eingenommen hatte. Sie zog die Decke so über uns, dass der Meister und ich vollständig eingehüllt waren, und ging aus dem Raum.
In den drei Stunden gab es kein Anzeichen dafür, dass er mich wahrgenommen hätte. Dann kam die Magd wieder und schlug die Decke über mir zurück. Nachdem ich das Bett verlassen hatte, hüllte sie den Meister sorgfältig ein und ging hinaus. Ich zog mich an, ging aus dem Zimmer und wurde von ihr mit den Worten verabschiedet: »Bis zum nächsten Mal!«
*
In der Woche darauf lief alles auf die gleiche Weise ab, nur dass der Sohn wieder anwesend war, mich entlohnte und auch verabschiedete. Beim vierten Besuch berührte mich der Meister einmal. Etwa in der Mitte der Zeit, die ich bei ihm verbrachte, bewegte er den linken Arm und legte seine Hand leicht auf meine rechte, die auf seinem Körper lag. Nach wenigen Augenblicken glitt seine Hand wieder herab auf die Matratze. Beim nächsten Besuch schien er mich wieder nicht zu bemerken, ebenso in der Woche danach.
*
Auch als ich zum siebten Mal bei ihm war, spielte sich zunächst alles so ab wie bei den letzten Besuchen. Die Magd öffnete die Tür, ich legte mich zu ihm und schmiegt mich an seinen Rücken. Die Haltung war mir inzwischen fast schon zur Gewohnheit geworden, auch wenn sie auf die Dauer der drei Stunden immer noch etwas unbequem war. Beim Auf und Ab seines Atmens dachte ich an die See.
So war vielleicht eine knappe Stunde vergangen, als er sich langsam zu mir umdrehte. »Jetzt wird er einfordern, wofür ich eigentlich entlohnt werde«, dachte ich und mein Bauch zog sich zusammen. Beim Umdrehen fasste er mein rechtes Handgelenk und schob meinen Arm von sich weg. Er wandte sich mir ganz zu, ich rückte etwas von ihm ab. Dadurch entstand ein freier Raum zwischen uns, der von der Bettdecke überspannt war. Unter sie fiel ein wenig Licht, das meine Brüste gerade noch erkennen ließ. Diese waren eines der ersten Ziele für seinen Blick. Der wanderte nach einer kleinen Weile an mir hoch bis zu den Augen.
Mit einer langsamen Bewegung legte er seine linke Hand auf meinen Kopf und befühlte mit allen Fingern mein Haar. Dann strich sein Zeigefinger über meine rechte Augenbraue, abwärts über die Nase bis zu meiner Oberlippe, folgte ihrer Linie bis zum linken Mundwinkel, machte kehrt, der Unterlippe entlang, bis zu meinem Kinngrübchen. Nun, auf dem Weg entlang des Kinns bis zu meinem Hals, gesellte sich der Mittelfinger hinzu. Bei meiner rechten Schulter war der Ringfinger dabei; am Ellbogen spürte ich auch seinen kleinen Finger, und mit der ganzen Hand berührte er meine Hüfte. Seine Hand war nicht gierig, ich dachte an die weiche Pfote einer Katze, die ihre Krallen eingezogen hat.
Soweit er reichen konnte, ohne seine Stellung zu sehr zu verändern, strich er mir über den linken Oberschenkel. Er versuchte nicht, seine Hand zwischen meine Schenkel zu schieben, aber seine Finger spielten ein wenig mit meinem Schamhaar. Darauf nahm seine Hand den Weg nach oben, über meinen Bauch, wo sein Zeigefinger mehrmals um den Nabel strich, weiter zu meiner rechten Brust, die er zunächst mit der ganzen Hand fasste. Bald rieb sein Zeigefinger mit kreisförmigen Bewegungen meine Brustwarze, die davon fester wurde. Seine Hand wanderte weiter, durch die Vertiefung über dem Schlüsselbein, an meinem Hals entlang und kam in meinen Haaren zur Ruhe. Wir sahen einander in die Augen. So lagen wir eine Weile, bis er sich langsam wieder zur Wand drehte. Auch ich nahm meine vorige Haltung wieder ein.
Die neue Rolle
In der folgenden Woche, am letzten Montag im August, wurde ich wie gewöhnlich empfangen und bekam vom Sohn des Meisters den halben Gulden. Diesmal war die Magd nicht anwesend, um mich in das Zimmer des Meisters zu führen. Stattdessen forderte er mich auf: »Geht zu dem Alten hinauf!«
Ich ging die Treppe hoch, öffnete die Tür und machte nur einen Schritt. Es war heller im Zimmer als sonst, weil beide Läden an der Wand gegenüber geöffnet waren. Der Meister stand mitten im Raum, angezogen mit Bluse und Hose, darüber trug er einen samtenen Hausmantel. Er sah mich an und lachte freundlich: »Komm nur herein und schließ die Tür!«
Ich folgte seiner Anweisung und dann stand ich in dem Zimmer vor ihm und schaute ihn an. So selbstverständlich, als wäre es die gewöhnlichste Sache der Welt, sagte er: »Zieh dich aus, ich will dich zeichnen.«
Was sollte ich tun? Er kannte meinen Körper ja schon, aber das war jetzt etwas anderes. Bei dem Gedanken, dass ich nackt vor ihm liegen, vielleicht auch sitzen und stehen sollte, seinen Blicken ausgesetzt, stieg Scham in mir hoch. Ich hatte meinen Lohn bekommen. Sollte ich wieder gehen und das Geld zurückgeben, den halben Gulden? Langsam breitete sich eine neue Empfindung über meinen Körper aus, eine Art Neugier oder sogar Abenteuerlust, die mir Angst vor mir selbst machte. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich seinen Anforderungen nicht genügen konnte. »Meister, für das, was Ihr wollt, solltet Ihr Euch eine andere suchen. Ich bin nicht schön.«
»Was heißt schön? Was ist Schönheit? … du lebst.«
»Aber es ist unrecht, was Ihr von mir fordert.«
»Unrecht? … vor wem? Ich will das Bild deines Leibes festhalten, den Gott geschaffen hat. Hat Gott etwas Unrechtes geschaffen? Im Paradies waren die Menschen nackt, erst ihre Sünde hat ihnen Angst vor ihrem Leib gemacht.«
Ich konnte dem, was er sagte, nicht folgen. Aber es beruhigte mich. Wie bei den früheren Besuchen legte ich meine Kleider auf den Stuhl neben dem Bett, aber jetzt war er für jede meiner Bewegungen ein Zuschauer. Als ich nichts mehr am Leib hatte, lachte er: »Nun bist du Eva.«
Er breitete eine weiße Decke auf dem Boden aus, in einigem Abstand von den beiden Fenstern. »Komm auf die Decke, in die Mitte, sodass das Licht von vorn auf dich fällt. Hier, nimm den Apfel in die rechte Hand und halte ihn hoch, als wolltest du ihn Adam reichen, der neben dir steht.«
Prüfend sah er mich an. »Die Hand mit dem Apfel etwas tiefer, lass den anderen Arm locker herabhängen, so ist es gut.«
Er setzte sich zwischen den beiden Fenstern vor die Wand neben einen kleinen Tisch, den er dort abgestellt hatte. Darauf lag ein Stapel Papier, auch etliche Federn und Pinsel und dazu ein Glas mit Tinte. An den Tisch gelehnt war ein Brett, das er auf seinen Schoß legte. Darauf klemmte er eines der Blätter fest, nahm eine grobe Feder aus Rohr und fing an, mit schnellen Strichen zu zeichnen. Nach wenigen Minuten ließ er das Blatt auf den Boden gleiten und befestigte ein neues Papier auf dem Zeichenbrett. Diesmal ging er mit einer Vogelfeder bedächtiger zu Werk. Nach knapp einem Dutzend größeren Zügen blieb seine Hand mit kurzen Bewegungen länger an einer Stelle. Auch seine Augen, die vorher in raschem Wechsel an mir auf und ab gegangen waren, verweilten nun länger auf den einzelnen Partien meines Körpers. Meine rechte Hand mit dem Apfel wurde immer schwerer. »Meister, ich kann den Apfel nicht mehr lange halten.«
»Es ist auch gut, iss den Apfel, wenn du magst.«
Das Angebot schlug ich nicht aus. Er legte mir einen samtenen Umhang über die Schultern: »Du sollst mir nicht frieren.« Nachdem ich den Apfel aufgegessen hatte, musste ich den Umhang wieder ablegen und in der linken Hand einen Pfeil halten. Mit Kreide machte er eine Reihe von Zeichnungen, wobei ich mich mal nach rechts, dann nach links zu drehen hatte. Das ging etwa eine Stunde so. »Du hast das sehr gut gemacht, für heute ist es genug. Mein Sohn wird mit dir reden.«
*
Als ich mich wieder angekleidet, das Zimmer verlassen, die Tür hinter mir geschlossen hatte, die Treppe hinuntergegangen war und wieder unten im vorderen Raum stand, lud mich der Sohn mit einer Handbewegung ein, mich zu ihm an den Tisch zu setzen.
»Ihr habt Eure Aufgabe als Arzt gut erfüllt. Ich bin Euch zu Dank verpflichtet. Mein Vater ist wieder er selbst. Was er jetzt braucht, ist ein Modell zum Zeichnen. Er wünscht, dass du hierfür von Montag bis Freitag täglich für zwei bis drei Stunden am Nachmittag kommst. Das Modellgeld beträgt einen Stuiver die Sitzung, die Summe erhältst du am Ende der Woche von mir. Bist du einverstanden?«
Ich konnte nicht erwarten, dass ich für das Modell-Stehen so reichlich entlohnt würde wie bisher. Fünf Stuiver die Woche waren ja auch nicht zu verachten. Aber es ging nicht nur um das Geld. Auf einmal kam mir der Gedanke, dass ich hierher gehöre, dass es seine Ordnung hat, wenn ich in dieses Haus komme, meine Kleider ablege und für den Meister da bin. Ich hatte ihn aufgeweckt, ich war nun sein Modell, er war viel älter als ich. Dabei hatte ich ein Gefühl für ihn, das ich schwer beschreiben kann. Als Kind hatte ich einmal einen Vogel gefunden, dessen Flügel gebrochen war. Ich hatte ihn angehaucht, seinen Kopf gestreichelt, ihm Körner in den Schnabel gesteckt. Das kam mir jetzt in den Sinn und ohne weiter nachzudenken, nickte ich mit dem Kopf. Ich wurde verabschiedet: »Schön, dann bis zur nächsten Woche!«
*
Am folgenden Montag lag das weiße Tuch am gleichen Platz wie beim letzten Mal. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und sah ihn an. Sein Lächeln erinnerte mich an das von Jacob, wenn er mir einen kleinen Streich spielt.
»Zieh erst einmal nur die Schuhe aus und komm hier auf das Tuch. So, jetzt drehst du dich etwas nach links und gehst in die Hocke und hebst dein Kleid hoch, höher, so als wolltest du pissen.«
»Das geht doch nicht, das kann ich doch nicht tun.«
»Warum nicht? Ist es ehrenrührig zu pissen? Wir müssen froh sein, dass wir dazu fähig sind. Ich kannte mal einen, der es nicht mehr konnte. Glaub mir, dem ging es nicht gut und er war nicht mehr lange unter den Lebenden. Also zier dich nicht«, sagte er und es klang fast zärtlich.
»Eigentlich hat er recht«, dachte ich und folgte, ohne weiter zu überlegen, seiner Anweisung. Nachdem er fünf, sechs Zeichnungen gemacht hatte, für jede musste ich mich ein wenig mehr nach rechts drehen, hatte ich keine Kraft mehr, in der Hocke zu bleiben.
Er lachte: »Ich hab nicht mehr daran gedacht, ich will dich ja nicht quälen, jetzt kannst du dich ausziehen.«
Als ich nackt vor ihm stand, legte er mir einen Umhang über die Schultern, der so schmal war, dass er meinen Bauch nicht bedeckte: »Leg dich aufs Bett. Kennst du die Geschichte von Josef und der Frau des Potiphar?«
»Ja, Josef diente im Haus des Potiphar und dessen Frau wollte ihn verführen. Josef ging nicht darauf ein, denn dies wäre in seinen Augen schändlich gegenüber seinem Herrn gewesen. Da riss sie ihm seinen Mantel weg und machte ein großes Geschrei und behauptete, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Darauf musste Josef für lange Zeit ins Gefängnis.«
»Du kennst dich sehr gut aus in der Schrift. Ich habe die Szene vor Jahren gemalt. Jetzt will ich dich als Potiphars Frau zeichnen. Leg dich auf die rechte Seite und richte den Umhang so, dass deine rechte Brust bedeckt ist, die linke lass bloß.«
Ich richtete den Umhang und er trat ans Bett, um die Lage noch mal so zu verändern, dass meine linke Schulter bis zum seitlichen Rand der Brust bedeckt war. Er ging einen Schritt zurück, richtete sich den Stuhl mir gegenüber und nahm sein Zeichenbrett und braune Kreide. »Nimm das linke Bein etwas zurück!«
Ich zögerte, ihm so offen meine Scham zu zeigen. Er bemerkte es. Mit ruhiger Stimme, wie ein Arzt, der sich erkundigt, wo es wehtut, fragte er: »Wie stellst du dir Potiphars Frau vor?«
»Eine schlimme Person.«
»Ein Weib, lüstern bis über die Ohren und abgrundtief böse. Josefs Weigerung, ihr beizuliegen, hatte ihre Gier unbefriedigt gelassen und ihren Stolz verletzt. Du bist mein Modell, ich will deinen Leib studieren, aber du verkörperst auch die Figuren, die ich im Bild gestalten will. Also stell dir dieses Weib vor, denk dir, sie entblößt sich, um die Wut ihres Mannes auf Josef zu steigern, und nimm das linke Bein zurück.«
Ich war nicht die Frau des Potiphar, ich war nicht lüstern und ich wollte auch nicht böse sein, aber ich nahm die Stellung ein, die er haben wollte. Für jede Zeichnung richtete er die Lage des Umhangs etwas anders, sodass mehr oder weniger von meiner linken Brust entblößt war. Er arbeitete ziemlich schnell und ließ die fertigen Skizzen auf den Boden gleiten. Zahlreich lagen sie um ihn herum, als er sagte: »Für heute ist es genug.«
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und betrachtete mich wie ein Gärtner, der seine Tulpen prüft. Dann nahm er ein Blatt nach dem andern und schaute dabei abwechselnd auf mich und auf die Zeichnung in seinen Händen.
»Ich habe lange nicht mehr gezeichnet, aber ich glaube, ich habe es nicht verlernt.« Das klang zufrieden. »Zum Abschluss für heute noch eine Danae. Weißt du, was es mit der auf sich hat? Nein? Die Geschichte steht nicht in der Bibel, das ist antike Mythologie. Zeus, der oberste der griechischen Götter, hatte große Freude daran, seine Gattin mit hübschen jungen Frauen zu betrügen. Für dieses Geschäft verwandelte er sich in verschiedene Gestalten: Zu Leda kam er beispielsweise als Schwan und zu Danae kam er als Goldregen, der sie schwängerte.«
Er kam ans Bett, nahm mir den Umhang ab und schob Kissen in meinen Rücken, sodass mein Oberkörper halb aufgerichtet war. »Dreh dich etwas auf die rechte Seite, winkle die Beine leicht an, das linke Knie weiter nach oben.«





























