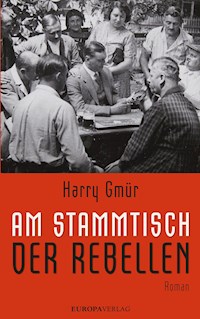Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch vereinigt Reportagen, Essays und Kommentare des Schweizer Schriftstellers und Publizisten Harry Gmür, die er in den Jahren des Nationalsozialismus unter seinem Namen und während des Kalten Krieges unter verschiedenen Pseudonymen verfasst hat. In den 1930er-Jahren beschrieb er die faschistischen Strömungen in der Schweiz und die hitleraffine und Franco-freundliche Politik der helvetischen Landesregierung, die er mit schonungsloser Schärfe kritisierte, zumeist in Artikeln seiner eigenen Wochenzeitschrift ABC. In den 1950er-Jahren bis zu seinem Tode berichtete er, vor allem in der ostdeutschen Weltbühne und in Büchern, über seine Afrikareisen und analysierte kenntnisreich die Befreiungskämpfe verschiedener afrikanischen Länder vom Joch des Kolonialismus. Ebenfalls mit kritischem Blick bereiste er die damaligen westlichen Diktaturstaaten wie Spanien und Griechenland. Mit der gleichen stilistischer Eleganz, die man von seinen Romanen kennt, vereinigt Harry Gmür anschauliche Erlebnisschilderungen und brillante Stimmungsbilder mit kenntnisrechen Analysen der politischen Vorgänge – das politische Vermächtnis eines engagierten Antifaschisten und ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harry Gmür
REPORTAGEN VON LINKS
Vier Jahrzehnte Kampf gegen Faschismus und Kolonialismus
Mit einem Vorwort von Jean Ziegler
1. eBook-Ausgabe 2020
© 2020 Europa Verlag AG, Zürich
Umschlaggestaltung und Motiv:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Redaktion: Franz Leipold
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Gesetzt aus der Calluna und der Simple
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-335-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Harry Gmür, der Unbeirrbare
Vorwort von Jean Ziegler
1.Die große Illusion
2.Die Schweiz nach der tschechischen Katastrophe
3.Die Schweiz und der spanische Krieg
4.Der Verrat an der spanischen Republik
5.Die harmlosen faschistischen und nationalsozialistischen Ausländer in der Schweiz
6.Die Nation für Unabhängigkeit, Frieden, soziale Gerechtigkeit und Demokratie
7.Hitlers Krieg und die Schweiz
8.Damals in der Schweiz
9.Dürrenmatts »Wiedertäufer«
10.Frisch contra Noelte
11.Pariser Straßen (I)
12.Pariser Straßen (II)
13.Pariser Straßen (III)
14.»Kreuzfahrer« heute
15.Im Schatten der Alhambra
16.Fotografieren verboten
17.Spiele statt Brot
18.Mord in Saloniki
19.Interview mit Julius Nyerere
20.Cha Cha Cha
21.Bei Kenneth Kaunda
22.Lagos – Stadt in der Lagune
23.Benin – uraltes Kulturzentrum
24.Im Königspalast
25.Erinnerung
26.Ein Interview mit Sekou Touré
27.König Fußball
28.M’Balia, die Heroin
29.Der Präsident
30.Ein Interview mit Jacobo Arbenz Guzmán, dem letzten demokratischen Präsidenten der Republik Guatemala
Anmerkungen
Quellennachweis
Harry Gmür, der Unbeirrbare
Vorwort von Jean Ziegler
Im dänischen Exil 1938 verfasste Bertold Brecht das Stück Leben des Galilei. In der 13. Szene sagt der Arbeiter Andrea: »So viel ist gewonnen, wenn nur einer aufsteht und sagt ›nein!‹« … Harry Gmür war ein Dissident. Wie Peter Surava, Konrad Farner, Carl Albert Loosli und einige wenige andere.
Dissidenten zahlen in der Schweiz einen hohen persönlichen Preis: Sie werden verunglimpft, verleumdet, zensuriert und von Regierung und Behörden in jeder möglichen Form belästigt und verfolgt. Harry Gmür hat dieses Schicksal seit den späten 1930er-Jahren bis zu seinem Tod 1979 erduldet. Harry Gmür war ein brillanter Schriftsteller, ein kluger politischer Analytiker und seit den frühen 1940er-Jahren ein prinzipientreuer Kommunist. Die Reportagen von links sind Zeitdokumente von höchster Wichtigkeit und Aktualität. Die Herrschaftsklassen der Schweiz werden mit ihrer historischen Verantwortung konfrontiert. Harry Gmür hat den Kampf für Gerechtigkeit, Transparenz und Wahrheit nie aufgegeben. Eine wahrscheinlich entscheidend wichtige Rolle dabei spielte zeitlebens seine Gattin Gena, die mit kritischer Intelligenz sein Schaffen begleitete und die Familie vor den schlimmsten Verfolgungen schützte.
»Seul est libre qui use de sa liberté« (»Frei ist nur, wer seine Freiheit nutzt«), sagt Voltaire. Harry Gmür war zeit seines Lebens ein freier, radikal unabhängiger Geist.
Nikolai Bucharin, der junge Bolschewik, der Lenin am nächsten stand, schreibt: »Die Demokratie ist die Staatsform des Bürgertums, wenn es nicht Angst hat, die Diktatur, wenn es Angst hat.«
Jahre vor der Machtergreifung wurde Adolf Hitler von der Familie Wille und anderen Großaktionären der Schweizerischen Kreditanstalt (später Crédit Suisse) in Zürich empfangen. Niklaus Meienberg hat die frühzeitige finanzielle Unterstützung der Nazi-Monster durch helvetische Kapitalisten dokumentiert. Die schweizerischen Herrschaftsklassen und der Bundesrat näherten sich im Verlauf der späten 1930er-Jahre immer deutlicher den Achsenmächten an. Ein Gräuel für Harry Gmür! Die faschistischen Sympathien des Bundesrates zeigten sich besonders deutlich in zwei Momenten:
Das erste Moment: Im Spanischen Bürgerkrieg standen die Sympathien des Bundesrates eindeutig aufseiten der aufständischen Faschisten. Über 800 junge Schweizer, meist Angestellte und Arbeiter, kämpften in den internationalen Brigaden für die Verteidigung der Republik. Bei ihrer Rückkehr in die Schweiz wurden viele der Überlebenden zu teils schweren Gefängnisstrafen verurteilt wegen »Dienst in fremden Armeen«. Schweizerische Angehörige der Waffen-SS wurden dagegen kaum belangt. Erst 25 Jahre nach Gmürs Tod wurde dieser Skandal gesühnt. Die parlamentarische Initiative des damaligen Nationalrates (heute Ständerat) Paul Rechsteiner von 2009 zwang den Bundesrat per Gesetz, die Unrechtsurteile aufzuheben.
Das zweite Moment: Außenminister Giuseppe Motta war ein Verehrer von Benito Mussolini. Nach dem italienischen Gasangriff auf Addis Abeba 1936 und den nachfolgenden Massakern in Wollo und Tigrinya weigerte sich die Schweiz, an den in der Charta des Völkerbundes festgelegten Wirtschaftssanktionen gegen den Aggressor teilzunehmen. Gmür schreibt: »Dem Vorwurf, die Schweiz habe durch ihren Abfall von der Kollektiv-Sicherheit die Geschäfte der faschistischen Kriegstreiber besorgt, wird demnach die Berechtigung nicht abzusprechen sein.«
Bereits im Krieg trat Gmür der verbotenen kommunistischen Untergrund-Partei bei und wurde daher aus der Sozialdemokratischen Partei, die er im Gemeinderat Zürich seit Frühjahr 1942 vertrat, im November 1942 ausgeschlossen. 1944 gehörte er zu den Gründern der Schweizerischen Partei der Arbeit, wurde deren Vizepräsident und Chefredaktor des Parteiblattes Vorwärts.
Im zweiten Band seiner »Histoire du mouvement communiste suisse« trennt der Historiker André Rauber das öffentliche Leben Gmürs in zwei Teile: die Kämpfe in der Schweiz vor und während des Zweiten Weltkrieges und das Wirken nach dem Krieg, vor allem in der DDR als Schriftsteller, Journalist und Kommentator (unter verschiedenen Pseudonymen) in der Weltbühne, der dominierenden kulturellen und intellektuellen Zeitschrift der DDR. Viele dieser großen, geistvollen Reportagen in der Weltbühne sind den Befreiungskämpfen in Afrika gewidmet. In den späten 1950er- und 1960er-Jahren befreiten sich die meisten der heute 54 souveränen Staaten des Kontinents vom kolonialen Joch. Von bewaffneten nationalen Befreiungsbewegungen, den sozialen Widerstands- und Massenbewegungen, ihren Führern und ihren Ideologien hatte die damalige europäische Öffentlichkeit kaum eine Ahnung. Die DDR war die große Ausnahme. Sie bildete Hunderte afrikanischer Kader aus, half mit Waffen und diplomatischer Unterstützung den aufständischen Völkern, insbesondere in der Sahelzone und in Zentralafrika. Die Reportagen (Interviews, Porträts) Gmürs spielten dabei eine wichtige Rolle. Insbesondere die Reportagen über Julius Nyerere und den tansanischen Befreiungskampf, über Kenneth Kaunda und den Kampf in Nordrhodesien (heute Sambia), über Sékou Touré in Guinea und Kwame Nkrumah in Ghana, dem 1957 ersten befreiten Staat in Schwarz-Afrika.
In Leipzig, wo Harry Gmür 1933 doktoriert hatte (Thema der Dissertation: »Thomas von Aquino und der Krieg«), existierte damals eine in Europa einzigartige Institution: das Afrika-Institut der Karl-Marx-Universität. Dort entstand die kohärente anti-imperialistische Theorie, die fortan als Basis diente für die aktive Solidaritätspolitik der DDR mit den Befreiungsbewegungen und neu entstandenen afrikanischen Staaten. Der Leiter des Institutes war der bedeutende Historiker Walter Markov. Sein wohl einflussreichstes Werk trägt den Titel: »Zur universalgeschichtlichen Einordnung des Afrikanischen Befreiungskampfes« (Leipzig 1961). Markov beriet die DDR-Regierung in ihrer aktiven solidarischen Afrika-Politik. Sein Oberassistent, mein Freund, der Soziologe Klaus Ernst, wurde Botschafter in Mali. Als Berater von Modibo Keita, Staatschef in Bamako und 1963 Mitbegründer der Organisation der Afrikanischen Einheit, übernahmen Ernst und Markov eine bedeutsame Rolle in der Definition der afrikanischen Souveränitätsstrategie.
Die informativen, klugen, literarisch eleganten Reportagen Gmürs trugen viel zum empirischen Wissen der Forscher des Afrika-Instituts bei. Das weiß ich dank der persönlichen Begegnung mit mehreren der einst in Leipzig tätigen Anthropologen, Historiker und Soziologen jener Zeit (seit der Wiedervereinigung ist das Institut »abgewickelt«, das heißt zerstört, liquidiert).
»Man kennt die Früchte nicht der Bäume, die man pflanzt«, heißt ein Sprichwort des uralten Bauernvolkes der Wolof im Senegal.
Dissidenten sind selten erfolgreich. Oberflächlich gesehen, enden fast alle in der Niederlage. Peter Surava und Carl Albert Loosli haben ein Leben lang gegen das helvetische Kollektiv-Verbrechen der Verdingkinder gekämpft. Zehntausende Kinder aus ärmsten Familien wurden an Bauern «verdingt». Sie wurden ausgebeutet, gequält, missbraucht und misshandelt in katholischen Waisenhäusern und staatlichen Zwangserziehungsanstalten. Die Kinder waren wehrlos. Sie litten oftmals die Hölle. Das staatlich sanktionierte Verbrechen endete erst 1981, viele Jahre nach dem Tod von Loosli und Surava. Eine scheinbare Niederlage erlitt auch Harry Gmür. Die objektive Allianz mit Walter Markov und seinen Kollegen zerbrach, als Markov wegen »Titoismus« verhaftet wurde. Unter den Nazis hatte er zwölf Jahre im Zuchthaus Bautzen gesessen. Jetzt kerkerten ihn die dumpfen Häscher der Stasi ein.
1944 hatte Gmür mit heller Begeisterung in der Schweiz die PDA mitgegründet. Heute ist die PDA – obschon ihr noch einige ehrenwerte Frauen und Männer angehören – eine bedeutungslose Sekte. Keine Spur mehr von der schweizweiten, demokratischen und sozialistischen Massenbewegung, die sich Harry Gmür erträumt hatte. Auch den Vorwärts gibt es noch, dessen erster Chefredaktor und Chefideologe Gmür einst war. Seine politische Bedeutung ist heute gleich null. Der Betonkonsens zwischen Finanzoligarchie, bürgerlichen Partei-Apparaten und residueller Sozialdemokratie hat unser Volk fest im Griff. Jedoch alle diese augenscheinlichen, individuellen Niederlagen der Dissidenten verstellen den Blick auf die wirkliche Wirklichkeit.
Im Talmud von Babylon steht der mysteriöse Satz: »Die Zukunft hat eine lange Vergangenheit.« Ohne ein von Mythen und Lügen befreites Kollektiv-Gedächtnis gibt es keine ertragbare Zukunft, für kein Land. In der Erfassung und Erhaltung dieses Kollektiv-Gedächtnisses erfüllen die Dissidenten eine entscheidende Aufgabe. Sie sind die Ehre der Schweiz, der Atem der Demokratie. Harry Gmür schulden wir tiefe Dankbarkeit und Bewunderung. Dr. Mario Gmür und dem Europa-Verlag gebührt Dank für die Herausgabe dieses eindrucksvollen Buches.
Jean Ziegler
1.Die große Illusion
Vorbemerkung der Redaktion: Der nachstehende Artikel wurde zwei Wochen vor der Abstimmung über das Finanznotrecht geschrieben. Er verliert aber auch nach dem 27. November 1938 nichts von seiner Aktualität.
Am 27. November hat das Schweizervolk über die Gestaltung der Bundesfinanzen während der kommenden drei Jahre zu entscheiden. Die Befürworter der parlamentarischen Vorlage nennen sie einen Kompromiss, bei dem der Linken bedeutende Zugeständnisse gemacht worden seien. Sie verweisen dabei auf die Bestimmung, wonach die Bundesversammlung jährlich die Möglichkeit zu prüfen hat, den Lohnabbau für das eidgenössische Personal zu mildern. Dabei verschweigen sie, dass von den Bürgerblock-Parlamentariern wohl kein halbes Dutzend daran denkt, jene Möglichkeit zu bejahen, solange der Bundeshaushalt das vorgesehene 77-Millionen-Defizit aufweist! Man streicht ferner die 18 Millionen heraus, die künftig bedürftige Witwen, Waisen und Greise erhalten sollen. Man vergisst aber meist hinzuzufügen, dass der Bund nach Recht und Verfassung verpflichtet ist, jährlich rund 43 Millionen in den Fonds für die Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung zu legen, sodass er unsere Senioren immer noch um 25 Millionen bringt. Von den übrigen direkten und indirekten Lasten, die nun auch die Ärmsten freiwillig auf sich nehmen sollen, nachdem sie bisher gezwungen unter ihnen gelitten haben, ist natürlich schon gar nicht mehr die Rede: von den 90 Millionen beispielsweise, um die man die Subventionen für Volksschulen, Krankenkassen, die Tuberkulosebekämpfung usw. gekürzt hat; von den seit 1933 erhöhten Steuern und Zöllen auf Tabak, Getränke, Zucker, Benzin, Fette und Öle; von den auf lebenswichtigen Massenartikeln liegenden Zollabgaben überhaupt, die seit Jahren dazu beitragen, die Not so mancher Familie zu erschweren. Die Besinnung auf alle diese Einzelheiten müsste denn doch viele zu der Überlegung führen, der »Kompromiss« enthalte bedenkliche Härten für jenen Volksteil, der infolge seiner wirtschaftlichen Lage ohnehin Gefahr läuft, an unserer Demokratie zu verzweifeln!
Die ganze Ungeheuerlichkeit des »Verständigungswerkes« aber tritt erst zutage, wenn man jene Härten mit den Leistungen vergleicht, vor denen sich das Großkapital zu drücken verstand. Wenn man sich erinnert an die 18 Milliarden, die die Begüterten nicht versteuern, und an den erbitterten und erfolgreichen Widerstand, den ihre politischen Sachwalter dem Versuch entgegensetzten, durch die Erhebung der Kapitalertragssteuer an der Quelle wenigstens einen Teil dieser wirklich großzügigen Unterschlagung zu verhindern. Unser Jahrzehnt stellt gewaltige Anforderungen an jeden Demokraten. Die Hunderttausende, die bereit sind, mit ihrem Leben für die Freiheit einzustehen – sie würden, wenn es sein müsste, auch größere materielle Lasten als die gegenwärtig geforderten zu ertragen wissen. Aber dem Volke zuzumuten, am Nötigsten zu sparen, nur damit eine Handvoll Glücksritter unserer Gesellschaft sich ungestörter ihrer Millionen erfreuen und die Staatskasse um die von ihnen selbst bewilligten Steuern betrügen können – das ist eine Provokation, die kaum geeignet sein dürfte, den Glauben an die in gewissen Regierungsblättern gepredigte Schicksalsverbundenheit sämtlicher Eidgenossen zu stärken. Dass man in den Großbanken von einem noch massiveren Abbau der Löhne und sozialen Ausgaben, von einem Ersatz der Krisensteuer durch eine Kopfsteuer und ähnlichen volkstümlichen Maßnahmen träumt, glauben wir gerne. Doch der Verzicht des Finanzkapitals auf die sofortige Verwirklichung seines Schlaraffenlandes bedeutet noch lange nicht, dass man das unerlässliche Minimum an Rücksicht auf die Lebensansprüche der wirtschaftlich bedrängten Volksschichten genommen hätte. Der dem Volk unterbreitete Finanzartikel stellt im Wesentlichen eine Verlängerung der drei Finanzprogramme von 1933, 1936 und 1937 dar, die von den politischen Organisationen der Linken auch ihres Inhalts wegen heftig bekämpft worden sind. Es liegt auf der Hand, dass die neue Vorlage an und für sich kein besseres Los verdient.
Es ist denn auch nicht Begeisterung für die Missgeburt vom 10. August, die einen Teil der höheren sozialdemokratischen Gewerkschafts- und Angestelltenfunktionäre veranlasst, sich für die Ja-Parole einzusetzen. Der Unabhängigkeit, dem Bestand der Eidgenossenschaft droht schwere Gefahr. Dürfen wir uns da, so fragen die extremen Verständigungsfreunde, den Luxus innerer Partei- und Klassenkämpfe leisten? Tut nicht Einigkeit not, Einigkeit aller Eidgenossen von den Arbeitslosen bis zu den Bank- und Industriebaronen, zur gemeinsamen Verteidigung unserer gemeinsamen Freiheit? Und ist es nicht richtig, der Einigung jedes, auch das größte Opfer zu bringen?
2.Die Schweiz nach der tschechischen Katastrophe
Nach dem von Pierre Bernus im Journal des débats der Öffentlichkeit bekannt gegebenen, von Henri de Kerillis in der Epoque und neuerdings auch von den Neuen Zürcher Nachrichten bestätigten, dabei von keiner französischen oder britischen Amtsstelle dementierten deutschen Plan hätte neben Holland höchstwahrscheinlich auch die Schweiz im März von deutschen Truppen besetzt und als Pfand gegen die Westmächte verwendet werden sollen. Die Reaktion in Paris und London und vor allem die drohende Rede Roosevelts, der von den deutschen Absichten Kenntnis erhalten hatte, scheinen Berlin und Rom zunächst von dem gefährlichen Unternehmen abgeschreckt zu haben. Man erkannte offenbar, wie ungewiss die Aussicht war, die Demokratien auf diese Weise zur Kapitulation zu zwingen. Und um einen bewaffneten Konflikt ins Auge fassen zu können, bei dem mit einem Eingreifen nicht nur der Vereinigten Staaten, sondern auch Polens und der Sowjetunion gerechnet werden musste, reichten weder die militärische Rüstung noch die wirtschaftlichen Kräfte der Achse aus.
Es liegt nahe, den feigen Gewaltstreich gegen die Tschechoslowakei mit dem Bedürfnis der Achsenmächte zu erklären, ihre materielle Basis für die bevorstehende Auseinandersetzung mit dem Westen zu stärken. Dieses Ziel hat Hitler jedenfalls erreicht: Die mit französischem Geld bezahlte hervorragende Ausrüstung der tschechoslowakischen Armee steht heute der deutschen Wehrmacht zur Verfügung, die gewaltigen Skoda-Werke und die übrigen 37 Kriegsmaterial-Fabriken des gestohlenen Landes arbeiten für das Reich. Ein Teil des tschechischen Goldes und der Auslandsguthaben der tschechischen Bürger, die tschechischen Rohstoffvorkommen, die bedeutende tschechoslowakische Agrarproduktion und die brachliegenden Arbeitskräfte Böhmens und Mährens erlauben der ausgepumpten deutschen Kriegswirtschaft, ein paar Monate länger auf Hochtouren zu laufen, und zwischen den im Kriegsfall für Deutschland lebenswichtigen rumänischen Ölfeldern und den deutschen Truppen steht wenigstens vorläufig keine Armee von Bedeutung mehr. Damit sind die Gründe, warum die Achse dem offenen Konflikt mit Frankreich und England aus dem Wege ging, zum guten Teil beseitigt, so weit vielleicht, wie sie überhaupt ohne eine entscheidende Machtprobe mit den großen Gegenspielern zu beseitigen sind. Noch wissen wir nicht, welcher besondere Raubplan der Diktatoren zu der nächsten internationalen Hochspannung führen wird. Aber in jedem Falle müssen wir uns darauf gefasst machen, dass die Schonfrist der Schweiz binnen Kurzem abläuft, dass wir wieder in unmittelbare Nähe der Gefahrenzone geraten sind.
Andererseits dürfte das Verbrechen vom 15. März in einer Hinsicht die Lage unseres Landes verbessert haben. Wir stehen entschieden auf dem Standpunkt, die Schweiz habe sich unter allen Umständen gegen einen feindlichen Überfall zur Wehr zu setzen, selbst dann, wenn sie keine Hilfe von außen erwarten kann. Welch unermesslichen Vorteil diese Hilfe bedeuten würde, müssen wir indessen nicht erwähnen. An sich hat jeder unserer Nachbarstaaten ein beträchtliches strategisches Interesse, die Eidgenossenschaft nicht in die Hand einer anderen Großmacht fallen zu lassen. Wir hielten es deshalb früher für ziemlich selbstverständlich, dass jede Verletzung unserer Neutralität automatisch einen europäischen Krieg auslösen würde. Diese Überzeugung wurde im vergangenen Herbst durch Frankreichs Verrat an dem tschechoslowakischen Bundesgenossen vollkommen erschüttert. Gewiss liegt die Festung Böhmen im Gegensatz zur Schweiz fernab von der französischen Grenze. Aber diese von vierzig Divisionen gehaltene Festung hätte im Kriege einen großen Teil der deutschen Streitkräfte im Osten gebunden und obendrein den Zugang des Reiches zu den wirtschaftlichen Reichtümern des Balkans bedroht. Frankreich besaß kein geringeres militärisches Interesse an dieser Position als an der Unabhängigkeit unseres Landes, und wenn es jene kampflos preisgab, so war nicht einzusehen, weshalb es sich unseretwegen schlagen sollte. Die Nachricht, die französischen Behörden hätten nach dem Bekanntwerden des deutschen Angriffsprojekts von England verlangt, dass es – wie Frankreich selbst – eine Invasion der Schweiz als Casus Belli betrachte, kam daher ziemlich überraschend. An ihrer Echtheit ist jedoch so wenig wie an den übrigen Meldungen Bernus’ und Kerillis’ zu rütteln. Eduard Behrens wusste in der SZ am Sonntag vom 19. März sogar zu berichten, das Bundeshaus sei davon unterrichtet, »dass Frankreich und England der Schweiz gegen jeden Angriff, dem sie selbst mit der letzten Entschlossenheit begegnet, mit ihrer ganzen Kriegsmacht beispringen werden«.
Die Chancen aber, dass dies Versprechen auch gehalten würde, dürften durch die Vergewaltigung der tschechischen Nation noch gestiegen sein. Denn nach der bisherigen Reaktion in Frankreich und vor allem in England zu schließen, scheint die Schandtat der Nazis sogar die Schuldigen von München wenigstens für den Augenblick zu einer energischeren Haltung veranlasst zu haben. Wäre Hitler nach Prag spaziert, als man sich in London und Paris noch schmunzelnd der Illusion erfreute, er rüste direkt zum Feldzug nach der Ukraine, und als man am Quai d‘Orsay die Liquidierung des polnischen Bündnisses und des Russenpakts in Erwägung zog, die Chamberlain und Daladier hätten gerade so weit in Entrüstung gemacht, wie es die Rücksicht auf die Stimmung der eigenen Wähler geboten hätte, und sich selbst und vor allem dem deutschen Diktator bestimmt keine weiteren Sorgen bereitet. Nach der Eröffnung der italienisch deutschen Kolonialkampagne, nach der geflissentlichen Schonung sowohl Polens wie Sowjetrusslands durch die Berliner Machthaber, und nun gar nach dem (provisorischen) Desinteresse des Reichs an der »Karpatho-Ukraine« ist allzu durchsichtig, dass Hitlers Raubzüge, auch wenn er sie im Osten des Reiches unternimmt, eine unmittelbare Bedrohung der Westmächte darstellen. In diesem Zusammenhang gesehen, zerstören natürlich die Brutalität des deutschen Vorgehens, die Schamlosigkeit, mit der Hitler sich über seine feierlichsten Versprechungen hinwegsetzt, und das offene Fallenlassen der Selbstbestimmungsrechtstheorie zugunsten des imperialen, das heißt letzten Endes Weltherrschaftsgedankens die Illusion, die Demokratien könnten mit diesem Partner auf der Grundlage weiterer Eingeständnisse zu der erstrebten ehrlichen und dauerhaften Verständigung gelangen. In London und Paris kann auch der Verstockteste sich nur noch mit Mühe der Einsicht verschließen, dass jede Konzession an das gegenwärtige Reich, selbst wenn sie auf Kosten kleiner Völker erfolgt, nicht etwa einen Hungernden befriedigt, sondern einen Todfeind noch begehrlicher, noch unverschämter und rücksichtsloser macht. Wir dürfen glauben, dass man vor allem in Frankreich nicht geneigt ist, dass sich die Deutschen auf unseren Jurahöhen festsetzen.
Das Gespenst unserer Isolierung scheint also wahrhaftig entschwunden zu sein. Und dass das Land im kritischen Augenblick – nach österreichisch-tschechoslowakischem Muster – von der eigenen Regierung ausgeliefert werden könnte, scheint gar nicht mehr zur Diskussion zu stehen. Bereits vor einigen Wochen wies Bundesrat Minger derartige Verdächtigungen als schwer beleidigend zurück. Und am 16. März tat Bundesrat Obrecht in Basel jenen befreiend scharfen Ausspruch: »Man muss es im Ausland wissen: Dem, der uns angreift und unsere Unabhängigkeit und Unversehrtheit verletzen will, wartet der Krieg. Es wird in der Schweiz nicht vorkommen, dass wir zuerst ins Ausland wallfahrten geh’n.«
Brauchen wir uns da über das Schicksal unserer Heimat noch Sorgen zu machen? Können wir uns nicht hundertprozentig auf die Landesväter und auf die treuen Freunde im Ausland verlassen? Und dürfen wir nicht ruhigen Gewissens auf die Mahnung der Neuen Zürcher Nachrichten hören: »Die das Vertrauen in die oberste Landesbehörde und die Bundesinstanzen untergrabende Politik muss aufhören. Wer sie nicht lassen kann, ist ein Feind des Landes und ein Landesverräter«?
Es wäre zu schön, wenn wir diese Fragen kurzerhand bejahen könnten. Doch ist nüchternes Abwägen auch hier unsere Pflicht, selbst wenn wir dabei zu der Erkenntnis kommen sollten: Die besten Absichten der befreundeten Großmächte wie der eigenen Regierung, so erfreuliche Perspektiven sie eröffnen mögen, bieten keine volle Gewähr für ein entsprechendes Handeln.
Verlass auf Frankreich und Großbritannien? Bedenken wir immerhin: Die Motive, die zur Erfindung des Münchener Abkommens geführt haben, sind keineswegs aus der Welt verschwunden, obwohl die Schattenseiten dieses Verfahrens inzwischen deutlicher geworden sind. Nach wie vor zittert der Großteil der herrschenden Klasse in den kapitalistischen Demokratien vor den Folgen eines Sieges – und gar eines gemeinsam mit der Sowjetunion errungenen Sieges! – über die faschistischen Staaten. Und trotz der beispiellosen Blamage, die sie erlitten haben, sind es unglaublicherweise immer noch die »Munichois«, ein Chamberlain, ein Halifax, ein Daladier und selbst der anrüchige Georges Bonnet, die in London und Paris am Ruder sind. Dabei hat der britische Premierminister nach dem deutschen Einbruch in Böhmen und bevor ihn die öffentliche Meinung Englands zu seiner aggressiven Birminghamer Rede trieb, im Unterhaus eine Erklärung abgegeben, in der er nichts anderes als eine Fortführung seiner glorreichen »Befriedungs«-Bestrebungen in Aussicht stellte. Wenn Hitler morgen diesen Leuten einen Strohhalm hinhält, so dürften sie sich allerdings resigniert dafür bedanken. Aber wenn er es mit einer Bohnenstange versucht, mag sie noch so faul und brüchig sein, werden sie in ihrem peinlichen Dilemma nicht wirklich versuchen, sich daran festzuklammern? Wenn er ihnen noch heiliger als in der Vergangenheit schwört, die Grenze seiner Wünsche liege an diesem Fluss oder auf jenem Gebirgskamm, werden sie nicht – gegen das Äußerste durch die eigenen Rüstungen und bald vielleicht durch die formelle Zusicherung sowjetrussischer Hilfe geschützt – den Diktator ein letztes und nochmals ein letztes und schließlich ein allerletztes Mal auf die Probe stellen? Die Taktik der verschärften Kriegsdrohung, zu der Großbritannien – spät genug – überzugehen gesonnen scheint, um die Angreifer vor weiteren Übergriffen abzuschrecken, bedeutet durchaus nicht notwendigerweise, dass man die Drohung auch wahr machen würde, wenn sie ihren eigentlichen Zweck verfehlte. Dabei dürfen wir vor allem nicht übersehen, dass das britische Beistandsversprechen für die Schweiz nur als Gegenleistung für das französische Beistandsversprechen für Holland gegeben wurde, dessen Besetzung durch die deutsche Armee einer direkten Bedrohung Englands gleichkommen würde. Sollte Deutschland einmal unser Land überfallen und dabei die Niederlande aus dem Spiel lassen, so könnte keine Macht der Welt die Engländer daran hindern, in Paris massiv vor »überstürzten«, »nicht wieder gutzumachenden« Schritten zu warnen und die »Hilfsaktion« auf die bewährten diplomatischen Geleise abzudrängen.
Diese Politik würde zweifellos eines Tages dem britischen Weltreich zum Verhängnis werden; es wird ihren Verfechtern immer schwerer fallen, sie gegen die wachsende Opposition in Frankreich und England selbst durchzusetzen, und es ist uns erlaubt zu hoffen, dass sie ihre Handlungsfreiheit nicht nur in diesen Wochen der ersten Erregung über den neuen deutschen Gewaltstreich, sondern überhaupt verloren haben. Trotzdem wäre es unverantwortlicher Leichtsinn, uns auf die Hilfe notorisch verräterischer Elemente verlassen zu wollen. Eine Nachahmung der Prager Regierung, die ihr Verhalten vom Entscheid der Franzosen abhängig machte, könnte leicht auch für uns den glatten Selbstmord bedeuten. Wir müssen nach wie vor, wenn es nicht anders geht, auch dazu entschlossen sein, allein zu kämpfen.
Wird aber der Bundesrat unter allen Umständen seine Pflicht erfüllen? Nichts liegt uns ferner, als die Ehrlichkeit der Erklärungen Mingers und Obrechts in Zweifel zu ziehen. Aber wir können die Tatsache nicht einfach übersehen, dass auch bei uns die »Munichois« seelenruhig weiterregieren. »Münchener« – das sind die Herren nicht nur deswegen, weil Giuseppe Motta seinerzeit in jener im Lichte des 15. März zehnfach lächerlich gewordenen Luganeser Rede die vier »Friedensengel« anschwärmte und das Münchener Schandwerk mit einem Stern verglich, »der die Schatten der Nacht durchbricht und das nahende (inzwischen so herrlich aufgegangene!) Licht des Morgens verkündet« – wozu immerhin zu sagen wäre, dass dem Prestige des Landes mit einem Außenminister nicht gerade gedient ist, der öffentlich solch ungeheuren Unsinn zum Besten gibt. »Münchener«, so nennen wir sie auch, weil sie sich wie Chamberlain und Bonnet seit Jahren weigern, das Schwarze schwarz, das Giftige giftig zu nennen, und weil auch sie eine Politik der schrittweisen Anpassung an die deutsch-italienischen Wünsche statt einer konsequenten Landesverteidigung betrieben haben. Die schönsten Reden der Bundesräte können uns ihre achsenfromme Haltung in der Abessinien-, der Völkerbunds-, der Spanienfrage nicht vergessen lassen; oder die einschränkenden Maßnahmen gegen die Pressefreiheit, das Vereinsrecht, die Versammlungs- und Redefreiheit usw., die uns aus Rücksicht auf die Empfindlichkeit der Diktatoren aufgezwungen worden sind. Die Langmut, mit der Bern dem Treiben der verschiedenen einheimischen Landesverräter-Gruppen zusah, und die Verbissenheit, mit denen Motta und Baumann sich immer wieder schützend vor das gemeingefährliche Treiben der deutschen Nazis in unserem Lande stellten, haben den Glauben an den Widerstandswillen der Verantwortlichen noch viel weniger gestärkt. Und beängstigter als je erinnert man sich heute, wie die Herren, sobald sich jemand erlaubte, vor den hinterhältigen Absichten Deutschlands zu warnen, beschwichtigend mit den völlig belanglosen Sprüchen herumhausierten, mit denen Adolf Hitler vor etwas mehr als zwei Jahren Altbundesrat Schulthess in Berlin unterhielt, oder mit der noch uninteressanteren Erklärung der Reichsregierung an den Bundesrat vom 21. Juni 1938. Dabei ist nicht einmal in diesen allerletzten Wochen eine sichtbare Wendung eingetreten. Als die ganze Welt nach den Veröffentlichungen des Journal des Debats um die Eidgenossenschaft bangte, wusste der Bundesrat nichts Gescheiteres zu tun, als eiligst hinauszuposaunen, Herr Bernus sei offenbar einer »Mystifikation« zum Opfer gefallen. Und nach der Vernichtung der Tschechoslowakei mussten wir von höchster Stelle sofort vernehmen, dieses Ereignis berühre uns nicht unmittelbar.
Das Volk beurteilt seine politischen Führer nun einmal nach ihren Taten und nicht aufgrund von bloßen Versprechungen. Und da darf man sich in Bern wirklich nicht wundern, wenn man überall im Land immer wieder ängstlich fragen hört: Werden die Leute, die die Gefahren niemals rechtzeitig erkennen wollten, nicht auch im entscheidenden Augenblick die Warner in die Wüste schicken und den Kopf in den Sand stecken, bis es zu spät ist? Werden sie nicht fortfahren, Schritt für Schritt vor der deutschen Begehrlichkeit zurückzuweichen, und dabei nicht nur das Volk demoralisieren, sondern schließlich auch jene Grenze überschreiten, nach der sie selbst nicht mehr in der Lage wären, die Einladung zu einer Berliner Visite auszuschlagen? Werden sie, die sich so oft einem verhältnismäßig sanften Druck gebeugt haben, einer schärferen Pression plötzlich eisern widerstehen? Wenn Anzeichen einer unmittelbaren Bedrohung unserer Landesgrenzen sichtbar werden, werden sie es wagen, unverzüglich zu mobilisieren – sie, die uns stets gepredigt haben: nur ja keine Provokation, ja nichts, was Anlass geben könnte, an unserm Willen zur dreimal heiligen Neutralität zu zweifeln? Ja, hätten sie nicht jetzt schon so etwas wie eine »kleine« Grenzbesetzung organisieren müssen, nachdem bekannt ist, was man im Reich gegen uns im Schilde führt? Vor allem, da die französische Regierung es für nötig hält, die Maginotlinie in Betrieb zu setzen? Man fragt sich im Volk noch ganz andere Dinge! Erst vor wenigen Stunden wollte ein ausgewachsener und geistig normaler Zürcher Stimmbürger allen Ernstes von mir wissen, ob es wahr sei, dass Motta sich vor Kurzem geheim in Berlin aufgehalten habe! Dass derart unsinnige Gerüchte überhaupt entstehen können, ist bezeichnend genug für das in weiten Kreisen verbreitete Misstrauen. Und wir können mit dem besten Willen nicht behaupten, dass dieses Misstrauen völlig unberechtigt sei.
Freilich haben es die Herren Bundesräte selbst in der Hand, die Reinheit ihrer nationalen Gesinnung unter Beweis zu stellen. Der Bundespräsident sprach im Radio von der »ruhigen Sicherheit«, mit der wir angeblich alle den weltgeschichtlichen Ereignissen gegenüberstehen. Es ist klar, dass die Zweifel an der Festigkeit des Bundesrates diese »ruhige Sicherheit« schwer beeinträchtigen müssen. Es gibt aber einen Weg – einen einzigen allerdings –, den Zweifel unverzüglich aus der Welt zu schaffen: Der Bundesrat, oder wenigstens seine am meisten kompromittierten Mitglieder, mögen demissionieren, um die Bildung einer zu kompromisslosem Widerstand entschlossenen, sich auf alle Volkskräfte stützenden Regierung der nationalen Verteidigung zu gestatten! Sind die Herren zu dieser patriotischen Tat nicht fähig, so rechtfertigen sie damit allein schon unsere Überzeugung: dass die Stunde nicht blinden Glauben an irgendwelche Behörden von uns fordert, dass im Gegenteil nur in der äußersten Wachsamkeit des Volkes selbst, in seiner Bereitschaft, im Notfall einen schwankenden Bundesrat mit allen Mitteln zum Widerstand zu zwingen, und in seinem Willen zum Kampf für die Neugestaltung der Exekutive eine wirkliche Garantie für die unbedingte Verteidigung unserer Freiheit liegt.
Ja, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass sich das regierende Großbürgertum ohne Vorbehalt und bis zum Ende für die Freiheit einsetzen würde! Wenn wir annehmen dürften, dass wir es mit zuverlässigen Bundesgenossen zu tun haben, und nicht mit Leuten, die sich früher oder später – mag sein, für manchen zu seiner eigenen Überraschung – als Verräter entlarven – oder gar schon heute als Verräter wirksam sind! Wir fürchten sehr, jene Demokraten, die sich einbilden, unser freies Land könne in Zusammenarbeit mit der herrschenden Klasse, ja unter ihrer Führung gerettet werden, sind die Gefangenen einer großen Illusion, die leider nicht nur ihnen, sondern auch der demokratischen Sache verhängnisvoll zu werden droht.
Das größte Unheil, das die Schweiz treffen könnte, wäre das Entstehen einer größeren faschistischen, mit einem faschistischen Nachbarstaat sympathisierenden und von diesem protegierten Massenbewegung. Eine derartige Bewegung hat Hitler erst Gelegenheit gegeben, in Spanien, in Österreich (trotz der Illegalität der NSDAP!), in der Tschechoslowakei zu intervenieren. Den besten Nährboden für die faschistisch-nationalsozialistische Demagogie schafft wirtschaftliche Not. In der Tschechoslowakei hat die Bourgeoisie trotz ihres fanatischen Patriotismus – und trotz sozialdemokratischer Regierungsbeteiligung! – es nicht fertiggebracht, mit dem wahrhaft staatsgefährlichen Krisenelend in den Sudetengebieten zur rechten Zeit und gehörig aufzuräumen. Sie ist insofern durchaus für den Erfolg der Henlein-Partei mit seinen katastrophalen Folgen verantwortlich zu machen.
Hat sich das schweizerische Bürgertum hier besser bewährt, oder ist es wenigstens entschlossen, das Hinausgeschobene nachzuholen? In den Wochen nach dem österreichischen Zusammenbruch, da hätte man es beinahe glauben können. »In engster Verbindung mit dieser einen Hauptforderung der Gegenwart« – der Mittelbeschaffung für die militärische Landesverteidigung nämlich – »steht die andere: Arbeit zu beschaffen, damit auch der letzte Schweizer spürt, dass er ein Vaterland und eine Heimat hat.« So schrieb nicht etwa die kommunistische Freiheit, sondern der Bundesstadt-Redaktor der NZZ anlässlich des schweizerischen freisinnigen Parteikongresses vom 28./29. Mai. Und das bundesrätliche 400-Millionen-Projekt schien immerhin die Hoffnung zu rechtfertigen, dass es nicht bei bloßen Worten bleiben würde.
Aber wo stehen wir heute? Endlose Kommissionsberatungen haben zu einer immer weiteren Verschleppung des Termins geführt, zu dem die dringlichen Maßnahmen verwirklicht werden können. Auf der Rechten macht sich die Tendenz geltend, die Rüstungskredite und die Kredite für die zivile Arbeitsbeschaffung getrennt zu behandeln, natürlich um den zweiten Teil des Gesamtwerks zu bekämpfen. Wir müssen darauf gefasst sein, dass die Ständekammer, die ja erst nach dem 27. November auf die Vorlage eintritt, versuchen wird, diesen Bestrebungen irgendwie entgegenzukommen. Und schließlich droht die hartnäckige Weigerung des Bundesrates und seines Anhangs, auf die Verkoppelung der Arbeitsbeschaffung mit einer reaktionären Umsatzsteuer zu verzichten, das ganze Projekt in der Volksabstimmung zu Fall zu bringen.
Dies alles ist umso schlimmer, als auch die infrage gestellten 395 Millionen bei Weitem nicht genügen, um das Arbeitslosenproblem befriedigend zu lösen, was man allzu oft übersehen hat. Die Arbeitslosigkeit muss verschwinden. Der Bürger, dem der Staat vielleicht das schwerste Solidaritätsopfer abverlangen wird, muss die Gewissheit erhalten, dass das Gemeinwesen Gegenrecht hält, dass es zum Mindesten keines seiner Glieder ohne halbwegs auskömmliche Beschäftigung darben und verkümmern lässt. Weniger kann eine Demokratie heutzutage unmöglich bieten, wenn sie sich nicht selbst das Grab schaufeln will.
Nun erlauben aber die 395 Millionen, auf drei Jahre verteilt, nicht sehr viel mehr als die Fortführung der schon heute getätigten Arbeitsbeschaffung. Der 90-Millionen-Kredit für Bundesbeiträge an die Arbeitsbeschaffung in den Kantonen wird in der bundesrätlichen Botschaft vom 7. Juni ausdrücklich unter der Rubrik »Fortsetzung der bisherigen Arbeitsbeschaffungsaktion« verzeichnet. Ferner sind 85 Prozent der Wehranleihe, das heißt 285 Millionen Franken in den Jahren 1936, 1937 und 1938 für Rüstungsaufträge in der Schweiz verwendet worden. Diese beiden Beträge allein kommen dem neuen Kredit schon bis auf 20 Millionen nahe! Nicht umsonst hat der Bundesrat in der erwähnten Botschaft, wenn auch vorsichtig, bereits vor Illusionen gewarnt. »Eine Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes zwischen Angebot und Nachfrage der Arbeitskraft ist nirgends erreicht worden«, heißt es da. »Sie kann durch staatliche Zwangs- oder Hilfsmaßnahmen auch gar nicht ausreichend gefunden werden …« Oder: »Trotzdem wird es nicht möglich sein, alle Beschäftigungslosen aus den Gruppen der Bau- und Holzarbeiter, der Handlanger und Tagelöhner restlos wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern.«
Trotz der blendenden Millionenzahl hatten wir es also von Anfang an mit Stückwerk zu tun, und zwar von jener Sorte, derer sogar das geduldige Schweizervolk allmählich überdrüssig geworden ist. Prominente Linkspolitiker haben wiederholt erklärt, ihre definitive Stellungnahme zum Finanzartikel würde letzten Endes von der Haltung der Bürgerparteien in der Arbeitsbeschaffungsfrage abhängen. Im Grunde genommen ist diese Bedingung unverständlich, falls es sich dabei nicht um mehr handelte als um das bundesrätliche Arbeitsbeschaffungsprogramm. Denn eine Klasse, die in dieser fundamentalen Landesfrage zwar mit großen Worten und geschickt zusammengezogenen Ziffern blufft, in der Tat aber an eine durchgreifende Lösung gar nicht denkt, hat auch dann ihre Unfähigkeit zur Wahrung der nationalen lnteressen bewiesen, wenn sie es schließlich über sich bringen sollte, auf einen Abbau der bisherigen Leistungen – denn die stehen auf dem Spiele – zu verzichten.
Und auch dann, wenn man gar nicht in Betracht zieht, wie gründlich sie den kleinen Schuldenbauern und dem bedrängten Mittelstand gegenüber versagt! Wenn man nun wenigstens sagen könnte, das Großbürgertum stelle überall da seinen Mann, wo die Mächte der Unfreiheit von außen her versuchen, unser Land zu unterminieren und Schritt für Schritt zur Preisgabe seiner Unabhängigkeit zu zwingen! Wenn es hier sich unerbittlich entschlossen zeigte zum Widerstand! Aber hier ist die Bilanz erst recht katastrophal.
Hat man denn all das Erbärmliche schon vergessen, das sich das Regime Motta-Baumann allein seit dem Untergang Österreichs geleistet hat? Man erinnere sich – wir können in diesem Rahmen nicht mehr als Hinweise geben – an den verbissenen Eifer, mit dem der Bundesrat, sekundiert von seiner Presse und den tapferen bürgerlichen Parteimenschen von Baselstadt, sich bei jeder Gelegenheit, ja selbst ohne Gelegenheit für die Unantastbarkeit der reichsdeutschen Naziorganisationen auf Schweizerboden eingesetzt hat; an die Wiederzulassung einer besonderen Zeitung für die unser Gastrecht genießenden, von »draußen« stammenden Feinde der Demokratie; an die vollkommene Freiheit, mit der Herr Goebbels seine Presse, seine Filme, seine »neutralen« Rundfunksendungen (durch Vermittlung des schweizerischen Telefonrundspruchs und der Rediffusion) dank bundesrätlicher Protektion in der ganzen Schweiz verbreiten darf, während unsere Landsleute im Dritten Reich nach wie vor nicht in der Lage sind, eine nicht faschistische Schweizer Zeitung zu lesen; an den Verzicht auf die Bestrafung des Landesverräters Garobhio und der Nazi-Spione Engel und Meran.
Man vergleiche diese Politik der offenen Tür für die lieben Nachbarn im Norden und Süden mit der Politik des Maulkorbs für die helvetischen Untertanen, wie sie etwa zur Geltung kam in den Versuchen, die Schweizerpresse – mit Rücksicht auf unsere Neutralität! – zu einer »objektiven« Auslandsberichterstattung zu veranlassen; im Verbot des Journal des Nations, dem ursprünglich das Verbot von drei sozialdemokratischen Blättern folgen sollte; in der Unterdrückung des von Wylschen Deutschlandbuches und der Broschüre »Das Hakenkreuz droht«; in der Maßregelung des St. Galler Stadtpfarrers Jakobus Weidenmann durch die Bupo wegen eines offenherzigen Privatbriefs, den der Geistliche nach Deutschland geschrieben hatte; in der Streichung statistischer Zahlen über die Lage der deutschen Bauern aus einem Radiovortrag durch die Programmleitung der schweizerischen Radiogesellschaft aus Furcht vor einer Intervention der deutschen Gesandtschaft usw.
Und halten wir uns schließlich die fortschreitende Gleichschaltung unseres außenpolitischen Kurses mit der Politik der Achse Rom–Berlin vor Augen. Vergessen wir nicht die unveränderten, unsern Landesinteressen geradewegs zuwiderlaufenden Franco-Sympathien der Wirtschaftskreise, der meisten bürgerlichen Redaktionen, des Bundeshauses, gewisser reisefreudiger Obersten und der Militärgerichte (von einer Amnestie für die Freiwilligen wollen die Herren immer noch nichts wissen!); aber auch nicht die fürchterliche, von gewichtigen Zirkeln der »guten Gesellschaft« durchaus gebilligte Luganeser Rede des Außenministers – um nicht zu reden von der patriotischen Großtat, die Herr Motta durch die Aufkündigung der Genfer Paktverpflichtungen vollbrachte, und die allerdings – unseres Erachtens zu Unrecht – auch auf der Linken Zustimmung fand.
Wie viel von unserer Unabhängigkeit müssen wir eigentlich verloren haben, damit die Verteidigung unserer Unabhängigkeit beginnen kann? So viel, dass es überhaupt nichts mehr zu verteidigen gibt? Man ist wahrhaftig berechtigt, diese Frage zu stellen! Aber da ist ja die große Jagd gegen die ESAP, den »Volksbund« und die »nationalsozialistischen Eidgenossen«!
Es gibt Demokraten, die hier ein Anzeichen beginnender Umkehr erkennen wollen. Und es gibt – wer wollte es bestreiten? – gewichtige Persönlichkeiten in den bürgerlichen Parteien, die ehrlich gewillt sind, das Notwendige zu fordern und zu tun. Nur täusche man sich nicht: Noch mehr Gewicht besitzen die Kräfte, die darauf ausgehen, den Schlag, den neunzig Prozent des Volkes gegen die äußerste Rechte geführt sehen wollen, in einen Überrumpelungssieg über die Demokratie zu verwandeln.
Herr Baumann hat im Nationalrat zu verstehen gegeben, dass der Bundesrat »etwas mehr Ruhe und Überlegung« im Volke zu schätzen wüsste, dass seines Erachtens Verbote von Zeitungen und Parteien Maßnahmen sind, »mit denen man es in einer Demokratie nicht leicht nehmen darf« – kurz, dass es der obersten Behörde recht peinlich wäre, gegen die nationalsozialistischen Wähler energisch durchgreifen zu müssen. Haben nicht reichsdeutsche Zeitungen wie das Stuttgarter Neue Tageblatt schon offen geschrieben, das Vorgehen gegen die »Erneuerungsbewegungen« in der Schweiz verletze die schweizerische Neutralität? Wir dürfen versichert sein: Wenn Hofmann, Zander und Leonhardt schließlich doch das Handwerk gelegt werden sollte, dann einzig deshalb, weil die Empörung des Schweizervolkes diesmal für Bern gefährlicher werden könnte als das Knurren Berlins! Vorerst aber steht nur eines fest: Man fabriziert einen Bundesratsbeschluss gegen »staatsgefährliche Umtriebe«, scheinbar, um dem Volk entgegenzukommen. Dieser Bundesratsbeschluss aber wird in der Hauptsache ganz einfach eine Neuauflage des vom Volke verworfenen Staatsschutzgesetzes sein. Und in der Tat: Vorsorglich erklärt man uns schon heute, dass man selbstverständlich auch gegen die »Staatsfeinde« auf der Linken, in erster Linie gegen die Kommunisten, vorgehen wird.
Das heißt nichts anderes, als dass die regierende Klasse sogar eine Volksbewegung gegen die offenbar im Solde unserer gefährlichsten Nachbarn stehenden und die Existenz der Eidgenossenschaft bedrohenden Landesverräter ausnützt, um die Gleichschaltung des Landes, seine Unterwerfung unter den Willen der Achsenmächte ein mächtiges Stück vorwärtszutreiben! Man mag über die Endziele der Kommunisten denken, wie man will: Auch der entschiedenste Gegner Moskaus wird zugeben müssen, dass der schweizerischen Kommunistischen Partei, wie die Dinge heute liegen, gar nichts übrig bleibt als mitzukämpfen, und mit aller Energie zu kämpfen für die Erhaltung unserer demokratischen Freiheiten, unserer nationalen Unabhängigkeit. Und man wird sich auch nicht einbilden wollen, die Bundesanwaltschaft werde die nicht kommunistischen Organisationen und Zeitungen der Linken in Ruhe lassen, wenn die Lex Baumann erst einmal ins Schweizerhaus hereingeschmuggelt ist. Spricht doch das Berner Tagblatt heute schon von einem Aufräumen mit den »Antifaschisten« und das Vaterland gar von einem Verbot der linksbürgerlichen, ja kommunistenfeindlichen Schweizer Zeitung am Sonntag. Jeder Schlag aber, der heute geführt wird gegen irgendeine Welle der demokratischen Front, wird unausweichlich geführt im Interesse, wenn nicht im Auftrag von Rom und Berlin.
Verständigung mit dem Großbürgertum im Zeichen einer gemeinsamen Verteidigung der Schweizer Freiheit? Dieses Großbürgertum hat überall, wo es zu handeln galt, eindeutig gezeigt, dass es nicht gewillt ist, dem vielbesungenen Vaterland zu geben, was des Vaterlandes wäre. Die unüberwindliche Abneigung gegen größere öffentliche Ausgaben, für die der Großbesitz mit aufkommen müsste, wirkt in verhängnisvoller Weise zusammen mit der Sorge um die in Deutschland, Italien und Spanien investierten schweizerischen Kapitalien, und nicht zuletzt mit der Furcht, ein energischer Widerstand gegen die Herrschaftsansprüche der Diktaturen könnte irgendwo umschlagen in eine Niederlage des Faschismus und damit in einen Zusammenbruch des großkapitalistischen Ausbeutungssystems. Das Klasseninteresse hindert nicht nur die französische, sondern auch unsere schweizerische Bourgeoisie, die nationalen Interessen wirksam zu schützen. Kaum wagt man sich die Frage zu stellen: Wie würden sich diese Leute verhalten, die unter den gegenwärtigen verhältnismäßig immer noch leichten Bedingungen derart versagen, die den Anfängen nicht zu wehren verstehen, wenn es einmal ums Ganze gehen sollte? Wenn sich zum diplomatischen Druck von außen – der militärische gesellen sollte? Aber wir brauchen darauf gar keine Antwort zu geben. Was heute versäumt wird, ist wahrhaftig schon bedenklich genug!
Und man erspare sich doch bitte die Mühe, erwachsenen Menschen vorzumachen, die Versäumnisse würden aufhören einer Opposition zuliebe, die darauf verzichtet, Opposition zu sein! Einer Opposition, die sich mit Händen und Füßen zur Wehr setzt, wo immer die Regierenden die nationale Sache gefährden, nur ihr wird man allenfalls Konzessionen zugestehen!
Darüber hinaus gilt es klar ins Auge zu fassen: Die Schweiz wird unweigerlich von innen her gefährdet bleiben, solange das Großbürgertum die politischen Geschicke des Landes bestimmt!
Es geht deshalb nicht darum am 27. November, zu zeigen, dass die Demokratie noch fähig sei, eine positive Mehrheit zusammenzuhäufeln, sozusagen ohne zu fragen, wofür. Es handelt sich darum, der Erkenntnis Rechnung zu tragen, dass unsere Demokratie verloren ist, wenn die Werktätigen dem Kampf ausweichen, da, wo ihr Gewissen Kampf gebietet, und wenn sie gar einem faulen Frieden zuliebe Dinge billigen, die das Unheil nur beschleunigen können. Gewiss, mit der bloßen Verneinung ist es nicht getan. Aber wünschen wir denn eine bloße Verneinung? Aus dem leidenschaftlichen Bekenntnis zur unbedingten Verteidigung der Freiheit muss die verneinende Mehrheit geboren werden, dann wird sie trotz aller Hindernisse auch den Weg finden, sich selbst zur bestimmenden Grundlage einer neuen und schöpferischen Staatsführung zu erheben!
3.Die Schweiz und der spanische Krieg
Trotz aller Rückschläge, die sie als unvermeidliche Folge der einseitigen Nichteinmischungspolitik der Großmächte erlitt, ist der Widerstand der Spanischen Republik am Ende des zweiten Kriegsjahres ungebrochen. Mit einer Verbissenheit, die die furchtbaren Blutopfer nur zu steigern vermochte, verteidigt das demokratische spanische Volk seine Freiheit gegen die meineidig-landesverräterischen Handlanger des Großgrundbesitzes und des Großkapitals, seine nationale Unabhängigkeit gegen die deutschen und italienischen Invasoren.
Die fiebernde Spannung, mit der die Welt den Ablauf der spanischen Ereignisse verfolgt, wäre ohne Weiteres verständlich, auch wenn es ausschließlich um spanische Interessen ginge. Dabei kann nicht bezweifelt werden, dass die Entscheidung im spanischen Krieg von gewaltiger Bedeutung sein wird für den Ausgang des Ringens zwischen der Weltdemokratie und den kriegerisch-faschistischen Mächten – von dem für uns nichts weniger abhängt als der Fortbestand der demokratischen und unabhängigen Schweiz. Ein Endsieg Francos müsste ebenso aufmunternd auf alle großen und kleinen Friedensstörer wie demoralisierend auf einen Teil der demokratischen Volksmassen wirken. Er würde zudem der Achse Rom–Berlin die Herrschaft über die rüstungswichtigen Rohstoffe Spaniens sichern, aber auch die Bundesgenossenschaft des neuen faschistischen Staates im Kriegsfall, wodurch die strategische Stellung Frankreichs ganz empfindlich geschwächt würde.
Die Freunde Francos in den Demokratien versuchen, diese Gefahren in Abrede zu stellen. Sie spekulieren auf den Willen Englands, den deutsch-italienischen Einfluss in Spanien nach beendetem Krieg zurückzudrängen. Mag sein, dass es Großbritannien gelingen könnte, die offene Abtretung spanischen Gebiets an eine der Achsenmächte zu verhindern und den Rücktransport der Interventionstruppen zu erzwingen: An den wirtschaftlichen Eroberungen Italiens und Deutschlands und an der militärpolitischen Hörigkeit eines faschistischen Spanien gegenüber Rom und Berlin vermöchten alle Erpressungs- und Bestechungsversuche Londons nicht das Geringste zu ändern, schon weil das Franco-Regime ständig angewiesen bliebe auf die Möglichkeit, gegen eine Erhebung des Volkes neuerdings die Hilfe der Diktatoren zu beanspruchen. Die Heilspropheten aber, die in einer nicht mehr fernen (und dabei ewig währenden) Zukunft die Achse auseinanderbrechen sehen, rechnen zwar mit einer nicht gerade völlig unmöglichen, aber doch höchst unwahrscheinlichen Entwicklung. Sie zum Maßstab seines politischen Denkens oder gar Handelns zu wählen, wird kein verantwortungsbewusster Mensch sich leisten wollen.
Das Interesse der Schweiz steht somit – und stand von Anfang an – eindeutig fest. Es erfordert den Zusammenbruch des verbrecherischen Anschlags, den die faschistischen Diktaturen auf spanischem Boden gegen Frieden und Freiheit der Welt in Szene setzten. Es erfordert, heute wie jemals, den Triumph der Spanischen Republik. Diese Wahrheit erscheint uns so selbstverständlich, dass wir zögern, sie immer wieder auszusprechen. Und dennoch ist es keineswegs überflüssig; denn das Verhalten der Schweiz ist weit davon entfernt, jenem Landesinteresse zu gehorchen, gar nicht zu reden von der Solidarität, die die »älteste Demokratie« einem für seine Freiheit und Unabhängigkeit kämpfenden Volk an und für sich schuldig ist.
An der Sonntagspatrioten-Kundgebung von Colombier hat sich ein Redner zu der erhebenden Behauptung verstiegen, das weiße Kreuz in der Schweizerfahne bedeute, dass der Schweizer im innersten Herzen neutral sei. Man fragt sich zuweilen, ob dieser würdelose Unsinn nicht im Begriff sei, Tatsache zu werden. Vor allem, wenn man das Gerede jener Bürger anhört, die sich nicht vorstellen können, dass die Wahrheit nicht immer und überall schön in der Mitte zwischen den Extremen liegt, die in den Führern der beiden spanischen Bürgerkriegsparteien dieselben Schwindler, Tyrannen und grausamen Bluthunde sehen und die es daher wohl zu einem unverbindlichen Gejammer über die Kriegsgräuel bringen, nicht aber zur Empörung gegen eine Clique, die, um jahrhundertealtes Unrecht der Wenigen gegen die Vielen zu erhalten, sich kurzerhand zum Massenmord entschloss.
Dabei sind diese Schwankenden harmlos im Vergleich zu den Kreisen, die immer noch über die politische Macht in der Eidgenossenschaft verfügen. Mit den sogenannten Spanienerlassen des Bundesrates vom August 1936, die u.a. die Waffenausfuhr nach Spanien und die persönliche Teilnahme schweizerischer Bürger am spanischen Krieg mit schweren Strafen bedrohen, begann eine lange Kette behördlicher Akte, die wir nicht anders denn als Hilfsdienste für die Rebellen bezeichnen können. Wir erinnern hier nur: an die Stimmenthaltung der schweizerischen Delegation bei der Wiederbesetzung des zuvor von Spanien innegehaltenen Sitzes im Völkerbundsrat; an den Fall Toca; an die Entsendung eines schweizerischen diplomatischen Vertreters nach Burgos; an das Empfehlungsschreiben Mottas, mit dem Oberst von Diesbach nach Spanien reiste; vor allem aber an den fortschreitenden Abbau der schweizerischen Freiheitsrechte im Zeichen der Spanienpolitik: an das Einfuhrverbot für regierungsspanische Zeitungen; an die über sogenannte »Spanienfahrer« verhängten Freiheitsstrafen; endlich an den kläglich gescheiterten Versuch, die leitenden Funktionäre der Kommunistischen Partei als Werber von Freiwilligen für Spanien ins Zuchthaus zu bringen und im Anschluss womöglich die Partei selbst in der ganzen Schweiz zu verbieten.
Auch diese Politik hat man mit dem Hinweis auf unsere Neutralität zu rechtfertigen versucht. Diesen Manövern gegenüber ist festzuhalten: dass weder Deutschland noch Italien sich als kriegführende Mächte betrachten. Dass diese Auffassung auch vom Bundesrat nie vertreten worden ist, da er doch sonst etwa das Verbot der Ausfuhr von Rüstungsmaterial ohne Weiteres auch gegenüber den Achsenstaaten hätte verfügen müssen. Dass unsere Neutralitätspolitik in Spanien sich also einzig nach der Tatsache eines Aufstandes gegen die legale spanische Regierung zu richten hat. Dass aber unsere Neutralität uns nur rechtlich anerkannten kriegführenden Staaten, niemals jedoch Rebellen gegenüber verpflichtet. Und dass daher auch der geringste Vorteil, den die Eidgenossenschaft Franco zugesteht, eine völlig willkürliche Begünstigung des faschistischen Aufruhrs und eine klare Verletzung der guten Rechte der Republik darstellt. Die Verteidiger der Spanienpolitik Mottas geben sich ja auch gar nicht die Mühe, vorzutäuschen, dass die Neutralität ihres innersten Herzens auch den Schrecknissen des spanischen Krieges standgehalten hätte. Ihre Zeitungen verkünden unverschleierten Hass gegen die »Roten«; dagegen triefen sie vor Befriedigung über die Erfolge der Aufrührer und schämen sich immer noch nicht, sie die »Nationalen« zu nennen.
Wenigstens wissen wir nun, was diese Herren unter national verstehen: unter Umständen sogar die Verpfändung der eigenen Unabhängigkeit an fremde Großmächte! Wenigstens verraten sie uns mit ihrer zynischen Offenheit, wie eng die Grenzen ihrer Treue zu Demokratie und Legalität gezogen sind, wie wenig sie sich gegebenenfalls daraus machen, unsere eigenen Freiheitshelden – von den Rütlimännern bis zu den Schöpfern des modernen Bundesstaates – zu verleugnen. Ist es ein Wunder, dass diese schweizerische Herrenklasse sich schon heute fähig zeigt, tatsächlich Verrat an der Nation zu üben?
Es ist ja auch allzu offensichtlich, warum sie sich so hartnäckig am Volksganzen versündigt, was sie in dieser Weise den Machthabern in Rom, Berlin und Burgos dienen lässt. Nicht etwa nur die Furcht vor den säbelrasselnden Nachbarn; sie vermöchte die Sympathien für die Rebellen niemals zu erklären! Die schweizerische Hochfinanz – vor allem die Kreise um die Kreditanstalt – sieht die Rentabilität ihrer bedeutenden in Spanien investierten Kapitalien durch die Herrschaft der Volksfront gefährdet. Die einflussreichen Eidgenossen, die der vatikanischen Internationale verpflichtet sind, zittern für die Güter der spanischen Kirche. Dieses finsterste Instrument der Volksbedrückung hat naturnotwendig in den niedergehaltenen Massen den entsprechenden Gegendruck hervorgerufen. Und die gesamte schweizerische Großbourgeoisie fürchtet, dass eine demokratische Entwicklung um sich greift, die endlich auch auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet die Rechte des Volkes zur Geltung kommen lässt.