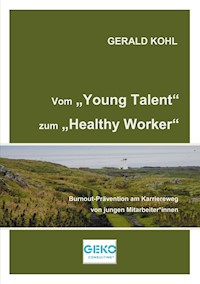Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: NextGenerationWorkLife
- Sprache: Deutsch
Resilienz ist ein aktuelles Schlagwort im Bereich der personellen, aber auch der organisationalen Widerstandsfähigkeit. Die Widerstandsfähigkeit von Organisationen stellt für deren Überleben im Hinblick auf den Wettbewerb in einer zunehmend dynamischen und schnelllebigen Welt und organisatorische Herausforderungen wie einer alternden Belegschaft und Fachkräftemangel einen Faktor von strategischer Bedeutung dar. Speziell der Frage, was Unternehmen mit höherer Resilienz von jenen mit geringerer Belastbarkeit unterscheidet, wird in diesem Buch am Beispiel konkreter und erfolgreich überwundener Krisensituationen von Teams im Bereich der landwirtschaftlichen Organisation, des KMU-Betriebs und internationalen Unternehmen nachgegangen. Das dazu als Basis dienende Forschungsprojekt des Autors zeigt einerseits interessante Gemeinsamkeiten von vorhandenen Resilienzpotenzialen auf und bringt andererseits überraschende Unterschiede zwischen den in den jeweiligen Organisationskontexten wirksamen Resilienzfaktoren ans Licht. Die gewonnenen Einblicke bieten allen, die sich in Krisensituationen befinden oder die sich mit der erfolgreichen Bewältigung beziehungsweise der Vorbeugung von Krisen in Unternehmen beschäftigen, einen nachvollziehbaren roten Faden zur Förderung der Teamresilienz an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Resilienz ist ein aktuelles Schlagwort im Bereich der personellen, aber auch der organisationalen Widerstandsfähigkeit. Die Widerstandsfähigkeit von Organisationen stellt für deren Überleben im Hinblick auf den Wettbewerb in einer zunehmend dynamischen und schnelllebigen Welt und organisatorische Herausforderungen wie einer alternden Belegschaft und Fachkräftemangel einen Faktor von strategischer Bedeutung dar.
Speziell der Frage, was Unternehmen mit höherer Resilienz von jenen mit geringerer Belastbarkeit unterscheidet, wird in diesem Buch am Beispiel konkreter und erfolgreich überwundener Krisensituationen von Teams im Bereich der landwirtschaftlichen Organisation, des KMU-Betriebs und internationalen Unternehmen nachgegangen.
Das dazu als Basis dienende Forschungsprojekt des Autors zeigt einerseits interessante Gemeinsamkeiten von vorhandenen Resilienzpotenzialen auf und bringt andererseits überraschende Unterschiede zwischen den in den jeweiligen Organisationskontexten wirksamen Resilienzfaktoren ans Licht.
Die gewonnenen Einblicke bieten allen, die sich in Krisensituationen befinden oder die sich mit der erfolgreichen Bewältigung beziehungsweise der Vorbeugung von Krisen in Unternehmen beschäftigen, einen nachvollziehbaren roten Faden zur Förderung der Teamresilienz an.
Der Autor Ing. Gerald Kohl, MA, PMP, hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie studiert, ist zertifizierter Business- und Mentalcoach, verfügt über 20 Jahre Management- und Coachingerfahrung im internationalen Konzernumfeld und arbeitet selbstständig als Unternehmensberater.
Die diesem Buch als Basis dienende wissenschaftliche Forschungsarbeit des Autors, „Resilienz von Gruppen im Organisationskontext, eine qualitative Untersuchung zur Erforschung positiver Wirkfaktoren anhand realer Krisensituationen in privatwirtschaftlichen Organisationen“, wurde 2020 als Projekt zum Master Studium, im Zentrum für Wirtschaftspsychologie, Sozial- und Freizeitwirtschaft an der Donau-Universität Krems, angenommen.
Vorwort
Als ich vor gut eineinhalb Jahren das Forschungsprojekt zu diesem Buch abgeschlossen hatte, war die Coronakrise gerade erst in Schwung gekommen. Heute hat das Thema Resilienz nach wie vor nichts an Aktualität eingebüßt. Es bleibt immer wieder spannend zu reflektieren, wie wertvoll rechtzeitig zur Verfügung stehende Resilienzpotenziale im privaten Bereich und speziell für Organisationen und ihre Teams tatsächlich sein können.
Resilienz, als das „Immunsystem“ von Teams betrachtet, stellt hier aus meiner Sicht eine interessante Metapher dar. Denn im Team, sozusagen an der Schnittstelle zwischen Organisation und Individuum, repräsentieren sich sowohl die verborgenen, latenten Leiden in der Organisationstruktur als auch die Früchte einer achtsamen, ganzheitlichen Führungs- und Lernkultur. Gleichsam gilt es bei der Resilienzförderung, bewusst einen belastungsoptimierten Fit zwischen Person und Organisation mit den „Zeichen der Zeit“ in Einklang zu bringen.
Die analog daraus erwachsende Frage „Welche Resilienzfaktoren stellen sich in der Unternehmenspraxis zur erfolgreichen Bewältigung von realen Krisensituationen in Teams als besonders wirksam dar?“ fasst das Anliegen dieses Buchprojekts zusammen. Angelehnt an das Prinzip der Salutogenese, ganz nach dem Motto „Grow with the flow“ …
Altlengbach, im Sommer 2021
Gerald Kohl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.
Einleitung
1.1. Die Bedeutung von Resilienz für Organisationen in Krisen
1.2. Das Forschungsvorhaben, von der Problemstellung zum roten Faden
1.3. Zum weiteren Aufbau und Inhalt des Buches
2.
Theoretische Hintergründe zur Resilienz
2.1. Das Zusammenspiel von Resilienz und Krisen
2.1.1.Wege zur Resilienz in Organisationen
2.1.2.Präventionsstrategien gegen Burnout von Teams
2.2. Der Einfluss von Motivation auf Resilienz und Verhalten
2.2.1. Emotionen als Auslöser und Motivation als Auswirkung
2.2.2.Einflussfaktoren in der Praxis
2.3. Conclusio aus der aktuellen Forschung und für die Wirtschaft
2.4. Theoriereflexion
3.
Methodik und Untersuchungsdesign der Forschungsarbeit
3.1. Kategorienbildung zum Analyseprozess
3.2. Entwicklung des Interviewleitfadens
3.3. Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung
3.4. Beschreibung des Untersuchungssamples
3.5. Gütekriterien und Fokusbereiche
4.
Ergebnisse aus der Forschungsarbeit
4.1. Interviewergebnisse und Kategorisierung
4.2. Praxisreflexion
4.3. Schlüsselkategorien und Resilienz-Wirkfaktoren
5.
Gedanken zur Interpretation und weiteren Verwendung der Ergebnisse
6.
Zusammenfassung und Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang 1 – Abstract zur Forschungsarbeit
Anhang 2 – Untersuchungsplan
Anhang 3 – Interviewleitfaden
Anhang 4 – Transkription
Anhang 5 – Kategoriensystem
Exkurs – Zwischen Flow und Narzissmus in der Unternehmensführung
–
„Gedanken zu Analogien mit dem (Extrem-)Alpinismus“
Nachwort
1. Einleitung
Dieses Buch befasst sich mit dem Begriff der Resilienz, der uns derzeit viel beschäftigt. Speziell geht es um die Frage, was Personen mit höherer Widerstandsfähigkeit im Gegensatz zu jenen mit geringerer Belastbarkeit auszeichnet. Dazu gibt es bereits viel Literatur und Wissen, das in den letzten Jahren rund um diesen Themenkomplex entstanden ist. Wird der Begriff der Resilienz weiter gedacht, so drängt sich die Frage auf, ob es auch so etwas wie kommunale, gemeinsame Resilienz gibt, also eine Widerstandsfähigkeit, die für größere Strukturen, etwa ganze Gruppen oder Organisationen, gilt, in Zeiten mit und auch in Zeiten ohne Krise (Götze, 2013).
Die Widerstandsfähigkeit von Organisationen kann für ihr Überleben von entscheidender Bedeutung sein. Entscheidungen in Organisationen werden oft falsch getroffen, weil verdeckte, verschwiegene oder persönliche Anliegen die Prozesse beeinflussen (Fisch, 2013). Zusätzlich kann beobachtet werden, dass es in einer zunehmend dynamischen und schnelllebigen Welt einigen Organisationen wesentlich besser gelingt ihre Funktionsfähigkeit und innere Struktur angesichts dramatischer Veränderungen zu bewahren, ja sogar gestärkt aus Krisen hervorzugehen, als anderen (Weick & Sutcliffe, 2010). Nach Senarclens De Grancy, 2013, wird zum Thema Widerstandskraft in Organisationen seit den 90er Jahren des letzten Jahrtausends geforscht, was bis heute zu einer immer weiteren Auffächerung und Vertiefung beigetragen hat. Ihrer Ansicht nach bezeichnet die Widerstandskraft oder Resilienz einer Organisation, wie schnell ein System auf Druckeinwirkung reagiert und wie dieses aus Krisen möglichst ungestört herauskommt. Sehr bekannte Studien in diesem Zusammenhang sind z. B. „The Children of Kauai“ (Werner, 1971)1 der „Die Arbeitslosen von Marienthal“ (Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 1933)2.
Die Förderung einer resilienten Unternehmenskultur nimmt in den heutigen Unternehmen im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und weitere Herausforderungen wie einer alternden Belegschaft und Fachkräftemangel eine zunehmend strategische Bedeutung ein (Fisch, 2013). In der früheren Industriegesellschaft stand für den Geschäftserfolg die sachliche Ebene im Vordergrund und es galt, Maschinen und Technik zu optimieren. In der heutigen Wissensgesellschaft sind jedoch der Mensch, seine kognitive und kreative Leistungsfähigkeit, sowie die Beziehungen zwischen den Akteuren im Unternehmen die ausschlaggebenden Faktoren für den Geschäftserfolg (Bertelsmann Stiftung, 2015). Das bedeutet, dass sich erst aus einer umfassenden Betrachtung aller relevanten Faktoren auf der sachlichen und der menschlichen Ebene eine zuverlässige, zielführende Strategie für ein Unternehmen entwickeln lässt.
1.1. Die Bedeutung von Resilienz für Organisationen in Krisen
Unter der Widerstandsfähigkeit einer Organisation im aktuellen Wirtschaftskontext kann die Fähigkeit verstanden werden, unvorhergesehene Situationen, Turbulenzen und Herausforderungen nicht nur zu bewältigen, sondern hierin Stärken und Ressourcen zu erkennen und damit Potenziale für zukünftige Ereignisse bewusst nutzbar zu machen. Besonders gefragt sind somit jene protektiven Handlungsfelder von Organisationen, die ihre Widerstandskraft stärken. Diese Fähigkeit, Resilienz in Unternehmen auszubauen, ist in den häufigsten Fällen ein Managementthema, das sich sowohl in strategischen Entscheidungen als auch in der Organisationsentwicklung und im Führungsverständnis abbildet (Starecek, 2013). In zahlreichen Unternehmen ist durchaus Resilienzpotenzial vorhanden, dieses wird aber in Krisensituationen nicht aktiv genutzt. Darum stellt es immer wieder eine Herausforderung für Manager dar, dieses Potenzial zu erkennen beziehungsweise zu entwickeln und bei Bedarf wirksam zu aktivieren.
In Anbetracht der genannten Aspekte verfolgt der Autor in diesem Buch einerseits das Ziel, die in der Literatur beschriebenen Faktoren der Widerstandsfähigkeit von Organisationen herauszuarbeiten. Andererseits sollen anhand eines Praxisvergleichs am Beispiel von drei Unternehmen diejenigen Resilienzfaktoren kategorisiert werden, die sich in durchlebten Krisensituationen für den jeweiligen Organisationskontext als am stärksten resilienzfördernd erwiesen haben. Sie geben am Ende Auskunft über mögliche Wirkfaktoren, welche in weiterer Folge als Hilfestellung im Management von Unternehmen dienen können.
1.2. Das Forschungsvorhaben, von der Problemstellung zum roten Faden
Viele der in der Literatur angeführten Quellen bestärken zwar die Wichtigkeit von Resilienz, es wird allerdings, abgesehen z. B. von den Bereichen Integration, Bildung und medizinisch-klinischen Bereichen, seltener Bezug zu verwertbaren Krisenerfahrungen von Teams3 in Unternehmen genommen. Dies dürfte unter anderem vielfältigen systemischen Kontextabhängigkeiten und Anpassungsaspekten geschuldet sein (siehe Kapitel 2.1.). Aus diesem wahrgenommenen Defizit heraus verfolgt die diesem Buch als Basis dienende Studie des Autors das Ziel, einerseits Resilienzfaktoren anhand von konkreten und erfolgreich überwundenen Krisensituationen von Teams in Unternehmen zu erforschen und andererseits mögliche Gemeinsamkeiten mit den in der Literatur beschriebenen Resilienzfaktoren zur Widerstandsfähigkeit von Organisationen herauszuarbeiten.
Diese Problemstellung führt zu folgender Forschungsfrage in der anschließenden Praxisuntersuchung:
„Welche Resilienzfaktoren stellen sich in der Praxis aus der Sicht von Expert*innen zur erfolgreichen Bewältigung von realen Krisensituationen am Beispiel von Gruppen im privatwirtschaftlichen Organisationskontext als besonders wirksam dar?“
Unter dieser Forschungsaufgabe wurden mittels Interviews mit Expert*innen Praxisreflexionen basierend auf tatsächlich durchlebten Krisenfällen von Teams (Fälle) in drei unterschiedlichen österreichischen Unternehmen durchgeführt, um diejenigen Resilienzfaktoren herauszuarbeiten und zu kategorisieren, die zur positiven Überwindung der Krisensituation beigetragen haben. Der Fokus liegt hierbei hauptsächlich auf durch Ressourcenausfall hervorgerufene Krisensituationen (wie z. B. Ausfall von Schlüsselpersonal, Unfallfolgen etc.), in denen die den Teams zur Verfügung stehenden Lösungsansätze für die Bewältigung der Krise nicht mehr ausreichend waren und es somit einer Entwicklung neuer Bewältigungsstrategien bedurfte. In einem weiteren Schritt wurden unterschiedliche Literaturquellen und Theoriemodelle zum Thema Resilienz analysiert und kategorisiert, um einen Überblick über die derzeitige wissenschaftliche Sichtweise zu den wesentlichen Resilienzfaktoren in Organisationen und somit zum Untersuchungsgegenstand zu erhalten. In einer Gegenüberstellung der erhobenen Kategorien sollen etwaige Zusammenhänge oder Gemeinsamkeiten zwischen der individuellen Sicht der Praxisquellen und dem erlangten theoretischen Wissensstand von Resilienz in Organisationen aufgezeigt werden.
In ihrer Zielstellung soll diese Untersuchung im Idealfall einen roten Faden bezüglich verwertbarer Resilienz-Wirkfaktoren darstellen, die sich aus der Praxis im Kontext der untersuchten Organisationen und im Zusammenhang mit der Theorie als besonders positiv wirksam herausgestellt haben und in der Beratung oder im Management von Organisationen zur Förderung der Resilienz Verwendung finden können.
1 Längsschnittstudie an 698 Kindern auf der Hawaiinsel Kauai.
2 „Mixed Methods“ Untersuchung zu den Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit.
3 Die Begriffe „Teams“ und „Gruppen“ werden in diesem Buch bedeutungsgleich verwendet.
1.3. Zum weiteren Aufbau und Inhalt des Buches
Im Anschluss an diese Einleitung und den Problemaufriss widmet sich dieses Buch in sechs Teilen dem beschriebenen Forschungsvorhaben. Zunächst beleuchtet der Theorieteil in Kapitel 2. die Aufarbeitung des Stands der Forschung und aktuelle Literaturzitate und zeigt erste Kategorien für die weitere Untersuchung auf. In Kapitel 3. werden die wesentlichen methodischen Schritte und das Design zur qualitativen Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der in der Praxis analysierten Fälle beschrieben. Daran anschließend gelangt man im Ergebnisteil in Kapitel 4. über die Reflexion der Praxisergebnisse und deren Gegenüberstellung mit der Theorie verständlich nachvollziehbar zu den analysierten Schlüsselkategorien, beziehungsweise den dazu erforschten Resilienz-Wirkfaktoren und zur finalen Darstellung der Resultate. Die Interpretation und kritische Diskussion der Forschungsergebnisse beleuchten in Kapitel 5. die Ergebnisse von der Seite der Übertragbarkeit auf andere Organisationskontexte und runden mit Kapitel 6., Zusammenfassung und Ausblick, diese Arbeit zum Schluss hin ab.
In den Anhängen finden sich ergänzende Zusatzinformationen beziehungsweise Details zur Forschungsarbeit wie Abstract, Informationen und Tabellen zu den Projektphasen, Interviewleitfäden, Transkriptionen und Kategorientabellen.
2. Theoretische Hintergründe zur Resilienz
Allem voran steht die Theorie. In diesem Kapitel werden unterschiedliche Literaturquellen zum Thema Resilienz analysiert, um einerseits einen Überblick über die derzeitige Sichtweise zu erhalten und andererseits die Praxiserhebung starten zu können. Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl sowohl auf die entsprechende Nähe zum Forschungsthema im Kontext von Gruppen in Organisationen gelegt als auch auf in diesem Zusammenhang beschriebene mögliche Interventionsstrategien in Krisensituationen. Dementsprechend sollen zunächst die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe Resilienz und Krise sowie zugehörige Einflussaspekte in Bezug zur Motivation erläutert werden.
2.1. Das Zusammenspiel von Resilienz und Krisen
Resilienz kann grundsätzlich vom englischen Begriff „resilience“, was so viel wie Strapazierfähigkeit bedeutet, aber auch vom Lateinischen „resilere“, abprallen, abgeleitet werden. Als ursprünglich in der Psychologie verwendeter Begriff zur individuellen seelischen Widerstandsfähigkeit findet sich Resilienz allerdings heute im Kontext vieler Bereiche, wie unter anderem Gruppen, Organisationen, ganzen Wirtschaftsbereichen oder Regionen und ihren Umwelten wieder. Als Beispiel seien hier Resilienzkonzepte für Betriebsstandorte aber auch ganze Tourismusregionen angeführt. Dies dürfte vorwiegend auf den ständig steigenden Herausforderungen, Stichwort Veränderungsprozesse, und den damit einhergehenden Krisensituationen beruhen. Im wirtschaftlichen Kontext inkludiert der Begriff Resilienz zusätzlich zur individuellen Fähigkeit auch die organisationalen Fähigkeiten des sozialen Systems, sich erfolgreich an laufend veränderliche Anforderungen anzupassen. Es bedarf somit eines systemischen Zugangs zum Verständnis von Interaktionen im Kontext von Individuum und relevanter Umwelt, worauf in der Diskussion in Kapitel 5. zusätzlich eingegangen wird (Wellensiek, 2011).
In der Forschungsarbeit zum Thema Resilienz stellen die Faktoren der Kontextabhängigkeit gemeinsam mit der dem Menschen oder dem sozialen System in einer potenziellen Krisensituation zur Verfügung stehenden Anpassungsfähigkeit wichtige Aspekte zur Erforschung von präventiven Maßnahmen beziehungsweise Interventionsstrategien dar. Diese Vielfältigkeit führt allerdings auch dazu, dass im arbeitsbezogenen Kontext der Bereich der Praxisforschung oft große Lücken aufweist (Moritz, 2011). Kast, 2010, beschreibt weiter, dass Opfer einer Krisensituation dazu aufgefordert sind eine solche Anpassungsleistung zu erbringen um ihre Selbstwirksamkeit und damit die Kontrolle über ihr Leben wiederzuerlangen. Notwendige Veränderungen zwischen Innenwelt und Außenwelt müssen realisiert werden, um wieder Balance im Leben zu erlangen. Neue Bewältigungsstrategien und entsprechende innere Umstrukturierungen sind gefordert. Wenn diese von den Betroffenen nicht selbst aufgebracht werden können, braucht es adäquate und rasche professionelle Krisenberatung.