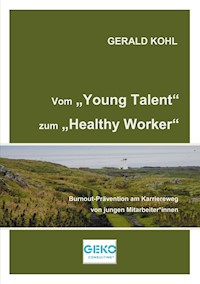
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: NextGenerationWorkLife
- Sprache: Deutsch
"So weit bin ich noch nicht, das drück ich schon durch" - "Über solche Dinge spricht man nicht unter Kolleg*innen" - "Schlimm ist das Gefühl, mit seinen Themen alleingelassen zu werden". Solche und ähnliche Aussagen gab es in den Interviews im Zuge der Forschungsarbeit zu diesem Buch zu hören. Begeben Sie sich gemeinsam mit dem Autor auf eine Forschungsreise und erleben Sie am Praxisbeispiel eines Technologieunternehmens interessante, aber auch überraschende Einblicke, weshalb junge Mitarbeiter*innen oft unbemerkt ein hohes Burnoutrisiko haben und sich engagierte Präventionsanstrengungen gerade in Krisensituationen als (nicht) wirksam erweisen können. Dieses Buch wendet sich an alle, die sich selbst, als Team oder im Unternehmen mit dem in unserer heutigen Leistungsgesellschaft so wichtigen volkswirtschaftlichen Thema der Burnout-Prävention auseinandersetzen wollen, um bereits im frühen Beschäftigungsalter der "Young Talents" die Voraussetzungen für einen nachhaltigen "Healthy-Worker-Effekt" zu schaffen. Für Personalverantwortliche, aber auch Studierende kann dieses Buch eine Anregung zur praktischen Umsetzung eigener Forschungsprozesse und Unterstützung bei der kompetenten Interpretation der erhaltenen Ergebnisse darstellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
„So weit bin ich noch nicht, das drück ich schon durch“ – „Über solche Dinge spricht man nicht unter Kolleg*innen“ – „Schlimm ist das Gefühl, mit seinen Themen alleingelassen zu werden“. Solche und ähnliche Aussagen gab es in den Interviews im Zuge der Forschungsarbeit zu diesem Buch zu hören.
Begeben Sie sich gemeinsam mit dem Autor auf eine Forschungsreise und erleben Sie am Praxisbeispiel eines Technologieunternehmens interessante, aber auch überraschende Einblicke, weshalb junge Mitarbeiter*innen oft unbemerkt ein hohes Burnoutrisiko haben und sich engagierte Präventionsanstrengungen gerade in Krisensituationen als (nicht) wirksam erweisen können.
Dieses Buch wendet sich an alle, die sich selbst, als Team oder im Unternehmen mit dem in unserer heutigen Leistungsgesellschaft so wichtigen volkswirtschaftlichen Thema der Burnout-Prävention auseinandersetzen wollen, um bereits im frühen Beschäftigungsalter der „Young Talents“ die Voraussetzungen für einen nachhaltigen „Healthy-Worker-Effekt“ zu schaffen.
Für Personalverantwortliche, aber auch Studierende kann dieses Buch eine Anregung zur praktischen Umsetzung eigener Forschungsprozesse und Unterstützung bei der kompetenten Interpretation der erhaltenen Ergebnisse darstellen.
Der Autor Ing. Gerald Kohl, MA, PMP, hat Wirtschafts- und Organisationspsychologie studiert, ist zertifizierter Business- und Mentalcoach, verfügt über 20 Jahre Management- und Coachingerfahrung im internationalen Konzernumfeld und arbeitet selbstständig als Unternehmensberater.
Die diesem Buch als Basis dienende wissenschaftliche Forschungsarbeit des Autors: „Vom Young Talent zum Healthy Worker, eine Analyse von Stressfaktoren und primärpräventiven Maßnahmen zur Burnout-Vermeidung bei jungen Mitarbeiter*innen“, wurde 2021 im Zentrum für Wirtschaftspsychologie, Sozial- und Freizeitwirtschaft der Fakultät für Gesundheit und Medizin an der Donau-Universität Krems als Master-Thesis angenommen.
Danksagung
Mag.a Viktoria Lanthier für die Bereitschaft zur Betreuung meiner Forschungsarbeit, die prompte Beantwortung meiner Fragen sowie das stets hilfreiche und kritische Feedback.
Prof. Dr. Dr. Christa Kolodej, MA für die wertvollen Ratschläge, um bei der Themenauswahl die Relevanz nicht aus den Augen zu verlieren.
Dr. Med. Edith König-Hetzenauer für die hilfsbereiten Fachauskünfte aus Sicht der Coaching- und Beratungspraxis.
Dr. Daniel Köhn für die interessanten Perspektiven und Anregungen, welche zur Grundidee meiner Untersuchungsarbeit geführt haben.
Volker Sotzko, MSc für die bereichernden Impulse in meiner beruflichen Laufbahn und für die Beratung bei der Auswahl meines Studienschwerpunkts.
Meiner Familie und vor allem meiner Frau Sabine für die liebevolle Geduld und das Verständnis während des Verfassens meiner Forschungsarbeit sowie für die bedingungslose Unterstützung in der gesamten Studienzeit, wodurch schlussendlich auch dieses Buch ermöglicht wurde.
Nina, Romina, und Lukas für den freundschaftlichen Rückhalt und anregenden Diskurs bei der wissenschaftlichen Ausarbeitung.
Vorwort
Das Cover dieses Buches zeigt das zum Leuchtturmsystem der Isle of May in Schottland gehörende North (Fog) Horn. Solche Nebelhörner wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Orientierungssignal eingesetzt, um Schiffen die Positionsbestimmung zu erleichtern und sie vor einer gefährlichen Annäherung an die Küste zu warnen. Besonders Seenebel stellte für die damalige Schifffahrt eine große Gefahr dar, und viele Seeleute verloren schon in jungen Jahren durch Schiffbruch an den Klippen der Küste ihr Leben. Davor waren andere Warnsysteme im Einsatz, wie Nebelglocken oder das Abfeuern von Kanonen, die sich jedoch über die Zeit als nicht effektiv genug erwiesen. In diesem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess befindet sich die Schifffahrt heute, im Zeitalter elektronischer Ortungssysteme mit Radar- und GPS-Technologien, abermals in einer verbesserten Situation.
Die Analogien zwischen den Gefahren für die damalige Seefahrt und der Bedeutung des Themas Burnout für heutige Unternehmen und ihre jungen Mitarbeiter*innen weisen eine inspirierende Metapher auf. Ein waches Bewusstsein gegenüber möglichen Gefahren, eine realistische Wahrnehmung der aktuellen Situation und die stete Verbesserung kompetenter Handlungsalternativen stellen heutzutage besonders für die junge Belegschaft genauso wichtige Fähigkeiten dar wie damals für die Schiffsbesatzungen. Eine bewusste Stärkung von Ressourcen und konsequente Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen erweist sich dabei als unerlässlich für die Erlangung einer nachhaltigen Krisenresilienz in Unternehmen, ihren Organisationseinheiten und Projektteams sowie bei jedem einzelnen Mitglied.
Die in diesem Buch erforschten Faktoren bergen analog dazu ein wirksames Potenzial, um Schiffbrüche am Karriereweg zu vermeiden.
Altlengbach, im Sommer 2021
Gerald Kohl
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1.1. Burnoutrelevanz für „Young Talents” und der „Healthy-Worker-Effekt”
1.2. Das Forschungsvorhaben als roter Faden zur Prävention
1.3. Zum weiteren Aufbau und Inhalt des Buches
Theoretische Hintergründe zum Burnout-Syndrom
2.1. Folgen aus dem Zusammenhang von Burnout und Stress
2.2. Wirkung des Zusammenspiels von Prävention und Resilienz
2.3. Aspekte zu Ursachenanalyse und Diagnostikverfahren
2.4. Aktuelle Forschung und Bedeutung für die Wirtschaft
Präventionsmöglichkeiten und Interventionsstrategien
3.1. Beratung und Coaching als Präventionsansatz
3.1.1 Der Coachingprozess
3.1.2 Das systemische Paradigma
3.1.3 Der systemische Loop
3.1.4 Die Beratungsrisiken
3.2. Verhaltens- und verhältnisorientierte Interventionsstrategien
3.2.1 Ansatzpunkt Organisation
3.2.2 Ansatzpunkt Schnittstelle Individuum und Organisation
3.2.3 Ansatzpunkt Individuum
3.3. Theoriereflexion
Methodik und Untersuchungsdesign der Forschungsarbeit
4.1. Kategorienbildung zum Analyseprozess
4.2. Entwicklung des Interviewleitfadens
4.3. Datenerhebung, Aufbereitung und Auswertung
4.4. Beschreibung des Untersuchungssamples
4.5. Gütekriterien und Fokusbereiche
Ergebnisse aus der Forschungsarbeit
5.1. Interviewerkenntnisse und Kategorisierung
5.2. Praxisreflexion
5.2.1 Zusammenfassung der Stresssituationen
5.2.2 Analyse vorrangiger Stressfaktoren
5.2.3 Reflexion zur Maßnahmenwirkung
5.3. Schlüsselkategorien und Handlungsempfehlungen
5.3.1. Schlüsselkategorie Individuum (SK1) - Analyse und Empfehlungen
5.3.2. Schlüsselkategorie Schnittstelle Individuum und Organisation (SK2) - Analyse und Empfehlungen
5.3.3. Schlüsselkategorie Organisation (SK3) - Analyse und Empfehlungen
5.3.4. Schlüsselkategorie Führung (SK4) - Analyse und Empfehlungen
5.3.5. Schlüsselkategorie Pandemie Homeoffice (SK5) - Analyse und Empfehlungen
5.4. Gedanken zur Maßnahmenumsetzung und Intervention
Diskussion und Interpretation der Forschungsergebnisse
6.1. Risiken bei der weiterführenden Verwendung
6.2. Einflussfaktoren während der Forschungsarbeit
6.3. Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse
Zusammenfassung und Ausblick
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Anhang 1 – Abstract zur Forschungsarbeit
Anhang 2 – Untersuchungsplan
Anhang 3 – Interviewleitfaden
Anhang 4 – Transkription
Anhang 5 – Kategoriensystem
Anhang 6 – Fragen und Hypothesenformen
Anhang 7 – Interventionsmethoden
Exkurs – Interkulturelle Kompetenz in der Organisationsentwicklung
(
Reflexion zur Bedeutung kultureller Vielfalt in Unternehmen)
Nachwort
1. Einleitung
Dieses Buch befasst sich mit dem Thema der Erschöpfungskrankheiten („Burnout“) und ihrer Bedeutung für die Leistungsfähigkeit der Belegschaft in Unternehmen. Burnout, oft im Zusammenhang mit Stress und in Krisensituationen betrachtet, ist ein weitreichend verwendeter Begriff, der die Gesellschaft aktuell stark beschäftigt. Speziell da Burnout als Trigger für spätere Erkrankung gesehen werden kann, sollte der Prävention und der Frage, was Personen mit höherer Widerstandfähigkeit („Resilienz“) von Personen mit weniger Belastbarkeit unterscheidet, besonderes Augenmerk geschenkt werden. Laut aktuellen Forschungsergebnissen wird Burnout meistens durch Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ausgelöst, weswegen eine gleichzeitige Betrachtung mit den dort vorhandenen Belastungsfaktoren für die Prävention als unerlässlich erscheint (BMASK, 2017).
Zusätzlich kann beobachtet werden, dass es in einer zunehmend dynamischeren und schnelllebigen Welt manchen Organisationen besser gelingt, ihre Funktionsfähigkeit und innere Struktur angesichts dramatischer Veränderungen zu bewahren und sogar gestärkt aus Krisen hervorzugehen, als anderen (Weick & Sutcliffe, 2010). Die Förderung einer widerstandsfähigen und gesundheitsbewussten Unternehmenskultur nimmt somit in den heutigen Unternehmen im Hinblick auf Wettbewerbsfähigkeit und weitere Herausforderungen wie alternde Belegschaft und Fachkräftemangel eine zunehmend strategische Bedeutung ein (Fisch, 2013). Trotz der Aktualität des Themas scheint es kaum allgemein anwendbare Lösungsstrategien für diese Problemstellung zu geben. Ein präventiver Ansatz im Bezug auf Burnout entwickelt sich demnach zur Schlüsselkompetenz, nicht nur für die Unternehmensführung, sondern auch für die einzelnen Mitarbeiter*innen.
Wird von Burnout im Kontext von Unternehmen gesprochen, gilt es, jene Voraussetzungen näher zu betrachten, die für eine Organisation und ihre Belegschaft wichtig sind, um auch in schwierigen Zeiten Handlungsalternativen zur Verfügung zu haben, damit Herausforderungen zeitnah und zukunftsorientiert gelöst werden können. In der früheren Industriegesellschaft stand die sachliche Ebene für den Geschäftserfolg im Vordergrund und es galt, Maschinen und Technik zu optimieren. In der heutigen Wissensgesellschaft stellen jedoch der Mensch, seine kognitive und kreative Leistungsfähigkeit sowie die Beziehungen zwischen den Akteuren im Unternehmen die ausschlaggebenden Faktoren dar (Bertelsmann Stiftung, 2015). Das Bedürfnis nach schnellen Resultaten und Abschlüssen um jeden Preis führt zu permanentem Zeitdruck und Stress sowie nachweislich schlechteren Ergebnissen (Melchers & Plieger, 2017). Die aktuelle Schnelllebigkeit und die generationsbedingten Werteverschiebungen, in denen kaum mehr Platz für Geduld, Berechenbarkeit und Akzeptanz von Unsicherheiten existiert, fördern diese Symptome und machen eine umfassendere Betrachtung auf der sachlichen und menschlichen Ebene notwendig (Böhle & Busch, 2012). Die Stärkung der Widerstandsfähigkeit („Resilienz“) durch primärpräventive Maßnahmen kann hierbei als eine wichtige Ressource angesehen werden. Für die Entwicklung einer zielführenden Unternehmensstrategie haben Stressprävention und Resilienzfähigkeit somit Priorität und der Erhalt der psychischen und körperlichen Gesundheit stellt heute eine gesamtgesellschaftspolitische Aufgabe dar.
Mit diesem Buch verfolgt der Autor das Ziel, einerseits auf den in der Literatur beschriebenen theoretischen Hintergrund von Stressfaktoren und Burnout sowie deren organisatorische Bedeutung im Unternehmen einzugehen und andererseits Handlungsempfehlungen aufzuzeigen, die sich in der Praxis als wirksam erweisen und verwertbare Ansätze primärpräventiver Maßnahmen für Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen darstellen könnten.
1.1. Burnoutrelevanz für „Young Talents” und der „Healthy-Worker-Effekt”
Laut aktuellen Forschungsergebnissen wird Burnout meistens durch Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz ausgelöst, weswegen eine gleichzeitige Betrachtung mit den dort vorhandenen Risikofaktoren für die Prävention als unerlässlich erscheint. In der Repräsentativerhebung des BMASK, 2017, zur Prävalenz des Burnout-Syndroms in Österreich ergibt sich folgende Zuordnung der Prävalenzzahlen: 19% Problemstadium, 17% Übergangsstadium sowie 8% Burnout-Erkrankungsstadium. Die daraus resultierenden Kosten für Betriebe und Wirtschaft sind signifikant, Tendenz steigend. Es wird somit deutlich die Notwendigkeit eines differenzierten, sowohl an das Individuum als auch an die Institutionen angepassten, graduierten Vorgehens zur Burnout-Prophylaxe belegt.
Aus der Sicht der besonders gefährdeten Altersgruppen findet sich in der Gruppe der unter 30-Jährigen ein besonders hoher Anteil an Personen im Burnout-Erkrankungsstadium, welcher mit zunehmendem Alter wieder geringer wird und ab dem 50. Lebensjahr wieder ansteigt. Erst nach dem 59. Lebensjahr sinkt das Erkrankungsrisiko wieder. Auch weisen die 30-bis 39-Jährigen beim Faktor der Distanzierungsfähigkeit, die für die Regeneration von zentraler Bedeutung ist, die schlechtesten Werte auf. Dies ist insofern plausibel, da gerade in diesem Lebensabschnitt die Weichenstellungen für das weitere (Berufs-)Leben erfolgen und der Druck am Arbeitsplatz entsprechend groß ist. Deshalb sollte gerade in der Altersgruppe der jungen Mitarbeiter*innen mit Maßnahmen der Prävention die Kompetenz hinsichtlich der Fähigkeiten der Distanzierung vom Arbeitsalltag, der Psychohygiene auf Persönlichkeitsebene und des Aufbaus interner und externer Ressourcen gestärkt werden, um eine Trendumkehr im späteren Erwerbsalter zu bewirken (BMASK, 2017)1. Die WHO definiert den Begriff des „aging worker“ ab einem Alter von 45 Jahren, womit die Grenze zwischen jüngeren und älteren Mitarbeiter*innen etwa bei 40 bis 45 Jahren gezogen werden kann.
Für die zum Thema der Distanzierungsfähigkeit beschriebene Gruppe der heute 30- bis 39-Jährigen, im Kontext der Unternehmen oft als „Young Talents“ oder Generation Y (Millennials) bezeichnet, stellt der Beruf eine entscheidende Stütze des Selbstkonzeptes dar (Myers & Sadaghiani, 2010). Die fortschreitende Individualisierung der Arbeit mit dem Leitbild „Unternehmerische Arbeitskraft“ und überzogenes Konsumdenken treiben das Burnout-Risiko gemeinsam mit dysfunktionalen Glaubenssätzen wie: „Du kannst alles schaffen!“ entsprechend an (Väth, 2011).
Um sich mit zunehmendem Alter eine überdurchschnittliche Gesundheit und eine starke Arbeitsmotivation zu erhalten, sind präventive Maßnahmen und Bewusstseinsbildung für das Thema Burnout und seine Konsequenzen unerlässlich. Dieser „Healthy-Worker-Effekt“ kann immer dann beobachtet werden, wenn gesundheitliche Indikatoren mit der Altersstruktur der Beschäftigten in Bezug gebracht werden. Berechnungen für die Verlaufsszenarien von Burnout zeigen deutlich, dass damit verbundene volkswirtschaftliche Kosten signifikant höher ausfallen, je später der Diagnosezeitpunkt eintritt (Biffl et al., 2011)2. Da auch die psychosozialen Belastungen mit zunehmender Intensität und Dauer exponentiell steigen, ist eine frühe Intervention somit entscheidend und ein präventiver Ansatz im Bezug auf Burnout, um zu vermeiden, dass eine Erkrankung überhaupt erst auftritt, entwickelt sich demnach zur Schlüsselkompetenz, nicht nur für die Unternehmensführung, sondern auch für jede*n Einzelne*n (Wirtz, 2010).
Trotz der Aktualität des Themas scheint es kaum allgemein anwendbare Lösungsstrategien für diese Problemstellung zu geben. Psychische Belastungsfaktoren innerhalb der Belegschaft von Unternehmen werden im Zuge des BGM überwiegend jährlich als „Snapshot“ mit Selbstbeurteilungsfragebögen, z. B. nach dem Maslach Burnout Inventory (MBI), erfasst. Viele Konzepte nationaler Programme und Initiativen von Wirtschafts- und Regierungsvertretungen zum Burnout-Syndrom in Österreich setzen den Fokus darauf, die im Risikostadium befindlichen älteren Mitarbeiter*innen im Arbeitsleben zu halten beziehungsweise nach überwundener Erkrankung wieder einzugliedern. Spezifische Betrachtungen der stressauslösenden Faktoren für jüngere Mitarbeiter*innen und darauf aufbauende Maßnahmen im Rahmen der Primärprävention sind jedoch in bisherigen Studien wenig behandelt. Gezielte Instrumente zur Fremdbeurteilung oder qualitative Interviewverfahren unter Beachtung von individuellen oder organisationalen Dynamiken und Interdependenzen werden eher selten eingesetzt (BMASK, 2017; BMASK, 2019).
Auf Grund dieser empfundenen Defizite bildet der Zusammenhang zwischen praxisrelevanten Stressfaktoren bei jungen Mitarbeiter*innen und der Effektivität primärpräventiver Maßnahmen zum Zweck der frühzeitigen Vorbeugung von Erschöpfungskrankheiten alias Burnout im Kontext eines Unternehmens den Untersuchungsgegenstand in diesem Buch ab. Sozusagen gilt es, zugehörige Wirkfaktoren bei der Entwicklung vom „Young Talent“ zum „Healthy Worker“ zu erforschen.
1.2. Das Forschungsvorhaben als roter Faden zur Prävention
Aus der beschriebenen Problemstellung und der daraus resultierenden Forschungsidee möchte der Autor der Problematik von praxisrelevanten Stressbelastungen bei jungen Mitarbeiter*innen und der Wirksamkeit gleichzeitig verfügbarer Bewältigungsmaßnahmen in einem Forschungsprozess nachgehen. Der Betrachtungszeitraum dieser Studie bezieht sich dabei in einem Review auf ein aktuelles, repräsentatives Kundenprojekt eines spezifischen IKT-Unternehmens und konzentriert sich vor allem auf die frühe Phase der Primärprävention, das heißt auf mögliche Maßnahmen, die verhindern, dass eine Erkrankung überhaupt auftritt.
Die zu diesem Zweck durchgeführte Praxisuntersuchung wird von folgender Forschungsfrage motiviert:
„Welche Stressfaktoren werden von jungen Mitarbeiter*innen im Rahmen eines Kundenprojektes als besonders belastend empfunden und was sind die Gründe dafür? Inwiefern wird diesen Belastungen nach Einschätzung der Befragten mit den angebotenen primärpräventiven Maßnahmen entsprochen beziehungsweise welche Maßnahmen fehlen oder müssten noch ausgebaut werden?“
Als Zielsetzung soll dieses Forschungsvorhaben in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung von Leistungsfähigkeit und Resilienz innerhalb der Belegschaft eines Unternehmens:
Die für junge Mitarbeiter*innen praxisrelevanten Stressfaktoren und deren Hintergründe ermitteln.
Die dazu subjektiv entweder als wirkungsvoll erlebten, fehlend wahrgenommenen oder noch auszubauenden primärpräventiven Maßnahmen im Unternehmenskontext darstellen.
Etwaige andere in diesem Zusammenhang in Anspruch genommene primärpräventive Maßnahmen (z. B. von externen Institutionen) aufzeigen.
Basierend auf diesen Ergebnissen entsprechende Handlungsempfehlungen zu zielgerichteten institutionellen oder individuumszentrierten Maßnahmen für das Unternehmen und seine Mitarbeiter*innen ausarbeiten.
Im Zuge der Analyse wurden demnach im ersten Forschungsabschnitt die Erfahrungswerte aus der Praxis erhoben und kategorisiert. Dazu wurden mittels Interviews Praxisreflexionen, basierend auf den individuellen Erfahrungen von jungen Mitarbeiter*innen im Zuge der Projektarbeit, durchgeführt, um die zugehörigen Stressfaktoren und existierenden primärpräventiven Maßnahmen herausarbeiten und kategorisieren zu können. Diese wurden im darauffolgenden zweiten Abschnitt mit den Ergebnissen einer hermeneutischen Analyse zu Theorieaspekten undModellen aus der Literatur abgeglichen, um daraus Schlüsselkategorien zu bilden. In dieser Gegenüberstellung der erhobenen Kategorien konnten etwaige Zusammenhänge oder Gemeinsamkeiten zwischen dem erlangten theoretischen Wissensstand und der individuellen Sicht der Praxisquellen für den spezifischen Unternehmenskontext ermittelt und daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Da primärpräventive Maßnahmen zu Erschöpfungskrankheiten im Unternehmensumfeld nicht nur als Einzelaspekt, sondern in einem ganzheitlichen Zusammenhang gesehen werden sollten (Fengler & Sanz, 2011), können die Forschungsergebnisse gleichzeitig als Feedback für etwaige Personal- und Organisationsentwicklungsprozesse dienen. Im Idealfall kann diese Arbeit auch einen roten Faden zum Thema der Vorbeugung von Erschöpfungskrankheiten junger Mitarbeiter*innen für die Beratung oder das Management in anderen Unternehmen anbieten.
1.3. Zum weiteren Aufbau und Inhalt des Buches
Im Anschluss an diese Einleitung widmet sich Kapitel 2 zuerst der Einführung in das eigentliche Thema dieses Buches. Dabei wird zum einen die Problematik Stressbelastung und Burnout, zum anderen das Zusammenspiel von Resilienz und Prävention beleuchtet. In weiterer Folge wird der Bezug zur Wirtschaft und den Unternehmen hergestellt, und in Kapitel 3 wird die Thematik für die Ebene der Organisation, der Teams und des Individuums betrachtet und werden erste Kategorien für die weitere Untersuchung aufgezeigt. Kapitel 4 widmet sich der empirischen Forschungsarbeit, Methodik und Design zur qualitativen Erhebung sowie Aufbereitung und Auswertung der in der Praxis analysierten Fälle werden dort beschrieben. Daran anschließend folgt in Kapitel 5 zur Beantwortung der Forschungsfrage zunächst die Betrachtung der Themenschwerpunkte von der Reflexion der Praxisergebnisse und ihrer Gegenüberstellung mit der Theorie hin zu den analysierten Schlüsselkategorien und den dazu erhobenen Stressfaktoren. Anschließend werden Handlungsempfehlungen in Bezug aufprimärpräventive Maßnahmen abgeleitet. Die Interpretation und kritische Diskussion der Forschungsergebnisse sowie Zusammenfassung und Ausblick im Sinne des Ziels der Forschungsarbeit bilden den Schlussteil dieses Buches.
In den Anhängen finden sich ergänzende Zusatzinformationen beziehungsweise Details zur Forschungsarbeit, wie Abstract, Informationen und Tabellen zu den Projektphasen, Interviewleitfäden, Transkriptionen und Kategorientabellen sowie Hilfestellungen für Coaching und Intervention.
1 Verfasser: Österr. Gesellschaft für Arbeitsqualität und Burnout / Anton Proksch Institut Wien.
2 Donau-Universität Krems, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung. Im Auftrag der
2 Donau-Universität Krems, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung. Im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien.
2. Theoretische Hintergründe zum Burnout-Syndrom
Allem voran steht die Theorie. In diesem Kapitel werden unterschiedliche Literaturquellen zum Thema Burnout-Vermeidung analysiert, um einerseits einen Überblick über die derzeitige Sichtweise zu erhalten und andererseits die Praxisuntersuchung starten zu können. Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl sowohl auf die entsprechende Nähe zum Forschungsthema im Kontext zu Stressfaktoren bei jungen Mitarbeiter*innen als auch auf in diesem Zusammenhang beschriebene mögliche primärpräventive Maßnahmen gelegt. Unter diesen Gesichtspunkten soll zunächst der theoretische Hintergrund zu den in diesem Buch verwendeten Begriffen Burnout und Stress sowie Prävention und Resilienz betrachtet werden.
2.1. Folgen aus dem Zusammenhang von Burnout und Stress
Burnout ist kein neues Phänomen, sondern geschichtlich betrachtet so alt wie die Menschheit und in allen Kulturen, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen, vorhanden. Es finden sich unzählige Beispiele in der Literatur und im Internet sowohl in Form von Ratgebern als auch zu Erkenntnissen aus der Forschung (z. B. Thomas Mann, Shakespeare, Graham Greene), Philosophie (z. B. Wittgenstein) bis hin zum Alten Testament (Buch Mose). Eine Prägung erfuhr der Begriff durch Freudenberger, 1973, der in seiner aufreibenden Arbeit als Psychiater im sozialmedizinischen Bereich in New York das Phänomen am eigenen Leib erfuhr, analysierte und sich schließlich selbst helfen konnte, denn Burnout-Ratgeber und -Therapien gab es zu dieser Zeit noch nicht.
Trotz dieser Historie fällt es heute immer noch schwer, eine einheitliche und allgemein akzeptierte Definition des Burnout-Syndroms in der Medizin oder Psychologie zu finden (Burisch, 2010). Es bedingt somit einer Zusammenfassung gleichzeitig vorliegender, unterschiedlicher Symptome und deren Abgrenzung zu anderen Begriffen wie z. B. Mobbing, Depression, Belastung, Veränderungskrisen.
Im ICD-10 (International Classification of Diseases) der WHO ist Burnout nicht als Krankheit, sondern als Faktor, „der den Gesundheitszustand beeinflusst und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen kann“, definiert. Allerdings soll Burnout künftig in die neue Klassifikationsliste mit dem Namen ICD-11 (2022) als Syndrom von „chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet wird“, aufgenommen werden. Dies ist ein wichtiger Schritt, denn erst durch die Aufnahme wird eine eindeutige Diagnose und korrekte Zuordnung von Behandlungsformen ermöglicht. Zudem weist die WHO darauf hin, dass der Begriff Burnout ausschließlich im beruflichen Zusammenhang und nicht „für Erfahrungen in anderen Lebensbereichen“ verwendet werden sollte, um Überschneidungen mit Begriffen wie z. B. Depression zu vermeiden (ICD-10 WHO, 2019). Im Bezug zu Schwierigkeiten in der Lebensbewältigung durch Burnout werden im ICD-10 unter anderem folgende Probleme benannt:
„Ausgebrannt sein“, Zustand der totalen Erschöpfung
Einschränkung durch Behinderung
Körperliche oder psychische Belastung
Mangel an Freizeit und Entspannung
Soziale Rollenkonflikte oder fehlende Fähigkeiten
Stress.
Aus Ressourcenperspektive lässt sich das Burnout-Syndrom als chronischer Prozess psychischer und physischer Erschöpfung und damit verbundenen Symptomen beschreiben. Drei Symptomdimensionen lassen sich zur Diagnose grundsätzlich an Hand von Fällen Betroffener charakterisieren (Maslach & Leiter, 2001; Meckel, 2010):
Emotionale Erschöpfung
Reduzierte Leistungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit
De-Personalisierung und Zynismus („Entfremdung“).
Ergänzend nennt Musalek, 2012, dass sich Betroffene durch den Verlust von Attraktivität und Möglichkeiten zur Veränderung oder Verbesserung als „Gefangene der Situation“ wahrnehmen.
Das Modell der Allostase3 aus der Stressforschung beschreibt dazu die Problematik einer Aufladung, die sich auf Grund permanenter Stresseinwirkung nicht wieder entladen kann (Lauterbach, 2008). Als die Hauptursachen von Stress werden ein Überschuss oder Entzug von Information und die subjektive Bewertung der Lage und Gefahren beschrieben. Die zugehörigen Stressoren unterliegen der individuellen Wahrnehmung und persönlichen Bewertung durch die Person oder Organisation. Sie sind dafür ausschlaggebend, ob es schlussendlich zu einer Stressreaktion und daraus resultierenden Stressfolgen kommt oder nicht (Burisch, 2010). Permanenter Stress führt zu Einschränkungen der Wahrnehmung, Handlungsblockaden und Erschöpfung. Die Symptome können sich in körperlichen Schäden, psychosomatischen Erkrankungen, psychischen Reaktionen sowie Verhaltensänderungen zeigen und sich durch ungenügende Bewältigungsstrategien von selbst aufrechterhalten. Dieses Missverhältnis zwischen Stress auslösenden Anforderungen und individueller Kontrollierbarkeit wird als fehlende Selbstwirksamkeit erlebt und begünstigt in einem „Teufelskreis“ (siehe Abbildung 1) die Entstehung von Burnout (Karasek & Theorell, 1990).
Abbildung 1: Burnout-Teufelskreismodell (Quelle: eigene Darstellung nach BMASK, 2017)
Das Wechselspiel von psychischen Faktoren und Belastungen im Arbeitskontext beziehungsweise im privaten Umfeld kann sich somit für die Burnout-Entwicklung als maßgeblich herausstellen. Im Anforderungs-Kontroll-Modell („Job-strain-Modell“) klassifizieren Karasek und Theorell, 1990, diese psychischen Faktoren und Belastungen anhand der zwei Dimensionen der Arbeitsanforderungen an die Person sowie des für die Aufgabe vorhandenen Entscheidungs-Kontrollspielraumes in die vier Dimensionen „passive jobs“, „low-strain jobs“, „high-strain jobs“ und „active jobs“ (siehe Abbildung 2).
Daraus lassen sich in weiterer Folge Lösungsansätze zur Verminderung psychischer Belastungen ableiten. Denn während sich die Dimensionen mit hohem Entscheidungsspielraum und somit hoher Selbstwirksamkeit eher positiv auf die psychische Gesundheit und Resilienzfähigkeit auswirken, bilden die beiden anderen Dimensionen klassische Beispiele für den in Abbildung 1 beschriebenen stressinduzierten Teufelskreis mit erhöhtem Krankheitsrisiko ab. Gerade Parameter wie Zeitdruck, Hektikund widersprüchliche Anforderungen tragen hier maßgeblich zu erhöhten Stressbelastungen am Arbeitsplatz bei.
Abbildung 2: Anforderungs-Kontroll-Modell (Quelle: eigene Darstellung nach Karasek & Theorell, 1990)
Kritik an diesem Modell wird vor allem auf Grund der Fokussierung auf das Umfeld der qualitativen und quantitativen Arbeitsanforderungen und somit der fehlenden Beachtung von persönlichen und gesellschaftlichen psychosozialen Faktoren, welche durch die fortschreitende Individualisierung und Flexibilisierung der Arbeit hervorgerufen werden, geübt. Aus diesem Defizit heraus wurde das Modell der beruflichen Gratifikationskrise („Effort-reward-inbalance-Modell“) entwickelt, das in Kapitel 2.2. vorgestellt wird (Siegrist, 1996).
Zur Beschreibung des Burnout-Verlaufs gibt es zahlreiche Phasenmodelle, von denen hier das häufig verwendete Modell von Freudenberger und North, 1992, genannt werden soll, das 12 Phasen des Burnout-Prozesses aufzeigt.
Die 12 Phasen des Burnout-Prozesses sind:
Idealistische Begeisterung (Zwang, sich zu beweisen)
Verstärkter Einsatz (für Ziele)
Subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse
Verdrängung von Konflikten
Umdeutung von Werten
Verleugnung von Problemen
Rückzug aus der Umwelt
Verflachung des Lebens (deutliche Verhaltensänderung)
De-Personalisierung (Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit)
Innere Leere
Depression und Erschöpfung
Zusammenbruch (völlige Burnout-Erschöpfung).
Der Verlauf und die Dauer des Prozesses sind in der Praxis individuell verschieden, genauso wie eine Zuordnung von Fall zu Fall unterschiedlich ausfällt. Die psychischen Auswirkungen durch die gestörte Anpassung von persönlicher Intention und beruflicher Realität entwickeln sich dabei sukzessive und oft lange Zeit unbemerkt. Eine Unterbrechung kann in jeder Phase erfolgen, je früher, desto kürzer fällt die Regenerationszeit aus.
Zusammenfassend beschreiben alle Burnout-Modelle einen Prozessverlauf, der durch Anpassungs- beziehungsweise Anforderungsproblematiken im privaten und beruflichen Umfeld hervorgerufen werden kann. Analog zum Thema dieses Buches sollte daher der rechtzeitigen Entwicklung von entsprechenden Ressourcen und Präventionsmaßnahmen eine große Bedeutung zukommen.





























