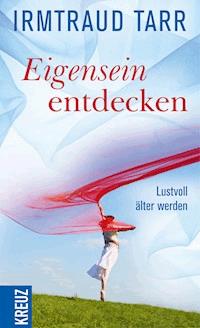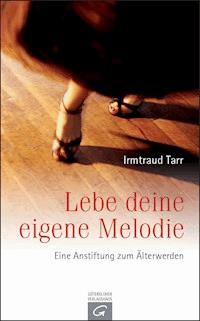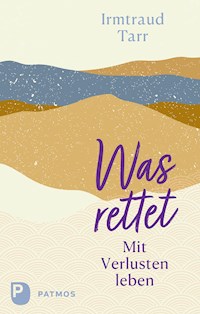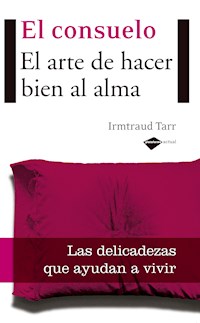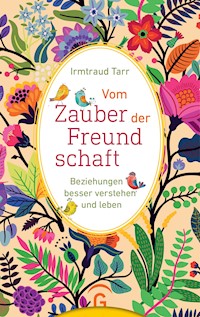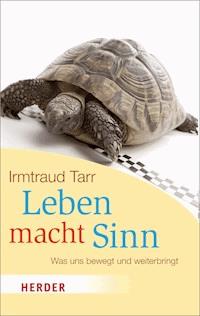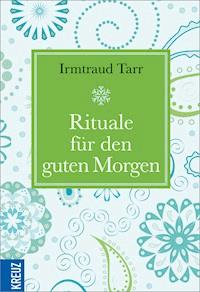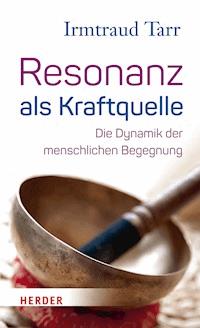
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie sehen mich die anderen? Und wie möchte ich gesehen werden? Wir alle brauchen Resonanz, um uns selbst zu erkennen und unsere Persönlichkeit zu formen. Statt fester Identitätskonzepte „Sei, wer du bist!" zeigt Irmtraud Tarr, dass Resonanz dynamisch ist und in der Begegnung stattfindet. Identität ist formbar, wir werden zu dem, womit wir in Resonanz stehen. Und das können wir lenken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: wunderlichundweigand, Stefan Weigand
Umschlagmotiv: © istock
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster, Belgern
ISBN (E-Book) 978-3-451-80764-0
Inhalt
Vorwort
I Sehnsucht Resonanz
Resonanz rettet
Resonanz – was ist das?
Das Beste wiedergewinnen
Schaut mich an!
Resonanz ist mehr als Echo
Spieglein, Spieglein macht Resonanz
Mitfühlende Resonanz
Resonanz suchen
II Resonanz – einander begegnen
Einander Bedeutung schenken
Lebendigkeit kommt in vielen Gewändern
Gleiche Wellenlänge
Resonanz ist geteiltes Glück
Resonanz weitet die Seele
Dazugehören
Es geht nicht ohne die anderen
Wo sind wir, wenn wir lieben?
III Resonanzproviant
Gespräche bringen Licht
Schweigen
Lächeln
IV Resonanzschattenseiten
Bewundern
Wenn die Resonanz ausbleibt
Andere beeinflussen uns
Narzissmus und Resonanz
Langeweile verhindert Resonanz
In der Abwärtsspirale
Misstrauen
»Ich hasse dich abgöttisch«
V Resonanz ist schwingende Veränderung
Stimmungen stecken an
Aufeinander zugehen
Resonanz erzeugt Veränderung
Wie Glühwürmchen blinken
»Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus«
»Tu Gutes und rede darüber«
»Wer hat, dem wird gegeben«
VI Resonanz für das Gute
Resonanz ist Talent für Glück
Bewegung und Resonanz
Wer singt, dem wird Resonanz gegeben!
Kunst intensiviert das Daseinsgefühl
Sehnsuchtsort Insel
Resonanz mit den Sternen
»Ein Land, in dem unsere Tränen getrocknet werden«
VII Resonanzimpulse
Weichen stellen
Beziehungen pflegen
Etwas tun
Interesse pflegen
Etwas lassen
Sich selbst pflegen
Treibhaus der Resonanz
Glücklicher Ausklang
Literatur
Vorwort
»Nimm ab, wenn du da bist!«, »Du wolltest mich doch zurückrufen!«, »Kannst du später anrufen, ich muss gerade etwas Wichtiges erledigen!«
Das sind Sätze, die wohl jeder mehr oder weniger schmerzlich kennt. Sie haben eines gemeinsam: Sie erinnern uns an die Erfahrung, abgewiesen, ferngehalten, weggedrückt, abgeschoben zu werden. Auf die Frage »Ist jemand da?« bekommen wir heute nicht mehr selbstverständlich eine Antwort. Wir erwarten sie auch nicht. Vielleicht weil wir selbst auch oft nicht antworten. Ist es nicht paradox, dass wir trotz unzähliger Kommunikationsmöglichkeiten nicht mehr in einer antwortenden Welt leben? Oder vielleicht gerade deswegen.
»Die Welt ist eine große Cafeteria«, meinte Woody Allen. Wird unsere Welt immer lauter, dass wir einander nicht mehr zuhören? Wird unsere Gesellschaft immer einsamer? Sind wir zu Einzelkämpfern geworden? Geht es unterm Strich nur noch um den Einzelnen? Wer diese Einstellung vertritt, der wird den Ausdruck »Resonanz« (von lat. resonare »widerhallen, mitschwingen«), bekannt aus der Physik oder Musik, in einem zwischenmenschlichen Kontext erstaunlich finden.
Die These, die ich in diesem Buch aufstelle, lautet, dass wir zu dem werden, womit wir in Resonanz stehen. Unsere Identität entsteht nicht durch angestrengte Innenschau oder feste Konzepte wie (»Werde, der du bist!«), sondern indem wir uns fragen: »Womit stehe ich in Resonanz? Was bewegt, ergreift, berührt mich? Was verwandelt und führt über mich selbst hinaus?« Darüber hinaus ist Resonanz von großer Bedeutung für unsere Beziehungen zu anderen. Wir haben die Freiheit und Chance, einander zu beleben, indem wir uns mitschwingend, antwortend, empfangend, berührend begegnen und anstecken. Resonanz ist überaus wertvoll als Quelle der Selbsterkenntnis und der Freiheit. Und vielleicht gelingt es mit Resonanz, dieses »Unterm Strich zähle ich« zu überwinden und füreinander ein gutes Gehör zu entwickeln.
In der Physik bedeutet Resonanz, dass zwei Elemente mit einer ähnlichen Frequenz schwingen können. Resonanz entsteht, wenn ein schwingungsfähiges System durch eine Anregungsfrequenz nahe seiner Eigenfrequenz angeregt wird. Dies zeigt sich eindrücklich am Resonanzkörper einer Geige, der durch die schwingende Saite zu Schwingungen angeregt wird. Nicht nur die Musik lebt vom Zurück-Tönen, Mit-Tönen, von Einklang, Gleichklang, Widerhall. Auch wir Menschen. Ich beobachte sogar, dass sich heute eine seelische Landschaft auftut, die durch eine verzweifelte Suche nach sozialer Resonanz, Aufmerksamkeit und Anerkennung gezeichnet ist. Menschen wollen sich zeigen, um wahrgenommen zu werden, sie wollen ausdrücken, was in ihnen steckt. Sie verlangen nach Beachtung und Spiegelung von den anderen. Ohne Resonanz kann und will kein Mensch existieren. Die Resonanz mit all ihren Facetten, in der die Welt als antwortende, berührende, tragende, mitschwingende erlebt wird, ist grundlegend, da wir als Einzelwesen und Vereinzelte nicht überleben können. Deswegen ist Resonanz nicht Begleitmusik, sondern ein lebensspendendes Fundament, auf dem unser Leben spielt.
Resonanz existiert nicht nur als privates Phänomen im Dialog von Menschen, sondern fließt auch in gesellschaftliche Institutionen ein: Schulen, Universitäten, Krankenhäuser. Im Streik der Erzieherinnen, bei dem es um bessere Bezahlung ging, fiel immer wieder das Wort »Wertschätzung«. Das gilt für alle Berufe vom Taxifahrer bis zum Musiklehrer. Unsere Größe und unsere Schwäche hängen von unserem Bedürfnis nach Resonanz und Spiegelung in anderen ab. Wir benötigen einander als Resonanzkörper. Das gilt sowohl im Guten wie im Schlechten: Auch in unseren Feinden widerspiegeln wir uns, erhalten wir Resonanz. Auch sie sind Teil dessen, was uns ausmacht.
Für alle Lebenslagen gibt es reichlich Literatur, nur für eines wenig: den Umgang mit Resonanz (Rosa 2005). Natürlich existieren unzählige Ratgeber für Manager, Lehrer, Studenten, Frauen, Kinder, Verliebte, Verlassene. Unterm Strich geht es aber meist darum, wie wir am geschicktesten unsere Ziele erreichen. Zweckfreies Verhalten oder Tun scheinen nicht vorzukommen, allenfalls sind es Ratgeber zum Entspannen, um dann gut erholt neue Ziele erreichen zu können. Nicht das Verhalten selbst, sondern das Ziel soll glücklich machen.
Dieses Buch will etwas anderes. Es beleuchtet das Phänomen der Resonanz nicht zielführend, strategisch eingesetzt, sondern als etwas, das sich zwischen Menschen ereignet. Resonanz geschieht, wenn sich die seelischen Frequenzen zwischen Menschen annähern: im Miteinander, beim Lesen von Gedichten, beim Musizieren, beim Musikhören, in Galerien. Von klein auf begleitet uns dieses Resonanzbedürfnis. Es ist so menschlich und gleichzeitig so störanfällig. Nämlich dann, wenn wir einander als Mittel zum Zweck, als Ressource sehen und nicht als Gegenüber.
Man kann die Nase darüber rümpfen, dass die neuen Resonanzarenen, all die interaktiven Formate des Fernsehens mit ihren Talk- und Realityshows, die Chatrooms, Blogs und Smartphones, heute im sprichwörtlichen Sinn wie Pilze aus dem Boden schießen. Was früher nur den Mächtigen, Reichen, Schönen vorbehalten war, kann heutzutage jeder haben: sich öffentlich zeigen, gesehen werden und mit anderen in Verbindung treten. Bevor wir zeitdiagnostisch urteilen und bewerten, sollten wir besser verstehen, wie Menschen heute in Beziehungen leben. Und wie sie sich mit den Fragen auseinandersetzen: Wer bin ich? Wer will ich sein? Wie werde ich gesehen und wie sehe ich mich selbst?
Menschen versuchen, sich selbst zu vergewissern. Dahinter steht der Wunsch nach Kontakt, Begegnung und Rückmeldung – nach Resonanz. In der Erwartung, von anderen gesehen zu werden, zeigt man nicht nur, wie man ist oder gern sein möchte; man erhofft vor allem Antwort und Resonanz aus der Umwelt. Wir alle brauchen solche Antworten, weil wir Auskunft über uns selbst benötigen, weil wir ein »Jemand« sein wollen. Wir suchen und finden Resonanz, weil wir beachtet und gespiegelt werden wollen, um unsere Persönlichkeit zu entwickeln, zu gestalten und zu verändern. Resonanz ist persönlichkeitsbildend. Es trifft uns alle, deswegen klammere ich niemanden aus und kann nur sagen: Es ist von einem weiblichen Menschen geschrieben – für Menschen.
ISehnsucht Resonanz
Resonanz rettet
Die Welt heute ist ein lauter, schneller, medialer Ort geworden. Allgewaltig sind die Geräusche der Umwelt, der Lärm im Straßenverkehr und am Arbeitsplatz, das unaufhörliche, unentrinnbare Gerede der Menschen, das von den Medien unendlich verstärkt wird. Ganz zu schweigen von der entfesselten Kommunikationsflut, in der alles viel zu schnell geht, bei der man nur mitkommt, wenn man selbst mitrennt. Wir sind Teil dieser Lebenswelt, aus der wir nicht hinausfallen wollen. Es ist zwar unendlich viel möglich, aber es gibt keine Orientierung mehr. »Das musst du selbst entscheiden!«, sagen die Alten. »Keine Ahnung!«, »Weiß ich auch nicht!«, sagen die Jungen.
»Die Welt ist kalt, arschkalt«, seufzte ein Student. Steckt hinter diesem Seufzen nicht ein tiefer Wunsch? »Menschen bestehen darauf, das Beste wiederhaben zu wollen«, so drückt es der Philosoph Peter Sloterdijk aus (Sloterdijk 2007). Diesen Wunsch deute ich als tiefes Bedürfnis nach Resonanz. Wir sind nicht nur Objekte, sondern zugleich Subjekte dieses Wandels und wollen die eigene Sehnsucht nach einer Antwort, nach Anerkennung aktiv mitgestalten. Wir wollen nicht nur applaudieren, sondern auch selbst Beachtung und Resonanz finden, weil wir uns danach sehnen, getragen, gehalten und gewollt zu sein. Auch wenn wir mit der rasanten Beschleunigung und Modernisierung oft hadern und am liebsten das Rad der Geschichte zurückdrehen würden, so haben wir heute viel stärker als früher die Chance, unsere Begegnungen, Aufgaben, Dinge und Herausforderungen so zu gestalten, zu verändern oder neu zu entwerfen, dass wir Resonanzerfahrungen machen.
Resonanz ist lebenswichtig. Schneller als jedes Wort ruft es zum anderen: Ich bin da! Ich sehe dich! Ich höre dich! Ich spüre dich! Vielleicht fühle ich mich ähnlich wie du, die nur eine Stimme bräuchte nach einem langen, anstrengenden Tag. Wer auf das Gesicht, die ausgesprochene oder unausgesprochene Frage antwortet, stößt Resonanz an, die den anderen in einen Austausch lockt. Nicht nur der Chef ist wohlgelaunt, wenn seine Resonanzangebote erwidert werden, auch das Baby in der Kinderwiege strahlt, wenn plötzlich das Gesicht der Mutter erscheint. Jede Geste des Antwortens ist die unmissverständliche Aufforderung: Sei willkommen! Ich brauche dich! Ich mag dich! Spontan lächeln wir, wenn uns jemand anlächelt. Man müsste schon sehr aggressiv gestimmt sein, um nicht zurückzulächeln, weil Lächeln ansteckend ist. So wie jede Geste der Resonanz ein Element der Ansteckung enthält. Wer Resonanz schenkt, gibt nicht nur Zuwendung. Er heißt willkommen und beschwichtigt, weil Resonanz den anderen entspannt, weil wir Solidarität spüren. Ohne ein Wort ist klar: Du bist nicht allein!
Resonanz – was ist das?
In meinen Seminaren an der Salzburger Universität Mozarteum stellte ich meinen Studenten diese Frage. Ich zitiere einige ihrer Einschätzungen:
•»Wenn ich mit jemanden die gleiche Wellenlänge habe«•»Wenn mehrere Gleichgesinnte Gedanken aussenden«•»Wenn ich gehört werde«•»Wenn wir uns konzentrieren auf das, was jetzt das Wichtigste ist«•»Wenn ich mit jemandem eins werde«•»Wenn ich für jemanden bete«•»Wenn wir uns aufeinander einstimmen«•»Wenn wir zusammen atmen«•»Wenn wir im Chor gemeinsam singen«•»Wenn wir über das Gleiche lachen«•»Wenn wir einander beim Spielen finden und ›es‹ uns spielt«•»Wenn ich nach meinem Auftritt einen unverhofften, anerkennenden Brief erhalte«•»Wenn mir jemand sagt, wie mein Spielen nachgewirkt hat«•»Wenn ich jemanden inspiriert habe, selbst zu spielen«•»Wenn sich jemand nach einem gemeinsamen Essen bei mir herzlich bedankt«•»Wenn mir jemand über die Schulter streicht, weil er meine Traurigkeit spürt«•»Wenn ich berührt bin, weil etwas mich unmittelbar angeht und betrifft«•»Wenn mich jemand liebt«Vielleicht fallen Ihnen selbst spontan ein paar Resonanzerfahrungen ein. Der Soziologe Hartmut Rosa umschreibt sie treffend als »vibrierenden Draht zum Leben« (Rosa 2013). Sie werden erkennen, dass es diese Erfahrungen gibt, und dass sie Ihr Leben bereichern, auch wenn sie nicht mess- und rechenbar sind. Resonanz ist das, was wir vor allem brauchen – für Körper, Geist und Seele.
Fällt Ihnen nichts ein, so erinnern Sie sich vielleicht, was Resonanz einmal für Sie war: das erlösende Gespräch, das Ballspiel auf der Wiese, die warme tröstliche Hand, der Duft, der Ihnen die Sinne raubte, der warme Sonnenstrahl auf der Haut, der Freund, der im richtigen Moment anruft. All das ist Resonanz, die uns füreinander und das Leben wärmt. Weil wir spüren, wir brauchen sie.
Es tut gut, sich an Resonanzerfahrungen zu erinnern, wenn neue noch nicht oder nicht mehr spürbar sind, wenn Wunden schmerzen oder vernarbte Wunden sich wieder melden. Weshalb? Um sich zu vergegenwärtigen, dass das Leben gütig, wärmend sein kann, auch wenn es momentan eher karg oder einsam ist.
Resonanz ist nicht zufällig ein musikalischer Ausdruck. Beim Musizieren, im Konzert werden Menschen berührt, ergriffen, weil Musik unser Innerstes betrifft, weil die Macht des Klanges uns vom ersten Moment unseres Lebens an aufhorchen ließ. Ob wir musikalisch oder unmusikalisch sind, wir sehnen uns nach Resonanz, die etwas in uns zum Klingen bringt. Ob im Theater, im Film, in Kunst und Natur oder im Dialog mit anderen Menschen. Wir sehnen uns nach Erfahrungen, die uns mit diesem tiefen inneren Ort verbinden, der uns die Welt als antwortende, atmende, berührende erleben lässt, wodurch wir zeitweise das Gefühl des inneren und äußeren Getrenntseins verwischen und abmildern können. Wir fühlen uns belebt, alles Festgefügte verflüssigt sich. Die Grenzen der Dualismen, in denen wir existieren, werden durchlässig: die von Ich und Welt, von Innen und Außen. Wir sind nicht mehr getrennt.
Warum berühren uns solche Erfahrungen, die uns mitschwingen lassen? Musiker nennen sie – voreilig oder nicht – die bessere Welt. Jeder von uns kennt sie, und nicht nur in besonderen Zeiten, auch im Alltag, beim Waldlauf, wenn die Bäume zu uns sprechen, wenn wir eins werden mit dem perkussiven Klang fallender Regentropfen, wenn wir am Strand eine Sandburg bauen, die Stille einer Kirche in uns aufnehmen oder abends bei einem Glas Rotwein Frieden mit der Welt schließen. Bei all dem sind wir sowohl außen als auch innen ganz nahe bei uns selbst. Da brauchen wir nicht das modisch strapazierte Wort »Selbstverwirklichung«, weil wir darüber nicht mehr nachdenken müssen, wenn Innen und Außen miteinander eins werden. In einem Zwischenbereich, in dem sich Realität und Fantasie, Wirklichkeit und Illusion miteinander verbinden. Der Kinderanalytiker D.W. Winnicott nennt ihn »den Übergangsraum«, der uns für Resonanzen empfänglich macht, sowohl für die eigenen als auch für die von außen.
Haben wir nicht alle schon einmal die Feststellung gemacht, dass solche Erfahrungen einem das Vertrauen in das Rettende wieder schenken? Wie jene kleinen Zettel, die wir einander zuschieben, auf denen steht: »Es wird alles gut!« oder »Du schaffst das!« oder »Ich denk an dich!« oder »Ich bete für dich!«.
Jemand erinnert sich: »Ich stürzte – ein anderer half mir wieder auf die Beine.« Er spricht nicht nur von der Anständigkeit, die uns immer wieder überrascht und beglückt, sondern auch von der Erfahrung, dass es zu allen Zeiten und trotz allem erstaunlich viel Resonanz gibt, auch wenn wir fallen.
Das Beste wiedergewinnen
Vom Anfang unseres Lebens an geht es um Resonanz, die uns schon aufhorchen ließ, bevor wir überhaupt das Licht der Welt erblickten. Dieses frühe innere Horchen im mütterlichen Kosmos verband uns mit dem Beat der Mutter, ihren Rhythmen und Gefühlsschwingungen. So begann unser erstes Willkommen in dieser warmen Urhöhle der Resonanz. Dann der erste Schrei in einer Welt, die plötzlich ruhig war, die das Neugeborene in die Arme der Mutter trägt, die mit ihrer Stimme, ihren Blicken und Berührungen antwortet. Es sind die Schwingungen ihrer Stimme, ihr Flüstern, ihr Lauschen und Streicheln, die dem Kind fühlen lehren, dass da jemand ist. Und dass es Wärme, Verlässlichkeit und Resonanz gibt.
»Gut, dass ich da bin«, klingt die Resonanz auf die bergende Zuwendung der Mutter, würde man sie in Worte fassen. Auch die Mutter fühlt sie: »Gut, dass ich da bin.«
Dieses glückselige Mantra empfinden auch Liebende, Verliebte und Freunde, wenn sie einander fühlend erreichen und Resonanz schenken. Gut, dass ich da bin. Gut, dass du da bist. Gut, dass da jemand ist. Gut, dass es uns gibt.
Jedes Kind braucht seine Eltern als Resonanzkörper. Im Austausch mit ihnen erlebt es ein bewegtes, erregendes Wechselspiel zwischen Erwartung und Befriedigung, Spannung und Entspannung, Frage und Antwort. Entsteht Gleichklang, so genießen beide diese genussvolle Bestätigung. Eine Bestätigung, die nicht unterscheidet oder rechnet, wer zuerst gibt und wer zurückgibt. Beide geben und nehmen zugleich, all das, was sie einander geben können. Obwohl in diesem Resonanzkosmos die Rollen höchst ungleich verteilt sind – hier das abhängige Kind, dort die erwachsenen Eltern –, lernen beide miteinander dieses Spiel der Resonanzen mit dem richtigen »Timing« und dem passenden »Matching« aufeinander abzustimmen.
Hier fallen Entscheidungen mit anhaltender Wirkung. Ob nun Atmosphären von Einklang und Gleichklang oder von Dissonanz und Chaos zu Grundatmosphären des Kindes werden, oder ob Gefühle von Vertrauen und Sicherheit, Angst und Unberechenbarkeit, Selbstgewissheit oder Zweifel zu Grundstimmungen werden, das hängt davon ab, wie einfühlsam die Resonanz der Stimmen, Blicke, Berührungen zwischen beiden hin- und herpendeln.
Schon kleine Kinder können unterscheiden, ob die Resonanz auf das, was sie brauchen, liebevoll oder mechanisch ist. Erleben sie immer wieder, dass ihnen versagt wird, was sie brauchen, so entsteht nicht nur Leere, sondern auch Unsicherheit und Angst. Aus der Befriedigung dieser ganz elementaren Bedürfnisse nach Nahrung, Pflege und Beachtung speist sich das Grundgefühl von resonanter Liebe, deren Melodie ganz schlicht lautet: Ich bin getragen, gehalten, gewollt. Aus dieser Resonanz baut sich letztlich das auf, was wir unser »Identitätsgefühl« nennen. Ich bin jemand, nicht nur für mich, auch für die anderen. Diese Grundnahrung hinterlässt ihre Spuren so tief in unseren Gedächtnisspeichern, dass wir darauf bestehen, »das Beste wiederhaben zu wollen« (Sloterdijk 2007). Dieser Wunsch bleibt nicht nur als Sehnsucht, sondern auch als Gewissheit, den Herausforderungen des erwachsenen Lebens gewachsen zu sein. Weil wir früh gelernt haben, dass wir mit der Resonanz der Mitwelt rechnen dürfen.
Schaut mich an!
Es ist ein entscheidender Unterschied, ob Menschen sich zu anderen als Zuschauer verhalten können, oder ob sie immer Mitleidende, Mitfreudige, Mitschuldige sind: Diese sind die eigentlich Lebenden.
(Hugo von Hoffmannsthal 1949)
Diesem Satz von Hugo von Hofmannsthal kann ich nur zustimmen. Wenn andere mir nicht sagen, wer ich bin, werde ich es nicht wirklich wissen. Nicht nur in unseren Freunden, auch in unseren Gegnern spiegeln wir uns wider. Freunde wie Gegner verkörpern, wohin wir gehören. Sie sind unsere Spiegelbilder, wenn auch mitunter verzerrte. Ein junger Mann beschreibt es so: »In mir gärt und brodelt so vieles, was ich den anderen zeigen will. Ich halte es einfach nicht aus, all das in mir zu verschließen. Mein Leben ist eigentlich ein ständiges: Schaut mich an, so bin ich! So möchte ich sein! Nehmt mich wahr, nehmt mich ernst und reagiert endlich auf mich!« Dieses Bedürfnis, sein Inneres nach außen zu wenden, scheint unserem Zeitgeist zu entsprechen, der die höchsten medialen Verstärkungen erfährt. Es scheint, als lebten wir in einer Arena der Beachtungskämpfe, in der jeder in der Hoffnung auf ein Höchstmaß an Resonanz schreit: Beachtet mich! Schaut her! Vergleichbar mit einer Party, auf der jeder schreit, sodass man nur noch lauter schreien kann. Fast jeder kann heute die zahllosen Spiel- und Resonanzräume der Kommunikationsgesellschaft nutzen, um sich zu zeigen und »Response« zu erhalten.
Oberflächlichkeit, Flüchtigkeit, Flachheit werden dieser Entwicklung angelastet. Auf der anderen Seite stehen: Individualisierung, Mediatisierung, Digitalisierung, Beschleunigung, so spiegeln sich in den Individuen letztlich genau die Anforderungen an Beweglichkeit, Kommunikationsbereitschaft und Selbstinszenierung, die heute erwartet werden. Sie wirken sich nicht nur auf die Beziehungen nach außen aus, sondern auch auf die intime Beziehung des Einzelnen zu sich selbst.
Insofern interessiert mich nicht so sehr die allgemeine Abhandlung dieser Phänomene, sondern vielmehr das Einzigartige daran, wie sich Menschen heute ihre Welt kreativ aneignen, wie sie ihre Beziehungen gestalten und sich mit ihrem Bedürfnis nach Begegnung und Resonanz Wege bahnen. Man tut dem Einzelnen Unrecht, wenn man alles zu einem Trend macht. »Was bleibt mir anderes übrig als mein Blog, wenn ich meine Gedanken mit anderen austauschen möchte? Musiker brauchen ihr Publikum. Und jeder, der ein Instrument spielt, weiß doch, wie das Üben langsam verpufft, wenn es nur im stillen Kämmerlein stattfindet.« So erlebt es ein Lehrer. Oder man stelle sich vor, jemand improvisiert nur in seinem Studio und scheut das Zusammenspiel mit anderen. Allein die Enge des Raums und der fehlende Dialog mit anderen, die seinen Horizont erweitern und seine Kreativität stimulieren, bedeuten eine erhebliche Einschränkung gegenüber anderen, die sich gemeinsam im öffentlichen Freiraum, in der Kneipe, am Marktplatz zeigen. Maler, Designer, Architekten brauchen die Augen ihrer Betrachter. Und ein Schriftsteller schreibt doch letztlich auch für seine Leser.
Es muss nicht exhibitionistisch oder narzisstisch sein, wenn Menschen sich zeigen wollen. Selbst wenn sie sich dabei verkleiden, verschönern, verstellen oder irgendwie anders darstellen, als wir es von ihnen gewohnt sind. Zunächst einmal steckt darin die Neugier und Vorfreude, wie die anderen wohl reagieren werden. Wohl jeder braucht in irgendeiner Form solche Antworten, um sich zu orten und Rückmeldung zu erhalten, um dazuzugehören und etwas über sich zu erfahren. Statt diesen Wunsch abzuwerten, geht es wohl eher darum, das richtige Verhältnis zwischen Innen und Außen, zwischen Offenheit und Abgrenzung abzuwägen. Wir brauchen Spiegelbilder, um uns zu gestalten, um ein »Jemand« zu werden.
Resonanz ist mehr als Echo
Kennen Sie dieses Phänomen? Sie sind in den Bergen und rufen etwas laut gegen eine weit entfernte Bergwand? Dann hören Sie bestimmt Ihr Echo. »Wie heißt der Kaiser von Wesel?« – »Esel.« »Was essen die Studenten?« – Na?
Echo ist etwas anderes als Resonanz und nicht damit zu verwechseln. Ein Echo ist keine wirkliche Antwort. Wenn wir jemandem ein Echo geben, so geben wir das zurück, was er ausgesendet hat. Vergleichbar mit dem Ball, der auf ein Hindernis trifft und wieder zurückprallt. Zwei treffen sich: »Wie geht es dir?«
Der andere antwortet: »Und dir?«
Statt Antwort wird hier lediglich ein Echo gegeben und dann weitergeredet, als wäre die Frage nicht der Antwort wert. Im übertragenen Sinn gibt das Echo nur zurück: »Ja genau!«, »So ist es!« Wie der Daumen im Internet, der nur »like« oder »not like« kennt. Mag ich! Mag ich nicht! Diese Äußerungen sind aber keine Antworten, sondern allenfalls Reaktionen oder Kehrtwendungen, die den anderen vernehmen, registrieren, bestätigen oder im negativen Fall abprallen lassen.
Echos sind statisch. Resonanz ist dynamisch, schwingt mit, breitet den Klang aus und verstärkt ihn. Je nachdem, wie ein Resonanzkörper beschaffen ist, verstärkt sich der Klang. Wenn Sie beispielsweise eine Spieluhr an Ihren Kieferknochen halten, so hören Sie die Musik viel lauter. Weil da nicht nur Luft, sondern auch ein Körper mitschwingt.
Resonanz sucht die Passung und Angleichung mit einem anderen, der mitschwingt. Sie schwingt sich auf ihn ein, auf das, worauf er anspricht, was er einordnen und verstehen kann. Dies bedarf einer gewissen Einfühlung. Und das ist weit mehr als ein bloßes Echo. Resonanz geschieht, wenn ich den anderen so in mir wiederfinde, als ob er ein Teil von mir wäre. So geschieht geteilte Wirklichkeit, die zu Kontakt, Begegnung oder gar Beziehung führt. Ein anderer, den ich wahrnehme, spielt, wie der Neurowissenschaftler Joachim Bauer (2006) sagte, genau auf dieser Klaviatur des Aufeinander-Einstimmens. Man kann Resonanz nicht einfordern, machen oder instrumentalisieren, sie geschieht.
Eine Ehefrau schreckt auf, weil sie ihren Mann früher als sonst heimkommen hört. An seinen festen Schritten erkennt sie ihn und an der Art, wie er die Treppen steigt, spürt sie seine merkwürdige, innere Unruhe. Es wird doch nichts passiert sein, denkt sie besorgt. Er grüßt sie flüchtig, sie schaut ihn an: »Magst du jetzt reden?«
Er sagt: »Ich komme vom Arzt!«
An diesem Beispiel kann man ablesen, wie selbst feine Nuancen in der Motorik, Mimik, Gestik und situative Konstellationen zugeordnet und auf die eigenen Gefühle und Erkennungsmuster bezogen werden können. Diese Resonanzen führen zu intuitiven Rückschlüssen auf die Befindlichkeit ihres Ehemannes. Weil sie ihn intuitiv und verstärkt durch körperliche Resonanzen erfasst, ist sie alarmiert und kann ihn »orten«.
Manchmal genügt es, wenn eine vertraute Person unseren Namen auf eine bestimmte Art ausspricht. Dann wissen wir intuitiv, dass es eigentlich bedeutet: »Hier bin ich, wo bist du?« Noch verstärkt in einer Liebesbeziehung, in der man allein daran, wie der andere den eigenen Namen ausspricht, spürt, ob man geliebt wird, ob man den anderen irritiert, ob er Angst um einen hat, oder ob er Abstand braucht und allein sein will.