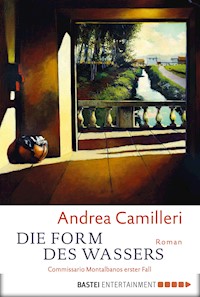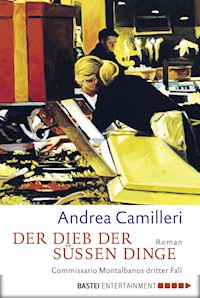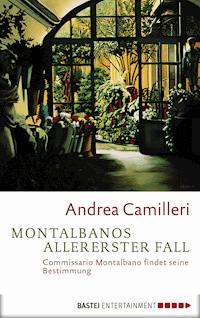19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein früher Anruf reißt Commissario Montalbano aus dem Schlaf. Er möge zu einem Treffen mit mehreren Freunden erscheinen, verlangt ein gewisser Riccardino - und legt auf. Kaum im Kommissariat angekommen, erreicht Montalbano die Nachricht von einem Mord auf offener Straße durch einen unerkannt geflohenen Täter. Als Montalbano die Identität des Opfers erfährt - ein Mann namens Riccardino -, fangen seine Probleme erst an. Denn kurz darauf muss der Commissario sich mit einer mysteriösen Anfrage des örtlichen Bischofs und mit einer Wahrsagerin auseinandersetzen, die von seltsamen Vorkommnissen in ihrem Viertel berichtet, in welche anscheinend auch Riccardino verstrickt war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Anmerkung des Autors
Anmerkungen des Originalverlags Sellerio
Über das Buch
Ein früher Anruf reißt Commissario Montalbano aus dem Schlaf. Er möge zu einem Treffen mit mehreren Freunden erscheinen, verlangt ein gewisser Riccardino - und legt auf. Kaum im Kommissariat angekommen, erreicht Montalbano die Nachricht von einem Mord auf offener Straße durch einen unerkannt geflohenen Täter. Als Montalbano die Identität des Opfers erfährt - ein Mann namens Riccardino -, fangen seine Probleme erst an. Denn kurz darauf muss der Commissario sich mit einer mysteriösen Anfrage des örtlichen Bischofs und mit einer Wahrsagerin auseinandersetzen, die von seltsamen Vorkommnissen in ihrem Viertel berichtet, in welche anscheinend auch Riccardino verstrickt war.
Über den Autor
Andrea Camilleri (1925-2019) ist der erfolgreichste zeitgenössische Autor Italiens und begeistert mit seinem vielfach ausgezeichneten Werk ein Millionenpublikum. Ob er seine Leser mit seinem unwiderstehlichen Helden Salvo Montalbano in den Bann zieht, ihnen mit kulinarischen Köstlichkeiten den Mund wässrig macht oder ihnen unvergessliche Einblicke in die mediterrane Seele gewährt: Dem Charme der Welt Camilleris vermag sich niemand zu entziehen.
Andrea Camilleri
Riccardino
Commissario Montalbano löst den Fall seines Lebens
Roman
Übersetzung aus dem Italienischen von Rita Seuß und Walter Kögler
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der italienischen Originalausgabe:
»Riccardino«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Sellerio Editore, via Enzo ed Elvira
Sellerio, 50, Palermo
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2025 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und
Data-Mining bleiben vorbehalten.
Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training
künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Einband-/Umschlagmotiv: © Shutterstock/AI Generator; Globe photo/
Shutterstock; Yevgenia Gorbulsky/Shutterstock; elesi/Shutterstock;
Artiste2d3d/Shutterstock; severjn/Shutterstock; Denis Belitsky/Shutterstock;
StandForUkraine/Shutterstock;© Adobe Firefly
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-7531-1
luebbe.de
lesejury.de
Eins
Das Telefon klingelte in dem Moment, als er endlich eingeschlafen war, zumindest kam es ihm so vor, nachdem er sich stundenlang im Bett hin- und hergewälzt hatte. Er hatte alles probiert, vom Zählen mit Schäfchen und Zählen ohne Schäfchen bis hin zu dem Versuch, sich an den Anfang des Ersten Gesangs der Ilias und an das berühmte Incipit von Ciceros Reden gegen Catilina zu erinnern. Nach »Quousque tandem, Catilina« gab er auf. Gegen diese Schlaflosigkeit half nichts, dabei hatte er sich weder den Bauch vollgeschlagen noch wurde er von bösen Gedanken gequält.
Er machte Licht und sah auf die Uhr: noch nicht einmal fünf. Vermutlich kam der Anruf aus dem Kommissariat, demnach musste etwas Schwerwiegendes passiert sein. Ohne Eile stand er auf, um das Gespräch im Nebenzimmer anzunehmen.
Den Anschluss neben seinem Nachttischchen verwendete er schon länger nicht mehr, denn er war überzeugt, dass sich im Falle eines nächtlichen Anrufs auf dem kurzen Weg in den anderen Raum die Traumgespinste in seinem Kopf auflösen würden.
»Pronto?«
Er klang nicht nur verärgert, sondern auch ziemlich verschlafen.
»Riccardino hier!«, hörte er eine Stimme, die im Unterschied zu seiner wach und fröhlich klang.
Das ärgerte ihn. Wie konnte man um fünf Uhr morgens wach und fröhlich sein? Und dann war da noch ein nicht unerhebliches Detail: Er kannte keinen Riccardino. Der Commissario öffnete den Mund, um den Anrufer zum Teufel zu jagen, der aber kam ihm zuvor.
»Was ist los? Hast du unsere Verabredung vor der Bar Aurora vergessen? Alle sind hier, nur du nicht! Es ist noch bewölkt, aber es wird ein wunderschöner Tag!«
»Entschuldigt, tut mir wirklich leid … In zehn Minuten, spätestens einer Viertelstunde bin ich da.«
Damit legte er auf und ging wieder schlafen.
Na gut, das war gemein von ihm, er hätte die Wahrheit sagen sollen: dass Riccardino sich verwählt hatte. Jetzt würden die den halben Vormittag auf ihn warten.
Andererseits hatte niemand das Recht, um fünf Uhr morgens ungestraft die falsche Nummer zu wählen.
An Schlaf war jedoch nicht mehr zu denken. Gut, dass Riccardino gesagt hatte, es würde ein schöner Tag werden. Montalbano fühlte sich versöhnt.
Der zweite Anruf kam kurz nach sechs.
»Dottori, ich bitte um Vergebnis und Entschulligung. Hab ich Sie geweckt?«
»Nein, Catarè, ich war schon wach.«
»Sicher, Dottori? Oder sagen Sie das nur aus Höflichkeit?«
»Nein, Catarè, sei unbesorgt. Sprich!«
»Dottori, gerade eben hat Fazio mich angerufen und mir gesagt, man hat ihn angerufen.«
»Und warum rufst du dann mich an?«
»Weil Fazio mir gesagt hat, anrufen sollen Sie.«
»Ich? Wen?«
»Nicht mich, Dottori. Fazio.«
Wenn das so weiterging, würde er nie dahinterkommen, was los war. Er legte auf und wählte Fazios Handynummer.
»Was gibt’s?«
»Entschuldigen Sie die Störung, Dottore, aber jemand wurde niedergeschossen.«
»Tot?«
»Ja. Zwei Schüsse ins Gesicht. Wäre gut, wenn Sie kommen könnten.«
»Ist Augello denn nicht da?«
»Dottore, wissen Sie nicht mehr? Er ist mit seiner Frau und Salvuzzo zu den Schwiegereltern aufs Land gefahren.«
Voll Bitterkeit erkannte Montalbano, dass seine Frage nach Mimì Augello ein Zeichen der Zeit war oder vielmehr ein Zeichen seiner eigenen, ganz persönlichen Zeit und all der Jahre, die er auf dem Buckel hatte.
Früher hätte er mit allerlei Tricks versucht, Mimì Augello von einem Ermittlungsfall fernzuhalten. Nicht aus Neid oder um ihm seine Karriere zu vermasseln, sondern einzig und allein, um das unbeschreibliche Vergnügen, den Täter zu jagen, nicht mit ihm teilen zu müssen. Jetzt aber überließ er ihm gern die Ermittlungen. Gewiss, wenn er einen Fall bearbeitete, legte er sich immer mächtig ins Zeug, aber jetzt hätte er sich am liebsten gedrückt.
Die Wahrheit lautete, dass er schon seit einer ganzen Weile keine Lust mehr hatte. Nach all den Jahren als Commissario war er zu dem Schluss gekommen, dass es der Gipfel der Dummheit war zu glauben, ein Problem ließe sich mit Mord lösen. Von wegen Mord als schöne Kunst betrachtet, wie De Quincey es in seinem Essay dargelegt hatte!
Knallköpfe allesamt. Jene, die aus Habgier, Eifersucht oder Rache einen Mord begingen, ebenso wie diejenigen, die im Namen der Freiheit, der Demokratie oder – noch schlimmer – im Namen Gottes reihenweise Leute abschlachteten. Und er war es leid, es immer nur mit Durchgeknallten zu tun zu haben. Sicher, einige waren gerissen, manche sogar intelligent, wie Leonardo Sciascia scharfsinnig festgestellt hatte. Aber man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, auf alle Fälle waren sie nicht ganz richtig im Kopf.
»Wo ist das passiert?«
»Mitten auf der Straße, vor etwa einer Stunde.«
»Gibt es Zeugen?«
»Ja.«
»Der Mörder wurde also gesehen?«
»Gesehen ja, Dottore. Aber offenbar ist keiner der Zeugen imstande, ihn zu beschreiben.«
Was war anderes zu erwarten, hier in diesem schönen Land? Man sieht den Mörder, kann ihn aber nicht beschreiben. Man ist vor Ort, kann aber nichts Genaues zum Geschehen sagen. Man hat den Mord gesehen, aber nur verschwommen, weil man die Brille zu Hause gelassen hat. Andererseits ist das Leben eines jeden, der zu sagen wagt, dass er den Mörder beim Morden gesehen hat, heutzutage automatisch ruiniert. Weniger durch den auf Rache sinnenden Täter selbst als durch Polizei, Staatsanwälte und Journalisten, die den Unglückseligen im Kommissariat, im Gerichtssaal und im Fernsehen fertigmachen.
»Haben sie ihn verfolgt?«
»Soll das ein Witz sein?«
Was war anderes zu erwarten, hier in diesem schönen Land? Sissignore, ich war vor Ort, aber ich konnte ihm nicht hinterherlaufen, weil mein Schnürsenkel offen war. Sissignore, ich habe alles gesehen, aber ich konnte nicht eingreifen, weil ich Rheuma habe. Andererseits: Wie viel Mut braucht es, um unbewaffnet jemanden zu verfolgen, der soeben einen Menschen erschossen und mindestens noch eine weitere Patrone im Lauf hat?
»Hast du den Staatsanwalt benachrichtigt, den Gerichtsmediziner, die Spurensicherung?«
»Alle.«
Montalbano spielte auf Zeit, das war ihm bewusst. Aber drücken konnte er sich nicht. Und so fragte er lustlos:
»Wie heißt die Straße?«
»Via Rosolino Pilo, in der Nähe von …«
»Ich weiß, wo die ist. Ich komme.«
Schreiend, fluchend und unter ohrenbetäubendem Hupen bahnte er sich seinen Weg durch einen Pulk von etwa fünfzig Personen, die sich anlocken ließen wie die Fliegen von einem Scheißhaufen. Sie verstopften Leuten, die von der Via Nino Bixio kamen wie er, die Zufahrt zur Via Rosolino Pilo. Doch der Zugang zum Tatort war von einem quer stehenden Polizeiauto versperrt und wurde von Inzolia und Verdicchio kontrolliert, zwei Polizisten, die im Kommissariat unter dem Namen »i vini da tavola«, die Tafelweine, besser bekannt waren. Das andere Ende der Straße, hin zur Via Tukory, bewachten in einem zweiten Wagen die »wilden Tiere« in Gestalt der Polizisten Lupo und Leone. Die Sektion »Hühnerstall« aus dem Kommissariat, also Gallo und Galluzzo, stand zusammen mit Fazio in der Mitte der Straße. Dort lag eine Leiche auf dem Boden. Ein Stück entfernt standen drei Männer gegen ein heruntergelassenes Rollgitter gelehnt.
Von Fenstern, Balkonen und Terrassen aus verfolgten Alte und Junge, Frauen und Männer, Kleinkinder, Hunde und Katzen das Geschehen. Um besser zu sehen, lehnten einige sich so weit hinaus, dass sie riskierten, auf das Pflaster hinunterzustürzen. Sie schrien und lachten, weinten und beteten – es war ein Höllenlärm wie bei der Festa di San Calò. Und wie am Feiertag zu Ehren des heiligen Calogero schossen die einen Fotos mit der Kamera, die anderen hielten die Szene mit winzigen Mobiltelefonen fest, die heutzutage schon Neugeborene bedienen können.
Der Commissario stellte seinen Wagen am Gehsteigrand ab und stieg aus.
Und sofort erhob sich über seinem Kopf lebhaftes Geschnatter.
»Schaut mal! Schaut! Der Commissario ist gekommen!«
»Da ist Montalbano!«
»Wer? Der Montalbano aus dem Fernsehen?«
»Nein, der echte.«
Das nervte Montalbano wahnsinnig. Vor zehn Jahren hatte er die geniale Idee gehabt, einem Autor aus der Gegend von seinen Ermittlungen zu erzählen, und dieser Autor hatte daraus sofort einen Roman zusammengestrickt. Da in Italien kaum mehr jemand Bücher las, blieb die Sache folgenlos. Und so hatte er dem Autor, der einfach nicht lockerließ, einen zweiten, dritten und vierten Ermittlungsfall geschildert, den dieser nach seinem Geschmack umschrieb, in einer erfundenen Sprache und mit viel Phantasie. Diese Romane wurden, weiß der Geier, warum, in Italien zum Bestseller und sogar in andere Sprachen übersetzt. Dann kamen die Geschichten ins Fernsehen und waren auch dort außerordentlich erfolgreich. Von dem Moment an änderte sich alles. Jetzt kannten alle Commissario Montalbano, allerdings nur als Fernsehfigur. Das ging ihm dermaßen auf die Eier! Er fühlte sich wie in einer Komödie eines anderen Autors aus dieser Gegend hier, eines gewissen Luigi Pirandello.
Zum Glück hatte der wirklich hervorragende Schauspieler, der ihn im Film verkörperte, keinerlei Ähnlichkeit mit ihm, und er war zehn Jahre jünger (der Mistkerl!). Sonst wäre das Ganze nicht auszuhalten gewesen. Montalbano hätte nicht mehr aus dem Haus gehen können, ohne bei jedem Schritt angehalten und um ein Autogramm gebeten zu werden.
»Kann mal jemand dafür sorgen, dass diese Leute aufhören zu glotzen und sich an diesem Anblick zu weiden? Selbst Krähen haben mehr Anstand.«
»Was sollen wir machen, Dottore? In die Luft schießen?«
»Wer sind die da drüben?«, fragte Montalbano mit einer Kopfbewegung zu den drei Männern vor dem Rollgitter.
»Freunde von dem Toten. Sie waren bei ihm, als es passiert ist.«
Montalbano musterte sie. Alle drei waren um die dreißig, alle mit Bürstenhaarschnitt, alle in grauen Sweatshirts und Turnschuhen, alle ziemlich sportlich und mit sonnenverbrannten Gesichtern. Jetzt aber war ihr gestähltes Erscheinungsbild verblasst und einer marionettenhaften Steifheit gewichen, was sicher der Angst und dem Schock geschuldet war. Doch dann beschlich den Commissario ein Verdacht.
»Sind das Soldaten?«, fragte er hoffnungsvoll.
Wenn sie Soldaten in Zivil waren, konnte er sich zurückziehen und den Fall an die Carabinieri übergeben.
»Nein, Dottore.«
Der Tote war wie sie gekleidet, nur dass die Vorderseite seines Sweatshirts dunkelbraune Flecken und Streifen von Blut aufwies, das auf dem Straßenpflaster eine Pfütze bildete. Er hatte kein Gesicht mehr, es war ausgelöscht. Neben seiner rechten Hand lag ein Mobiltelefon.
Erst jetzt, als Montalbano sich umsah, bemerkte er, dass über dem Rollgitter ein Schild angebracht war. Es trug den Schriftzug Bar Aurora.
Und im selben Moment wusste er mit untrüglicher, unerklärlicher Gewissheit, dass der Ermordete derselbe war, den er in aller Herrgottsfrühe in der Leitung gehabt hatte, weil der Mann sich verwählt hatte.
Montalbano ging auf die drei Freunde zu, die sich dicht zusammendrängten, als würden sie frieren.
»Ich bin Commissario Montalbano. Wie heißt der Tote?«
Die drei schliefen offenbar im Stehen, die Pupillen in den weit aufgerissenen Augen wanderten von oben nach unten und von einer Seite zur anderen. Sie nahmen mit Sicherheit nicht wahr, was um sie herum geschah. Sie bewegten sich nicht, sie antworteten nicht, und womöglich sahen sie auch die Person, die vor ihnen stand, nur verschwommen.
»Wie heißt der Tote?«, wiederholte Montalbano geduldig.
Endlich gelang es einem von ihnen mit sichtlicher Mühe, seine Augen unter dem festen Blick des Commissario zum Stillstand zu bringen.
»Riccardo Lopresti«, murmelte er.
»Riccardino?«, fragte Montalbano.
Es war, als hätte er eine Zauberformel gesprochen, ein magisches Wort. Als hätte er einen Stecker in eine Buchse gesteckt und die Batterien der drei aufgeladen.
Ihre Müdigkeit war schlagartig weg, Wärme und Farbe, Gefühle und Leben kehrten zurück, und sie fanden ihre Sprache wieder.
»Kannten Sie ihn?«, fragte mit zitternden Lippen der, der zuerst gesprochen hatte.
Montalbano antwortete nicht.
Leise, fast als würde er beten, sagte der Zweite:
»Riccardino, mein Gott, Riccardino …«
Der Dritte sagte nichts, er begann nur still zu weinen, das Gesicht in den Händen verborgen.
Plötzlich traf, zielsicher wie ein Scheinwerferlicht, ein Sonnenstrahl den Commissario und die drei Sportsfreunde. Montalbano hob den Kopf. Die Wolkendecke hatte sich gelichtet, das morgendliche Grau schwand allmählich. Riccardino hatte richtig prophezeit: Es würde ein wunderschöner Tag werden. Nur nicht für ihn. Aber das war jetzt völlig bedeutungslos.
In dem Moment fing das Geschnatter über seinem Kopf wieder an:
»Was is’n los da unten? Was passiert da?«
»Ja, was machen die?«
Es waren die Bewohner des Hauses, in dem sich die Bar Aurora befand. Weil sie nicht sehen konnten, was der Commissario direkt unter ihnen machte, fragten sie die vom Haus gegenüber.
»Der Commissario redet mit drei Männern.«
»Und was quatscht er mit denen?«
»Von hier oben hört man nichts.«
»Kann denn dieser Commissario nicht lauter sprechen, so wie der im Fernsehen?«
»Lauter!«, schrie irgendein Blödmann aus dem Fenster.
»Wir wollen was hören!«, protestierte ein anderer.
Diese Leute glaubten offenbar, einen Film im Fernsehen zu schauen, und verlangten jetzt nicht nur nach dem Bild, sondern auch nach dem Ton, als hätten sie den Sender abonniert.
Das brachte den Commissario dermaßen in Rage, dass er fürchtete, im nächsten Augenblick zu explodieren. Fazio, der ihn nur zu gut kannte, trat mit besorgter Miene zu ihm. Da traf der Commissario eine spontane Entscheidung.
»Fazio, ich nehme diese drei Herren mit ins Kommissariat.«
»Und wenn der Staatsanwalt kommt …«
»Wenn der Staatsanwalt kommt, übermittelst du ihm meine vorzügliche Hochachtung.«
Dann wandte er sich an die drei:
»Kommen Sie mit, hier kann man nicht reden.«
Während sie zum Auto gingen, wurde aus dem Geschnatter über ihren Köpfen ein jubelnder Chor:
»Er hat sie verhaftet! Er hat alle drei verhaftet!«
»Verdammt! Ist der tüchtig, dieser Montalbano!«
Auf dem Weg zum Kommissariat hielt er bei einer Bar und bestellte für alle drei einen Cognac. Sie tranken folgsam, wenn auch mit angewiderter Miene. Offenkundig waren sie das nicht gewohnt, oder es widersprach ihrem sportlichen Ethos. Trotzdem kamen sie wieder einigermaßen zu sich.
»Dottori, ah Dottori! Der Profissori wollte mit Ihnen sprechen!«
»Welcher Professore, Catarè?«
»Der Profissori e Autori.«
»Wenn er noch mal anruft, sagst du ihm, ich bin nicht da.«
Der Autor lebte zwar in Rom, aber offenbar hatte der Hauch des Todes durch Mord ihn schon angeweht.
In seinem Büro ließ Montalbano die drei Freunde vor seinem Schreibtisch Platz nehmen, nahm Papier und Stift zur Hand und wandte sich zuerst an den, der ganz links saß.
»Vorname, Nachname, Beruf, Adresse.«
»Mario Liotta, Vermessungsingenieur, Via Marconi zweiunddreißig.«
Der Zweite hieß Alfonso Licausi, war gleichfalls Vermessungsingenieur und wohnte in der Via Cristoforo Colombo. Und Gaspare Bonanno, der Dritte, war Buchhalter und wohnte auf der Piazza Plebiscito siebenundneunzig.
»Und Riccardino Lopresti?«
Riccardino war Angestellter bei der Banca Regionale, hatte ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften und wohnte im Viale Siracusa Nummer drei.
»Also, fangen wir an«, sagte Montalbano. »Wie seid ihr Freunde geworden?«
Die drei, die eine Vernehmung erwartet hatten, wie man sie aus dem Kino kennt, waren schon von der ersten Frage überrascht und sahen sich verdutzt an. Ein paar Sekunden vergingen, dann antwortete Liotta, der so etwas wie der Sprecher der Gruppe zu sein schien.
»Wir kennen uns seit der Grundschule, wir waren in derselben Klasse.«
»Sie sind also alle aus Vigàta.«
»Sì, Commissario.«
»Seid ihr gleich alt?«
»Wir sind alle Jahrgang 1972.«
»Und wie ging es dann weiter?«
»Irgendwann haben wir uns auch außerhalb der Schule getroffen, unsere Familien freundeten sich an. Wir haben uns nie aus den Augen verloren, obwohl wir später unterschiedliche Schulen besucht haben. Seit damals waren wir immer zusammen. Wissen Sie, wie man uns nannte? Die vier Musketiere.«
»Warum seid ihr alle gleich angezogen?«
»Das ist der Vereinsdress des Sportklubs Virtus et Labor, in dem wir Mitglied sind.«
»Was macht ihr für Sport?«
»Keinen speziellen. Wir sind oft im Fitnesscenter.«
»Ich gehe gern schwimmen«, sagte Montalbano. Und fügte hinzu: »Aber nicht im Schwimmbad, sondern im Meer.«
Die drei tauschten einen kurzen Blick. Dieser berühmte Commissario redete offenbar einfach drauflos, wie es ihm in den Sinn kam. Oder spielte er auf etwas an, das sie nicht verstanden?
»Fahren wir fort. Seid ihr verheiratet?«
»Ja. Alfonso und ich haben die beiden Schwestern von Gaspare geheiratet, und Gaspare hat meine Schwester geheiratet.«
»Und Riccardino?«
»Verzeihen Sie, Commissario, warum nennen Sie ihn Riccardino, so wie wir? Kannten Sie ihn?«
»Ich bin ihm ein paarmal begegnet«, erwiderte Montalbano ausweichend. Dann fragte er noch einmal: »Und Riccardino?«
»Riccardino nicht.«
»Er war nicht verheiratet?«
»Doch, aber mit einer Deutschen.«
Womöglich waren die Schwestern knapp geworden.
»Hat er sie in Deutschland kennengelernt?«
»Nein. Hier in Vigàta. Sie ist die jüngere Schwester von einer, die einen Vigateser geheiratet hat.«
Wer sagt’s denn! Irgendwo taucht immer eine heiratswillige Schwester auf.
»Sollte man sie nicht benachrichtigen?«
Die drei sahen einander an. Liotta ergriff das Wort, wenn auch ein wenig unsicher.
»So… sollen wir das machen?«
»Das wäre vermutlich am besten. Schließlich wart ihr befreundet, oder nicht?«
Die drei rutschten auf ihren Stühlen herum. Und Montalbano wusste, dass er einen wunden Punkt getroffen hatte.
Zwei
Wieder war es Liotta, der die Antwort gab.
»Dottore, wir waren mit Riccardino befreundet. Mit Else, seiner Frau, sind wir es nicht.«
»Verstehen Sie sich nicht mit ihr?«
»Ich will offen zu Ihnen sein: Sie hat alles Menschenmögliche versucht, um einen Keil zwischen Riccardino und uns zu treiben und unsere schöne Freundschaft zu zerstören. Verleumdungen, Unterstellungen, Lügen … zum Glück ist ihr das nicht gelungen.«
»Was war der Grund?«
»Tja, der Grund? Der ist uns schleierhaft. Unsere Frauen haben immer wieder versucht, eine Beziehung zu Else aufzubauen, aber sie ist bei ihrer Ablehnung geblieben. Da war nichts zu machen. Wissen Sie, dass Riccardino, der Ärmste, manchmal Ausreden erfinden musste, um sich mit uns zu treffen? Als würde er sich mit einer Geliebten verabreden.«
»Vielleicht war sie eifersüchtig«, schaltete sich Gaspare Bonanno ein. »Vielleicht fühlte sie sich ausgeschlossen und konnte unsere Freundschaft deshalb nicht ertragen.«
»Haben die beiden Kinder?«
»Else und Riccardino? Nein«, sagte Bonanno.
»Wohin wolltet ihr heute Morgen?«
Erneut antwortete Mario Liotta.
»Heute ist Feiertag, und …«
Montalbano wunderte sich.
»Feiertag? Was für ein Feiertag?«
»Allerseelen, Dottore.«
Warum ließ dieser abscheuliche Beruf ihn nicht einmal an einem Feiertag in Ruhe? Er bedeutete Liotta mit einem Nicken, fortzufahren.
»Wir wollten eine Wanderung zum Monte Lirato machen. Sechs Stunden, hin und zurück. Unterwegs wollten wir belegte Brötchen kaufen. Wir hatten uns um Viertel vor fünf vor der Bar Aurora verabredet. Normalerweise sind wir alle pünktlich.«
»Warum ausgerechnet vor dieser Bar?«
»Weil sie genau in der Mitte zwischen unseren Wohnungen liegt. Wir kommen ja nicht mit dem Auto …«
»Es war also nicht das erste Mal, dass ihr euch vor dieser Bar getroffen habt.«
»Nein, Commissario, das war unser üblicher Treffpunkt.«
»Wer wusste von diesem Ausflug?«
»Na ja … Unsere Frauen natürlich.«
»Nur sie?«
»Alle wussten davon, Dottore. Gestern zum Beispiel haben wir mit unseren Freunden im Sportverein darüber gesprochen. Warum sollten wir aus einer ganz gewöhnlichen Wanderung ein Geheimnis machen?«
»Erzählen Sie, was heute Morgen passiert ist.«
»Gaspare und ich haben uns in der Via Bixio getroffen, und als wir in die Via Rosolino Pilo eingebogen sind, haben wir gesehen, dass Riccardino schon da war. Dann haben wir drei uns ein bisschen unterhalten.«
»Wissen Sie noch, worüber?«
»Puh … Vor allem über das Wetter, wir waren etwas besorgt. Für mich sah es nach Regen aus, aber Riccardino war optimistisch und meinte, es würde ein wunderschöner Tag werden. Irgendwann war klar, dass Alfonso sich verspätet. Riccardino hat ihn angerufen, und Alfonso sagte zu ihm, dass er in höchstens einer Viertelstunde da ist.«
Alfonso Licausi machte Anstalten, von seinem Stuhl aufzuspringen, er hob ruckartig den Kopf und sah Liotta irritiert an. Aber er sagte nichts.
Licausis Reaktion alarmierte Montalbano: Warum hatte Licausi nicht gesagt, dass Riccardino ihn gar nicht angerufen hatte? Das wäre eine normale Reaktion gewesen, aber er hatte geschwiegen. Deshalb beschloss Montalbano, vorerst nicht zu verraten, wie es wirklich gewesen war.
»Sie haben gesagt, dass Signor Licausi spät dran war. Wie viel hatte er sich verspätet, als Riccardino ihn anrief?«
Die drei tauschten einen einvernehmlichen Blick.
»Zehn Minuten vielleicht«, antwortete Liotta stellvertretend für alle.
Das passte. Als Riccardinos Anruf ihn geweckt hatte, war es kurz vor fünf gewesen.
»Hat einer von Ihnen gehört, was Riccardino am Telefon gesagt hat?«
»Na ja, wenn jemand mit dem Handy telefoniert, Dottore, dreht er sich meistens weg. Während Riccardino die Nummer wählte, hat er sich ein paar Schritte von uns entfernt und ist vom Gehsteig herunter und fast in die Mitte der Straße getreten. Wir haben ihn sprechen hören, aber nicht verstanden, was er sagte.«
»Sagen Sie es uns, Signor Licausi«, bat der Commissario mit Unschuldsmiene.
»Ich weiß nicht, wovon meine Freunde reden. Ich möchte betonen, dass ich keinen Anruf von Riccardino erhalten habe«, erwiderte Licausi entschlossen. Er war totenbleich.
»Wie bitte?!«, fuhr Liotta auf, ebenso verwundert wie verstört. »Was redest du da? Riccardino hat uns doch gesagt, dass er mit dir gesprochen hat! Er hat sogar wiederholt, was du ihm geantwortet hast! Stimmt’s oder stimmt’s nicht, Gasparì?«
»Stimmt«, bekräftigte Bonanno, gleichfalls erstaunt.
»Aber ich sage euch, dass er nicht mit mir gesprochen hat, und das müsst ihr mir glauben!«, erwiderte Licausi mit erhobener Stimme.
Und dann, als hätte er plötzlich einen Verdacht:
»Oder wollt ihr mich in die Pfanne hauen?«
Sie waren instinktiv vom Italienischen in den Vigateser Dialekt gewechselt, die Sprache, in der sie als alte Freunde normalerweise kommunizierten. Und worauf spielte Licausi mit seiner Bemerkung an, was fürchtete er vonseiten seiner Freunde?
»Ganz ruhig.« Montalbano tat, als habe er etwas missverstanden. »Beruhigen Sie sich. Niemand will Sie in die Pfanne hauen.«
Licausi sah ihn nicht einmal an, er schwieg und senkte den Blick.
»Fahren Sie fort, Signor Liotta.«
»Während Riccardino telefonierte, preschte von der Via Bixio ein schweres Motorrad heran, der Fahrer trug einen Integralhelm.«
»Es war eine Yamaha 1100 Cruiser«, ergänzte Gaspare Bonanno.
»Erklären Sie das genauer«, bat der Commissario, der von Motorrädern nicht die leiseste Ahnung hatte.
»Eine leistungsstarke Maschine, fast so stark wie die für Motorradrennen und ziemlich schwer zu fahren. Ich glaube nicht, dass es hier bei uns viele davon gibt.«
»Wie ging es dann weiter?«
»Der Mann auf dem Motorrad hielt vor der Bar, ließ aber den Motor an. Ich dachte, er will eine Schachtel Zigaretten aus dem Automaten ziehen. Er hatte einen Fuß auf den Gehsteig gesetzt und die Handschuhe ausgezogen, um mit einer Hand in seine Jacke zu greifen.«
Montalbano sah Bonanno bewundernd an.
»Gratuliere. Zeugen, die sich so detailliert an eine Bluttat erinnern können, findet man selten.«
»Meine Freunde sagen, ich hätte ein ausgezeichnetes visuelles Gedächtnis. In dem Moment rief Riccardino, der immer noch mitten auf der Straße stand, laut und deutlich zu uns herüber, dass Alfonso in einer Viertelstunde da ist. Gaspare und ich drehten uns zu ihm und beachteten den Motorradfahrer nicht weiter. Und dann … sahen wir, wie Riccardino zu Boden sank.«
»Das ist jetzt wichtig für die Ermittlungen«, sagte der Commissario. »Wie viel Zeit verging zwischen dem Ende des Telefonats und dem tödlichen Schuss?«
Liottas Antwort kam prompt.
»Nur wenige Sekunden, das habe ich, glaube ich, schon gesagt. Riccardino hatte uns gerade Alfonsos Antwort mitgeteilt.«
Montalbano stieß unhörbar einen Seufzer der Erleichterung aus. Die Frage, die er gestellt hatte, war nicht für die Ermittlungen wichtig, sondern zur Beruhigung seines Gewissens: Er hatte befürchtet, dass Riccardino sterben musste, weil er, Montalbano, zu ihm gesagt hatte, er solle dort bleiben und auf ihn warten. Doch der Mörder war bereits vor Ort gewesen und hätte auch geschossen, wenn der Commissario Riccardino mitgeteilt hätte, dass er sich verwählt hatte.
»Habt ihr die Schüsse nicht gehört?«
»Wir haben überhaupt nichts gehört. Das Motorrad war so laut, es hat gerattert wie ein schweres Maschinengewehr … Das hat alles übertönt.«
»Und was geschah dann?«
»Der Mann auf dem Motorrad fuhr mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen davon. So dicht am Gehsteig entlang, dass ich seine Jacke berühren konnte, als ich instinktiv die Arme ausgestreckt habe, um ihn von mir fernzuhalten.«
»In welche Richtung fuhr er?«
»Geradeaus weiter bis zur Via Tukory und dann nach rechts.«
»Hat sich einer von Ihnen zufällig das Nummernschild gemerkt?«
Liotta sah Bonanno und Bonanno Liotta an. Sie verständigten sich ohne Worte.
»Nein«, sagte der Gruppensprecher Liotta.
»Schade«, kommentierte der Commissario.
»Das mit dem Nummernschild?«
»Nein, schade ist, dass Sie beide nicht gesehen haben, wie der Motorradfahrer geschossen hat.«
»Wollen Sie damit sagen, dass es gar nicht der Motorradfahrer war, der Riccardino ermordet hat?«
»Keineswegs. Ich sage nur, dass Sie beide nicht hundert Prozent sicher sein können, dass es der Motorradfahrer war, der geschossen hat. Vor Gericht wäre Ihre Aussage wertlos.«
»Und wieso ist er dann abgehauen?«
»Vielleicht aus Angst, Signor Liotta, weil er gesehen hat, wie jemand Schüsse abfeuerte. Aber das ist eine eher unwahrscheinliche Spekulation. Dieses Motorrad … Haben Sie es vorher schon einmal gesehen?«
Erneut ein kurzer Blickwechsel.
»Nein«, sagte Liotta.
»Wer hat die Polizei verständigt?«
»Wir nicht. Der Einzige, der ein Handy dabeihatte, war Riccardino …«
»Was haben Sie gemacht, nachdem das Motorrad weg war?«
Wie üblich gab Liotta die Antwort.
»Ich bin zu Riccardino gegangen, um zu sehen, ob … Aber mir war sofort klar, dass nichts mehr zu machen war … Sein … er hatte kein Gesicht mehr, es war nur noch ein blutiger Klumpen …«
Er konnte nicht weitersprechen, schluckte ein paarmal, sein Mund musste vollkommen ausgetrocknet sein.
»Und Sie?«, wandte sich Montalbano an Gaspare.
»Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, ich war wie gelähmt.«
»Und Sie, Signor Licausi?«
»Als ich kam, war alles schon passiert.«
Vielleicht lag es an seinem Tonfall, dass Liotta und Bonanno den Kopf wandten und ihn ansahen. Licausi nutzte die Gelegenheit.
»Ich möchte diese Sache mit dem Anruf ein für alle Mal klarstellen«, fuhr er mit finsterer Miene fort. »Ich wiederhole: Mich hat Riccardino nicht angerufen, und deshalb kann ich auch nicht mit ihm gesprochen haben.«
»Aber wenn er doch …«, begann Gaspare.
Liotta unterbrach ihn.
»Warum streitest du ab, dass Riccardino dich angerufen hat?«
»Jungs, geht mir nicht auf die Eier mit dieser Geschichte«, gab Licausi ärgerlich, fast drohend zurück.
Er war wieder in den Vigateser Dialekt umgeschwenkt. Die Sache wurde immer komplizierter.
»Dürften wir mal erfahren, welchen Nutzen du davon hast, dieses harmlose Telefonat zu leugnen?«, beharrte Liotta.
»Dürfte ich dann mal erfahren, welchen Nutzen ihr zwei davon habt, auf diesem Telefonat zu beharren?«, fragte Licausi wütend und stand auf.
Nutzen: ein Wort, das in einer aufrichtigen Freundschaft niemals ausgesprochen werden sollte.
Die drei waren also doch nicht ein Herz und eine Seele, wie sie glauben machen wollten. Hatte Liotta nicht gesagt, dass man sie die vier Musketiere nannte? Und lautete das Motto der Musketiere nicht: Einer für alle, alle für einen? Oder wollte in diesem Fall einer den anderen in Teufels Küche bringen? Fest stand jedenfalls, dass sie etwas zu verbergen hatten. Dass der Commissario das Rätsel um Riccardos Anruf nicht sofort aufgeklärt hatte, war ein genialer Schachzug gewesen, und er war stolz darauf. Aber jetzt galt es, den drohenden Streit zu verhindern.
»Signor Licausi, setzen Sie sich sofort wieder hin. Wir sind hier nicht im Sportverein, hier wird kein Ringkampf ausgetragen.«
Licausi setzte sich ohne einen Mucks.
»Wir wollen versuchen, die Sache mit dem Anruf zu klären, bei der ihr euch nicht einig seid. Signor Licausi, können Sie mir sagen, wann Sie am vereinbarten Treffpunkt ankamen?«
»Gleich nachdem Riccardino ermordet wurde. Das weiß ich so genau, weil ich von der Via Tukory kam und fast von einer Yamaha 1100 überfahren worden wäre, die, wie ich dann erfuhr, die des Mörders war.«
»Wo wohnen Sie?«
»In der Via Cristoforo Colombo.«
»Und Sie sind zu Fuß gekommen wie die anderen?«
»Ja klar.«
»Wenn ich mich nicht irre, braucht man, wenn man zügig geht, von der Via Cristoforo Colombo zur Via Pilo eine Viertelstunde, zwanzig Minuten. Ist das korrekt?«
»Sissignore. Ich brauche eine Viertelstunde.«
»Und wissen Sie, was das bedeutet?«
»Das bedeutet, dass ich die Wohnung bereits verlassen hatte, als Riccardino mich angerufen hat – falls er mich angerufen hat.«
»Genau. Aber irgendjemand ist rangegangen. Kann das Ihre Frau gewesen sein?«
»Im Moment bin ich allein zu Hause, meine Frau macht Urlaub in San Vito Lo Capo.«
»Haben Sie Kinder?«
»Ja. Eine Tochter. Sie ist drei.«
»Wenn das so ist«, sagte Montalbano, »gibt es nur eine Erklärung. Riccardino hat sich verwählt und mit jemand anderem gesprochen.«
»Ich bitte Sie, Dottore!«, rief Gaspare. »Riccardino hätte sofort gemerkt, dass es nicht Alfonsos Stimme ist!«
»In dem Fall«, räumte Montalbano ein, »könnte es eine andere plausible Erklärung geben: Riccardino hat sich verwählt und mit jemand anderem geredet, Ihnen beiden aber gesagt, dass er mit Signor Licausi gesprochen hat.«
»Aber warum, um Himmels willen! Warum hätte er so ein Theater veranstalten sollen?«, fragte Liotta mit erhobener Stimme.
»Das weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie es.«
Und auch das war ein kluger Schachzug, denn er verstärkte die bisher nur unterschwellige Uneinigkeit zwischen den drei Musketieren, oder was auch immer sie waren. In der Tat verstummten Liotta, Bonanno und Licausi. Und sahen einander lange schweigend an.
Der Moment war gekommen, noch eins draufzusetzen. Und Montalbano tat genau das. Je mehr Staub er aufwirbelte, desto größer war die Chance, dass darunter etwas ans Licht kam.
»Es sei denn, Riccardino selbst wurde angerufen«, sagte er leise, wie in Gedanken versunken.
Es war, als hätten die drei einen elektrischen Schlag bekommen.
»Aber dann hätten wir es doch klingeln hören!«, sagte Liotta.
»Das ist nicht gesagt. Vielleicht war das Handy auf Vibration eingestellt. Manche Geräte geben vor dem Klingeln ein schwaches Signal … Riccardino könnte den eingehenden Anruf gehört, aber so getan haben, als hätte er selbst angerufen.«
»Aber warum? Und wer hätte ihn um diese Uhrzeit anrufen sollen?«
Die Frage hatte Gaspare Bonanno gestellt.
»Seine Frau zum Beispiel. Oder sonst jemand, der ihn warnen wollte.«
»Wovor denn warnen?«, schrie Liotta.
»Was weiß ich? Vielleicht vor einer drohenden Gefahr.«
»Aber warum hätte Riccardino uns das verschweigen sollen?«, fragte Liotta.
»Und warum hätte er uns etwas sagen sollen, das nicht stimmt?«, pflichtete Bonanno ihm bei.
Wie ein guter Jesuit breitete Montalbano die Arme aus und hob die Augen zum Himmel, um zu sagen: Den wahren Grund allen menschlichen Handelns kennt Gott allein. Doch es war Licausi, der auf Liottas und Bonannos Frage antwortete.
»Der Signor Commissario vermutet, dass Riccardino uns misstraut hat.«
Blitzschnell legte Montalbano das Gewand des Jesuiten ab und machte ein beleidigtes und schmerzvolles Gesicht, als wäre er Opfer einer Ungerechtigkeit.
»Ich stelle nur abstrakte Überlegungen an, Signor Licausi, einfach so ins Blaue hinein. Oder glauben Sie, ich könnte auf Basis derart unsicherer Annahmen zu konkreten Schlussfolgerungen gelangen?«
Offenbar hatte er seine Rolle gut gespielt, denn Licausi blickte verwirrt.
»Ich bitte um Entschuldigung«, sagte er knapp.
Der Commissario hielt den Moment für gekommen, das Problem um Riccardos Anruf aus der Welt zu schaffen, er hatte ausreichend davon profitiert. Er schlug sich mit der Hand an die Stirn.
»Wie dumm von mir! Es gibt einen ganz einfachen Weg, herauszufinden, mit wem Riccardino telefoniert hat. Warum fällt mir das jetzt erst ein!«
Er griff zum Hörer.
»Catarè, hol Fazio ans Telefon.«
Während er wartete, ließ er sich das Märchen, das er den dreien auftischen würde, noch einmal durch den Kopf gehen. Er würde ihnen sagen, dass die Spurensicherung die in Riccardinos Handy gespeicherte Nummer gewählt hatte und jemand rangegangen war, der sagte, er sei um fünf Uhr morgens von einem Unbekannten aus dem Bett geklingelt worden, der sich verwählt hatte. Um es ihm heimzuzahlen, habe er dem Anrufer zum Schein versprochen, in zehn Minuten am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Und wenn einer der drei fragen würde, warum Riccardino nicht gemerkt hatte, dass es nicht die Stimme seines Freundes war, gab es hundert mögliche Antworten.
»Pronto, Fazio? Hör zu, ist die Spurensicherung schon da? Ja? Gut, dann sag ihnen, sie sollen überprüfen, wohin das letzte Telefonat vom Handy des Toten aus ging, und …«
»Schon geschehen, Dottore.«
Montalbano lächelte in sich hinein. Wenn Fazio wusste, dass Riccardino seine Nummer gewählt hatte, würde es ihm leichter fallen zu improvisieren.
»Das ist also bereits geschehen«, wiederholte er für sein Publikum.
Licausi, Liotta und Bonanno saßen angespannt auf der Stuhlkante.
»Und wessen Nummer ist es?«
Fazio senkte die Stimme.
»Dottore, sind die drei Herren noch bei Ihnen?«
»Ja.«
»Dann kann ich nicht sprechen.«
Montalbano war klar, dass Fazio am Telefon nicht sagen wollte, dass es sich um seine Festnetznummer in Marinella handelte. Er sprang ihm bei.
»Ist es die Nummer von jemandem, den wir kennen?«
Fazios Antwort überraschte ihn.
»Nein, Dottore.«
Was hatte das zu bedeuten? Er, Montalbano, war es doch, mit dem Riccardino, auch wenn er sich verwählt hatte, vor seinem Tod zuletzt telefoniert hatte!
»Bist du ganz sicher?«
»Hundertpro.«
Es hatte keinen Sinn, weiter nachzubohren.
»Danke. Melde dich, sobald ihr fertig seid.«
Drei
Aber Fazio hatte ihm noch etwas mitzuteilen.
»Dottore, da wir schon dabei sind, möchte ich Ihnen sagen, dass sich hier soeben eine tragische Szene abgespielt hat.«
»Nämlich?«
»Irgendein Idiot hat Riccardo Loprestis Frau angerufen und ihr gesagt, dass ihr Mann ermordet wurde. Und wo. Sie ist sofort hergekommen. Zum Glück war Dottor Pasquano hier. Sie hat sich die Augen aus dem Kopf geweint, die Ärmste!«
»Und wo ist sie jetzt?«
»Einer unserer Leute hat sie nach Hause gebracht, sie war mit ihrer Schwester gekommen.«
»Ich danke dir.«
Er legte auf und musterte schweigend die drei, die ihrerseits ihn schweigend ansahen.
Nach einer Weile sagte Montalbano:
»Sie haben mitbekommen, dass die Spurensicherung die Nummer gewählt hat, die im Handy gespeichert war.«