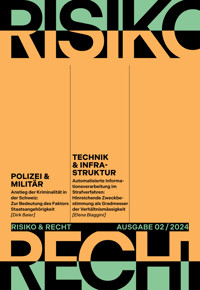
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Risiko & Recht
- Sprache: Deutsch
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 86
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
1
Risiko & Recht Ausgabe 02 / 2024
Editorial
Polizei & Militär
Anstieg der Kriminalität in der Schweiz: Zur Bedeutung des Faktors Staatsangehörigkeit[Dirk Baier]
Technik & Infrastruktur
Automatisierte Informationsverarbeitung im Strafverfahren: Hinreichende Zweckbestimmung als Gradmesser der Verhältnismässigkeit[Elena Biaggini]
Weiter- bildung
CAS Polizeirecht – Recht im Einsatz[Patrice Martin Zumsteg]
Tagungs- bericht
14. Zürcher Präventionsforum Sexuelle Belästigung im öffentlichen und virtuellem Raum – Fokus der Kriminalprävention[Michael Pommerehne / Lisa Reggiani / Vivian Stein]
Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
In der vorliegenden Ausgabe 2/2024 der Risiko & Recht befasst sich Prof. Dr. Dirk Baier mit der Bedeutung des Faktors Staatsangehörigkeit im Zusammenhang mit dem Anstieg der Kriminalität in der Schweiz. Aus Anlass der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2023 und der Diskussion um den Kriminalitätsanstieg und die „Ausländerkriminalität“ werden in diesem Beitrag verschiedene differenzierende Auswertungen dieser Statistik vorgestellt. Zusätzlich werden die Konstruktionsbedingungen der Statistik beleuchtet, die zur Folge haben, dass die Kriminalität von Ausländerinnen und Ausländern überschätzt wird. Die Auswertungen zeigen, dass es in verschiedenen Kriminalitätsbereichen keinen Anstieg gegeben hat.
Des Weiteren thematisiert Dr. Elena Biaggini die automatisierte Informationsverarbeitung im Strafverfahren. Nach Auffassung der Autorin verlangt der zunehmende Einsatz entsprechender Informationsverarbeitungsmethoden zum Zwecke der Strafverfolgung nach hinreichend bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen, an welchen es de lege lata noch fehle. Vor dem Hintergrund der vielfältigen Nutzungs- und Kombinationsmöglichkeiten bilde eine hinreichende Zweckbestimmung sowie Zweckbindung dieser Informationen den Gradmesser der Verhältnissmässigkeit solcher Massnahmen.
Abschliessend berichten Rechtsanwalt Michael Pommerehne, MLaw Lisa Reggiani und BLaw Vivian Stein vom 14. Zürcher Präventionsforum, an welchem das Thema Sexuelle Belästigung im öffentlichen und virtuellen Raum aus kriminologischer und präventiver Perspektive aufgearbeitet wurde.
Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre und erlauben uns noch auf die Möglichkeit eines Print-Abonnements hinzuweisen.
Tilmann Altwicker Dirk Baier Goran Seferovic Franziska Sprecher Stefan Vogel Sven Zimmerlin
Polizei & Militär
Anstieg der Kriminalität in der Schweiz: Zur Bedeutung des Faktors Staatsangehörigkeit
Dirk Baier
Aus Anlass der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2023 und der Diskussion um den Kriminalitätsanstieg und die „Ausländerkriminalität“ werden in diesem Beitrag verschiedene differenzierende Auswertungen dieser Statistik vorgestellt. Zusätzlich werden die Konstruktionsbedingungen der Statistik beleuchtet, die zur Folge haben, dass die Kriminalität von Ausländerinnen und Ausländern überschätzt wird. Die Auswertungen zeigen, dass es in verschiedenen Kriminalitätsbereichen keinen Anstieg gegeben hat; Zahlen zu Beschuldigten mit ausländischer Herkunft nehmen vor allem im Diebstahlsbereich zu.
Inhalt
EinleitungKriminalitätsentwicklung in der Schweiz im letzten JahrzehntEntwicklung verschiedener StraftatenEntwicklung der AufklärungsrateDie Konstruktionsbedingungen der KriminalstatistikKonstruktionsbedingungen zulasten ausländischer BeschuldigterVerurteilungenEntwicklung ausländischer Beschuldigter in der KriminalstatistikKriminalität nach HerkunftsgruppenDiskussionLiteraturverzeichnisEinleitung
Nach der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023 am 25. März 2024 wurde vor allem über zwei Themen intensiv diskutiert[1]: Erstens war der im Vergleich der letzten Jahre überproportionale Kriminalitätsanstieg erklärungsbedürftig. Zweitens wurde der Anstieg ausländischer Beschuldigter thematisiert, der sogleich als eine Erklärung des Kriminalitätsanstiegs insgesamt diente. Die Ausländerthematik ist dabei hochumstritten: Während einerseits das Narrativ des Tabus bemüht wird, welches endlich gebrochen werden müsse, um Kriminalität wirksam bekämpfen zu können, wird andererseits darauf hingewiesen, dass ein Ausländerstatus allein nicht als Ursache kriminellen Verhaltens betrachtet werden könne. Die Rede von einem Tabu, welches gebrochen werden müsse, ist dabei stark überzogen, als in der Schweiz seit Jahrzehnten über Ausländerkriminalität geforscht wird.[2] Die höhere Kriminalitätsbelastung der ausländischen Bevölkerung wird dabei weitestgehend nicht bezweifelt; die zentrale Frage ist jedoch, inwieweit sich diesbezüglich Änderungen im Zeitverlauf ergeben, welche Faktoren für die Höherbelastung verantwortlich sind und welche Folgerungen sich aus entsprechenden Analysen ableiten. Die Diskussionen um die Polizeiliche Kriminalstatistik 2023 sollen im Folgenden zum Anlass genommen werden, aktuelle Zahlen zu dieser Thematik zu präsentieren und zu interpretieren, um eine sachliche Grundlage zur Thematik zu schaffen.
Kriminalitätsentwicklung in der Schweiz im letzten Jahrzehnt
Entwicklung verschiedener Straftaten
Zunächst soll ein Blick auf die Entwicklung der registrierten Kriminalität in der Schweiz geworfen werden. Bei der Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2023 wurde u.a. von einem Anstieg der Straftaten um 14.0% gesprochen.[3] Dies ist, wird die absolute Anzahl an Straftaten betrachtet, korrekt, wie Tabelle 1 zeigt. Wurden im Jahr 2022 458’549 Straftaten registriert, waren es 2023 bereits 522’558. Dies ist in den letzten zehn Jahren der stärkste Anstieg: Zwischen 2013 und 2021 hat es jährlich einen Rückgang der Straftaten gegeben, wobei dieser Rückgang zwischen 0.2% (von 2018 auf 2019) und 8.1% lag (von 2013 auf 2014). Der Anstieg von 2022 auf 2023 fällt dabei noch einmal höher aus als im Jahr zu vor (+10.5%).
Allerdings wird der Anstieg überschätzt, soweit zwischen 2022 und 2023 die Schweizer Bevölkerung um 0.9% angewachsen ist (hauptsächlich durch Zuwanderung). Bei der Interpretation der Entwicklungen der registrierten Straftaten sollte immer die Bevölkerungsentwicklung mitberücksichtigt werden, da unter sonst gleichen Bedingungen ein Anstieg der Bevölkerung mit einem Anstieg der Straftatenanzahl einhergeht. Wird dies getan und die sog. Häufigkeitszahl berechnet (Straftaten pro 100’000 der Bevölkerung) liegt der Anstieg bei 13.0%, wobei dieser ebenfalls höher ausfällt als im Jahr vorher (+9.6%). Obwohl es wichtig ist, die Bevölkerungsentwicklung bei der Betrachtung von Kriminalitätstrends zu berücksichtigen, kann dadurch ein weiteres Problem nicht behoben werden: Berücksichtigt werden kann nur die Bevölkerung, die in der Schweiz wohnhaft ist; kriminelle Delikte werden aber nicht allein von diesen Personen verübt, sondern auch von vielen anderen hier anwesenden Personengruppen, wie bspw. Touristen, illegal Anwesenden, Durchreisenden usw. In die Kriminalstatistiken gehen die von diesen Personen verübten Delikte ein, in der Bevölkerungsstatistik werden diese Gruppen hingegen nicht ausgewiesen.
Da sich dieses Problem nicht lösen lässt – es kann hier nur darauf hingewiesen werden – ist zumindest die Betrachtung von Häufigkeitszahlen (also an der Bevölkerungsentwicklung relativierten Kriminalitätszahlen) bei Betrachtung von Entwicklungstrends geboten. Werden verschiedene Deliktkategorien betrachtet, ergeben sich dabei keineswegs gleichartige Trends, wie Tabelle 1 anhand von drei Deliktkategorien der Kriminalstatistik zeigt. Vermögensdelikte (insbesondere Diebstähle, Sachbeschädigungen und Betrugsdelikte) machen mehr als zwei Drittel aller Straftaten aus (2023: 67.9%); bei diesen Delikten ergibt sich ein Anstieg der Häufigkeitszahl von 2022 auf 2023 um 16.6%. Delikte gegen Leib und Leben (zu drei Viertel einfache Körperverletzungen und Tätlichkeiten) bleiben weitestgehend konstant (+1.1%); im Jahr vorher waren diese noch um 5.9% gestiegen. Bei Delikten gegen die sexuelle Integrität (mehrheitlich Pornografiedelikte und sexuelle Belästigungen) zeigt sich im Vergleich der Jahre 2022 und 2023 sogar ein Rückgang um 8.1%; auch hier gab es im Jahr vorher noch einen Anstieg um 5.2%.
Diese Auswertungen zeigen, dass die Entwicklungen sehr heterogen sind und meist nur jene Delikte in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, bei denen sich Anstiege zeigen. Dabei fällt die Heterogenität in den Trends noch viel grösser aus, als dies in Tabelle 1 dargestellt ist. Zusätzlich durchgeführt wurden für 96 Einzeldelikte Berechnungen zur Veränderung der Häufigkeitszahl zwischen 2022 und 2023. Ausgewählt wurden dabei jene Delikte, in denen in der Kriminalstatistik beider Jahre im Durchschnitt mindestens 100 Straftaten registriert wurden. Bei 60 Delikten findet sich ein Anstieg der Häufigkeitszahl zwischen 0.1% und 436.8%; die stärksten Anstiege sind bei den Delikten „In Umlaufsetzen falschen Geldes (Art. 242 StGB)“ und „Amtsanmassung (Art. 287 StGB)“ festzustellen. Daneben zeigen sich bei 36 Delikten und damit bei über einem Drittel Rückgänge von bis zu 97.7%. Die stärksten Rückgänge sind dabei für die Delikte „Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 StGB)“, „Störung des Eisenbahnverkehrs (Art. 238 StGB)“ und „Einführen, Erwerben, Lagern falschen Geldes (Art. 244 StGB)“ vorhanden.
Bei Betrachtung der Einzeldelikte fällt zudem auf, dass zwischen 2022 und 2023 insbesondere Cybercrime- und Diebstahlsdelikte stärker angestiegen sind. So haben der Diebstahl ab/aus Fahrzeugen, der Fahrzeugeinbruchdiebstahl, der Entreissdiebstahl, der Taschendiebstahl, der Einschleichdiebstahl und der Ladendiebstahl jeweils um über 20% zugenommen (Häufigkeitszahl). Bei einigen Delikten des Bereichs Leib und Leben sind ebenfalls Anstiege feststellbar. So sind vollendete Tötungsdelikte von 42 auf 53 registrierten Straftaten gestiegen – ein Anstieg um 25.1% (bezogen auf die Häufigkeitszahl). Allerdings ist bei generell niedrigen Fallzahlen immer von einer Schwankung auszugehen: 2013 und 2015 gab es, bei einer geringeren Bevölkerungszahl, 57 vollendete Tötungsdelikte. Auch Fälle schwerer Körperverletzungen sind angestiegen, und zwar von 762 auf 880 registrierte Taten (+14.5%). Dies klingt dramatisch; allerdings bedeutet dies, dass es pro Tag in der gesamten Schweiz zwei- bis dreimal zu schweren Körperverletzungen kommt. Zudem kann für einen Anstieg der schweren Körperverletzungsdelikte durchaus auch eine ansteigende Anzeigebereitschaft mitverantwortlich sein. Gerade im Häuslichen Bereich sind die schweren Körperverletzungen von 123 auf 147 Fälle gestiegen; im Häuslichen Bereich ist die Anzeigebereitschaft aber traditionell noch gering, ansteigende Zahlen stehen daher eher für eine zunehmende Anzeigebereitschaft als für reale Veränderungen des Gewaltverhaltens. Einfache Körperverletzungen, die zum Bereich Leib und Leben gezählt werden, haben zugleich abgenommen (-1.9%), d.h. es ergibt sich mit Blick auf den Gewaltbereich kein klarer Trend im Vergleich der Jahre 2022 und 2023. Bei den Delikten gegen die sexuelle Integrität ist zu konstatieren, dass sexuelle Nötigungen um 10.9%, Vergewaltigungen um 4.1%, sexuelle Belästigungen um 3.8% zurückgegangen sind. Da es keinen Grund gibt, anzunehmen, dass die Anzeigebereitschaft in diesen Bereich fällt, dürften dies reale Rückgänge darstellen.
Tabelle 1: Entwicklung verschiedener Kriminalitätszahlen (Polizeiliche Kriminalstatistik, eigene Berechnungen)Entwicklung der Aufklärungsrate
In Tabelle 1





























