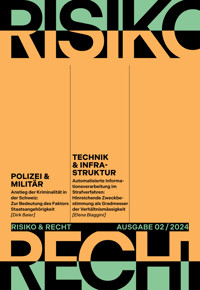2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
Zeitschrift Risiko & Recht - 02/2025 Copyright © by Tilmann Altwicker; Dirk Baier; Goran Seferovic; Franziska Sprecher; Stefan Vogel; und Sven Zimmerlin is licensed under a Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International, except where otherwise noted.
Herausgeber: Tilmann Altwicker, Dirk Baier, Goran Seferovic, Franziska Sprecher, Stefan Vogel, Sven ZimmerlinVerlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)
Version: 0.10 – 20250612
Dieses Werk ist als gedrucktes Buch sowie als Open-Access-Publikation in verschiedenen Formaten verfügbar:https://eizpublishing.ch/publikationen/zeitschrift-risiko-recht-022025/.
1
Risiko & Recht Ausgabe 02 / 2025
Editorial
Grundlagen
Basisraten in forensischen Humanwissenschaften: Grundlagen und Herausforderungen[Joëlle Ninon Albrecht / Nina Schnyder / Jérôme Endrass / Marc Graf / Dirk Baier / Astrid Rossegger]
Rechtliche Aspekte der forensischen Basisraten[Thomas Noll / Michèle Iseli]
Polizei & Militär
Das polizeirechtliche Veranstaltungsverbot im Kanton St. Gallen[Patrice Martin Zumsteg]
Technik & Infrastruktur
Staatliche Gesichtserkennung: eine rechtliche Einordnung[Robert Baumann]
Tagungsbericht
15. Zürcher Präventionsforum – Aktuelle Schwerpunkte der Kriminalprävention – Jugend, Radikalisierung und Gewalt[Niklaus Julian Sempach / Vivian Stein / Jacqueline Walder]
Editorial
Editorial
Sehr geehrte Damen und Herren
Die vorliegende Ausgabe 2/2025 der Risiko & Recht deckt ein breites Themenspektrum aktueller Sicherheitsfragen ab. Eingangs setzen sich zwei Beiträge mit der Thematik Basisraten im strafprozessualen Kontext auseinander. Hierbei dreht es sich um die statistische Grundwahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses oder Merkmals. Basisraten sind essenzieller Bestandteil evidenzbasierter Risikoeinschätzungen. Die Autorinnen und Autoren Joëlle Ninon Albrecht, Nina Schnyder, Jérôme Endrass, Marc Graf, Dirk Baier und Astrid Rossegger befassen sich in ihrem Beitrag mit den mit Basisraten verbundenen Herausforderungen und stellen die wesentlichen Faktoren dar, welche bei der Nutzung von Basisraten zu berücksichtigen sind. Thomas Noll und Michèle Iseli setzen sich mit rechtlichen Aspekten der forensischen Basisraten auseinander. Angesichts der potenziell einschneidenden Bedeutung solcher Risikoeinschätzungen, widmen sich die Autoren in ihrem Beitrag dem rechtlichen Rahmen, den Fachpersonen im Umgang mit Basisraten einzuhalten haben.
Robert Baumann beleuchtet in seinem Beitrag die staatliche Gesichtserkennung aus rechtlicher Sicht. In verschiedenen Kantonen und Gemeinden sind Vorstösse eingereicht worden, um die biometrische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gänzlich zu verbieten. Vor diesem Hintergrund ordnet der Autor die Gesichtserkennung rechtlich ein und beurteilt insbesondere die Zulässigkeit der vom Bund geplanten Einführung eines automatischen Gesichtsbildabgleichs.
Patrice Martin Zumsteg befasst sich mit dem polizeilichen Veranstaltungsverbot im Kanton St. Gallen. In seinem Beitrag behandelt er anhand eines Anwendungsfalls die praktische Umsetzbarkeit von Art. 50quater des Polizeigesetzes des Kantons St. Gallen.
Schliesslich berichten Niklaus Sempach, Vivian Stein und Jacqueline Walder vom 15. Zürcher Präventionsforum, an welchem die aktuellen Schwerpunkte der Kriminalprävention Jugend, Radikalisierung und Gewalt aufgearbeitet wurden.
Die Zeitschrift Risiko & Recht freut sich zudem, eine Kooperation mit den beiden Weiterbildungsstudiengängen CAS Recht der inneren Sicherheit und CAS Polizeirecht an der ZHAW in Winterthur bekannt geben zu dürfen. Die von den ausgewiesenen Experten im Sicherheitsrecht, Patrice Martin Zumsteg und Lucien Müller, geleiteten Studiengänge werden der Zeitschrift künftig hervorragende Zertifikatsarbeiten zur Publikation vorschlagen. Die Entscheidung über eine Veröffentlichung liegt weiterhin bei den Herausgebern. Den Auftakt dieser Kooperation bildet der Beitrag von Patrice Martin Zumsteg zum polizeirechtlichen Veranstaltungsverbot im Kanton St. Gallen in der vorliegenden Ausgabe.
Wir wünschen Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, eine anregende Lektüre und erlauben uns noch auf die Möglichkeit eines Print-Abonnements hinzuweisen.
Tilmann Altwicker Dirk Baier Goran Seferovic Franziska Sprecher Stefan Vogel Sven Zimmerlin
Grundlagen
Basisraten in forensischen Humanwissenschaften: Grundlagen und Herausforderungen
Joëlle Ninon Albrecht; Nina Schnyder; Jérôme Endrass; Marc Graf; Dirk Baier; und Astrid Rossegger
Einzelfallorientierte Risikoeinschätzungen stützten sich auf Basisraten ab, respektive bauen auf diesen auf. Entsprechend kann das Heranziehen einer unpassenden Basisrate zu einer Verzerrung der Risikoeinschätzung führen. Die Identifikation und Auswahl geeigneter Basisraten stellt grosse Anforderungen an Fachpersonen. Im folgenden Beitrag werden die mit Basisraten verbundenen Herausforderungen geschildert und es werden die wesentlichen Faktoren dargestellt, welche bei der Nutzung von Basisraten zu berücksichtigen sind.
Inhalt
EinleitungRelevanz von Basisraten für die PraxisWas kennzeichnet eine geeignete Basisrate für Risikoeinschätzungen?Der Konflikt zwischen Spezifität und RobustheitHerausforderungen bei der Bereitstellung von BasisratenFazit und SchlussfolgerungenLiteraturverzeichnisEinleitung
Besteht bei einer Amok-Drohung eines Schülers eine relevante Ausführungsgefahr, sodass die Schule evakuiert werden muss? Soll ein Straftäter, der mehrere Raubdelikte begangen hat, auf Bewährung freigelassen werden – oder ist das Rückfallrisiko und damit die Gefahr einer Gefährdung von Dritten zu hoch? Für die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen werden geeignete Erfahrungs- respektive Referenzwerte benötigt: Rückfallraten (erneute Delinquenz) oder Ausführungsraten[1] (erstmalige Delinquenz nach auffälligem Verhalten) von Personen, die im Hinblick auf zentrale Merkmale mit der zu beurteilenden Person vergleichbar sind. Diese Rückfallraten werden auch Basisraten genannt. Die Basisrate entspricht der Häufigkeit, in der eine Straftat oder ein Rückfall in einem definierten Zeitintervall und einer bestimmten Population vorkommt.[2] Basisraten können unterschiedlich gewonnen werden, wobei zwei methodische Vorgehen besonders häufig sind:
Ein Ansatz zur Gewinnung von Basisraten ist die Untersuchung von Wiederverurteilungsraten von abgeurteilten Straftätern. Ausgehend von einer Population, die sehr breit (z.B. alle verurteilten Straftäterinnen und Straftäter) bis zu sehr eng (z.B. weibliche Straftäterinnen, die wegen Betrugs verurteilt wurden) gefasst sein kann, wird der Anteil derer ermittelt, welche im definierten Zeitintervall rückfällig geworden sind.
Ein anderer Ansatz ist die Schätzung von Rückfallraten gestützt auf epidemiologische Modelle, wie dies in aktuarischen Instrumenten zur Risikoeinschätzung erfolgt. Aktuarische Instrumente schätzen das Rückfallrisiko unter Einbezug verschiedener Merkmale wie beispielsweise Alter, Vorstrafenbelastung und Tatmerkmalen quantitativ und erlauben die Zuordnung einer Person zu einer Risikokategorie, für die erwartete Rückfallraten (Basisraten) hinterlegt sind. Allerdings haben verschiedene empirische Studien gezeigt, dass solche Instrumente die Rückfallrate deutlich überschätzen und sie somit keine angemessene Quantifizierung des Rückfallrisikos ermöglichen.[3] Die mangelnde Replizierbarkeit der in den Risikokategorien hinterlegten Basisraten könnte Ausdruck einer fehlenden Kalibrierung für den Kulturraum und die Zeitepoche sein, in dem die Instrumente (die häufig in einem anderen Kulturraum und einer anderen Zeitepoche entwickelt wurden) eingesetzt werden. Etablierte und in der Praxis vielfältig eingesetzte aktuarische Instrumente zur Risikoeinschätzung wurden auf der Grundlage von Daten aus den 1970er und 1980er Jahren entwickelt und kalibriert. Vor dem Hintergrund, dass Rückfallraten deutlichen zeitlichen Veränderungen unterliegen,[4] ist es wenig überraschend, dass Modelle, die auf einer mehrere Jahrzehnte alten Datengrundlage basieren, ungeeignet sind, um heute zuverlässig das Rückfallrisiko einer Person einzuschätzen. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass aktuarische Instrumente meist auf Daten nordamerikanischer Stichproben beruhen und die Übertragbarkeit auf den deutschsprachigen Raum zweifelhaft ist. Dies zum einen wegen der sehr unterschiedlichen Prävalenzen von Gewaltkriminalität und zum anderen aufgrund der Differenzen, die aus den unterschiedlichen Rechtssystemen resultieren.
Während also die in aktuarischen Instrumenten zur Risikoeinschätzung ausgewiesenen Rückfallwahrscheinlichkeiten zu wenig valide sind, um verwendet zu werden,[5] liefern sie sehr hilfreiche Informationen zum relativen Rückfallrisiko im Sinne von «höher/tiefer als bei den meisten straffällig gewordenen Personen». Validierungsstudien haben gezeigt, dass mit aktuarischen Instrumenten zur Risikoeinschätzung das Rückfallrisiko zuverlässig in Relation zur gesamten Straftäterschaft geschätzt wird.[6] Somit ist der Hinweis darauf, dass jemand in einem aktuarischen Instrument zur Risikoeinschätzung den Prozentrang 25 erzielt hat und somit drei Viertel der untersuchten Straftäterpopulation einen höheren Wert aufweisen, sehr nützlich. Diese relative Angabe muss dann aber noch verankert werden. Die Basisrate aus Rückfallstatistiken kann einen solchen Anker darstellen und erlaubt eine Quantifizierung des Rückfallrisikos. Dies ist relevant, da semantische Kategorien wie «geringes» oder «hohes» Risiko einen Interpretationsspielraum zulassen, den quantitative Angaben wie «20%» zumindest schmälern.[7] Rückfallraten stellen so in einem mehrstufigen Prozess der Risikoeinschätzung die Grundlage für eine valide Risikokommunikation dar.[8]
Relevanz von Basisraten für die Praxis
Im forensischen Kontext sind Basisraten sowohl für die Einschätzung des Ausführungsrisikos angedrohter Handlungen als auch für die Einschätzung des Rückfallrisikos straffällig gewordener Menschen relevant. Die Basisrate hat zum einen die Funktion, eine erste Orientierung in einem mehrstufigen Prozess der Risikoeinschätzung zu liefern und zum anderen ist sie in der Regel die einzige robuste Grundlage zur Quantifizierung des Risikos.
Basisraten liefern statistische Durchschnittswerte, die eine wichtige Grundlage für Risikoeinschätzungen von Fachpersonen in der Rolle als Sachverständige oder Behandler sowie für Entscheide von Fachpersonen der Strafverfolgung und des Justizvollzugs sind. Es verhält sich ähnlich wie bei Prognosen in der Medizin, beispielsweise im Bereich der Überlebenschancen bei Krebserkrankungen: Die konkrete Diagnose an sich ist bereits informativ, weil der entsprechende Durchschnittswert (also die Basisrate) herangezogen werden kann. Um eine individuelle Krankheitsverlaufsprognose machen zu können, muss diese Initialschätzung durch individuelle Charakteristika angereichert werden. Dies kann beispielsweise bei einem Tumor die Histologie (Gewebestruktur), das Ausmass der Streuung, die genetische Vulnerabilität sowie die Ansprechbarkeit auf ein Cytostatikum betreffen. Auf die forensische Risikoeinschätzung übertragen bedeutet dies, dass Basisraten einen Ausgangswert darstellen, der zwingend unter Einbezug relevanter Merkmale wie beispielsweise eine mögliche sexuelle Präferenzstörung oder die Ausprägung der Psychopathie angepasst werden muss.
Basisraten liefern also einen Referenzrahmen, der unter anderem bei der Beurteilung der Ausführungsgefahr und dem Einsatz von Ressourcen hilfreich sein kann. In einer Schweizer Opferbefragungsstudie wurden beispielsweise 139 Tätlichkeitsdrohungen berichtet, aber nur 18 Fälle leichter Gewalt, die keine medizinische Behandlung erforderten, und drei Fälle schwerer Gewalt, bei denen eine medizinische Behandlung nötig war.[9] Somit sind Drohungen wesentlich häufiger als tatsächliche Gewaltausübungen und es kann davon ausgegangen werden, dass das Aussprechen einer Drohung allein nicht auf eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Überschreitung der Handlungsschwelle hinweist. Anders ist die Situation beispielsweise bei Stalking-Fällen: Hier kommt es in einem von drei Fällen zu einer Gewaltanwendung und in etwa einem von 10 Fällen zu sexueller Gewalt.[10] Ausgehend von der Basisrate kann also auf eine Ausgangswahrscheinlichkeit geschlossen werden, welche die Interventionsnotwendigkeit und das Risikomanagement massgeblich beeinflusst.
Gleichzeitig sind Basisraten, wie einleitend geschildert, auch Ausgangspunkt für individuelle Risikoeinschätzungen beispielsweise im Rahmen von Begutachtungen.[11] Demnach ist das übergeordnete Vorgehen bei der Risikoeinschätzung, dass zunächst das statistische Risiko ausgewiesen wird. In einem zweiten Schritt wird ausgehend von der Basisrate die Risikoeinschätzung individualisiert. Dieses Vorgehen steht auch im Einklang mit dem aktuellen Fragenkatalog der Schweizerischen Staatsanwaltskonferenz für die Begutachtung, der die Bezugnahme auf Basisraten fordert.
Nicht zuletzt sind Basisraten auch relevant, weil sie Informationen über eine mögliche Überschätzung des Rückfallrisikos liefern. Basisraten haben nämlich wahrscheinlichkeitstheoretische Auswirkungen: Der positive Vorhersagewert, also der Anteil der tatsächlich rückfälligen Täter in der Gruppe der ursprünglich prognostizierten, ist eine Funktion der Basisrate.[12] Bei sehr seltenen Ereignissen, also sehr tiefen Basisraten, ist der positive Vorhersagewert auch bei hoher Trefferquote tief.[13] Je tiefer die Basisrate, desto kleiner wird auch die Anzahl Fälle, die überhaupt korrekt identifiziert werden können. Das heisst, bei sinkender Basisrate wird es immer schwieriger, eine korrekte positive Prognose zu machen. Das ist eine relevante Erkenntnis, der in der Praxis selten Rechnung getragen wird. Dabei muss sie bei der Interpretation des Resultats eines Prognoseinstruments unbedingt berücksichtigt werden.[14] Der positive Vorhersagewert und damit auch die Basisrate sind also wichtige Parameter, um die Aussagekraft von Instrumenten zur Risikoeinschätzung im jeweiligen Kontext zu beurteilen. Und diese Aussagekraft ist letztlich zentral in der Beweiswürdigung von strafrechtlichen Gutachten durch die Rechtsanwender.
Insgesamt sind Basisraten für die Praxis im Kontext des Justizvollzugs, des Bedrohungsmanagements bzw. der forensischen Psychiatrie und Psychologie unerlässlich. Damit deren Verwendung jedoch auch sinnvoll erfolgen kann, müssen sie mehreren Anforderungen gerecht werden.
Was kennzeichnet eine geeignete Basisrate für Risikoeinschätzungen?
Die Identifikation von geeigneten Basisraten als Grundlage für eine Risikoeinschätzung im Einzelfall ist anspruchsvoll, weil die Stichprobe, die als Referenz herangezogen wird, der zu beurteilenden Person im Hinblick auf risikorelevante Merkmale möglichst ähnlich sein sollte.
Die Verwendung ungeeigneter Basisraten kann bedeutsame negative Konsequenzen mit sich bringen: Dadurch wird ein falscher Anker als Ausgangspunkt für die Individualprognose gesetzt und Fehlinformationen werden mit einer Scheinsicherheit berichtet. Wird beispielsweise für die Risikoeinschätzung eines siebzigjährigen Straftäters die Basisrate nicht alterskorrigiert, erfolgt eine deutliche Risikoüberschätzung, da die Rückfälligkeit in dieser Altersgruppe nicht einmal mehr halb so hoch ist wie bei jungen Erwachsenen.[15]
Der Nutzen von Basisraten bei einer konkreten Risikoeinschätzung ist folglich an ihre Geeignetheit gebunden.[16] Diese Geeignetheit betrifft mindestens zwei Cluster von Faktoren:
Einerseits muss die zugrundeliegende Referenzpopulation hinsichtlich zentraler Merkmale, die das Rückfallrisiko beeinflussen, passend sein: Basisraten müssen geschlechts- und altersspezifisch gewählt werden, da sich die Rückfallraten zwischen Männern und Frauen massgeblich unterscheiden[17] und die Basisraten mit zunehmendem Lebensalter deutlich abnehmen.[18] Des Weiteren ist die Spezifität für ein Delikt oder eine Deliktskategorie eine zentrale Anforderung an Basisraten, da sie zwischen verschiedenen Delikten erheblich differieren können. Beispielsweise zeigte sich im Projekt Legalbewährung aus Deutschland, dass 28% der straffällig gewordenen Personen nach sexueller Nötigung oder Vergewaltigung in einem Zeitraum von drei Jahren mit irgendeinem Delikt rückfällig wurden, jedoch nur etwa 1.5% einschlägig rückfällig wurden und erneut ein Sexualdelikt begingen.[19] Nach Diebstahldelikten kam es hingegen in rund 40% der Fälle zu einem Rückfall, wobei etwa die Hälfte der Rückfälle ein erneutes Diebstahldelikt war.[20] Somit gilt es bei der Auswahl einer Basisrate, sowohl das Bezugs- als auch das Zieldelikt festzulegen und passend zur Fragestellung zu verwenden. Bedeutsam ist auch, ab welcher Phase einesStrafverfahrens