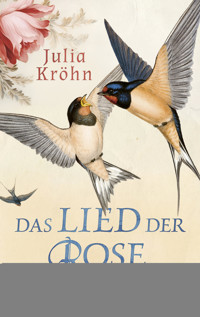9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Riviera-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Farben des Südens, kristallklares Wasser und ein Sommer in San Remo, der zwei junge Frauen für immer zusammenschweißt ...
Frankfurt 1922: Als Salome zum ersten Mal vom Meer hört, hat sie sofort wunderschöne Bilder von funkelnden Weiten vor Augen. Ihr Traum, einmal selbst im Meer zu schwimmen, wird wahr, als ihr Vater, der Besitzer eines Reisebureaus, den Tourismus im sonnigen Italien ausbauen will – und zwar nirgendwo sonst als in San Remo an der malerischen Riviera. Um dort Fuß zu fassen, kooperiert er mit dem Hotelier Renzo Barbera. Und nicht nur beruflich sind die Familien bald eng verbunden, denn Salome schließt Freundschaft mit Renzos Tochter Ornella. Doch dann wirft der erstarkende Faschismus erste Schatten auf das Paradies und erschwert weitere Reisen. Die Ereignisse überschlagen sich, als sich Ornella in den Sohn eines französischen Unternehmers verliebt, dem auch Salome näher kommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Frankfurt 1922: Als Salome zum ersten Mal vom Meer hört, hat sie sofort wunderschöne Bilder von funkelnden Weiten vor Augen. Ihr Traum, einmal selbst im Meer zu schwimmen, wird wahr, als ihr Vater, der Besitzer eines Reisebureaus, den Tourismus im sonnigen Italien ausbauen will – und zwar in San Remo, an der malerischen Riviera. Um dort Fuß zu fassen, kooperiert er mit dem Hotelier Renzo Barbera. Und die Familien sind nicht nur beruflich bald eng verbunden, denn Salome schließt Freundschaft mit Renzos Tochter Ornella. Doch dann wirft der erstarkende Faschismus erste Schatten auf das Paradies und erschwert weitere Reisen. Die Ereignisse überschlagen sich, als sich Ornella in den Sohn eines französischen Unternehmers verliebt, dem auch Salome näherkommt …
Autorin
Die große Leidenschaft von Julia Kröhn ist nicht nur das Erzählen von Geschichten, sondern auch die Beschäftigung mit Geschichte: Die studierte Historikerin veröffentlichte – teils unter Pseudonym – bereits über dreißig Romane. Nach ihrem jüngsten Erfolg, »Das Modehaus«, ein Top-20-SPIEGEL-Bestseller, folgt nun mit ihrem Riviera-Zweiteiler die nächste opulente Familiensaga vor schillernder Kulisse, für die sie an den Originalschauplätzen recherchiert hat.
Informationen unter: http://juliakroehn.at/
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Julia Kröhn
Riviera
Der Traum vom Meer
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Julia Kröhn
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
© 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com (lukaszimilena; SCOTTCHAN) und Ildiko Neer / Trevillion Images
Karte: © Daniela Eber
KW · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24497-2V001
www.blanvalet.de
Die Leidenschaft des Reisens ist das weiseste Laster,
welches die Erde kennt.
Bruno H. Bürgel
1922−1923
Erstes Kapitel
Salome war acht Jahre alt, als sie zum ersten Mal vom Meer hörte. Bis dahin kannte sie nur den Main, der ihre Heimatstadt Frankfurt teilte und der manchmal in der Sonne glitzerte, viel öfter aber schlammig grün war. Und sie kannte den Waldsee in Raunheim, wohin ihr Vater sie einmal mitgenommen hatte. Sein Reisebureau bot Ausflugsfahrten in den Taunus an, und er wollte prüfen, ob sich ein Abstecher zum See lohnte. Er hatte ihr versprochen, mit den bloßen Händen eine Forelle zu fangen, doch ehe sie das Wasser erreicht hatten, war er knöcheltief im schlammigen Ufer stecken geblieben, ausgerutscht und hingefallen.
»Wir wollen die Forellen leben lassen«, hatte er großmütig entschieden.
Dass es neben Flüssen und Seen, Bächen und Tümpeln ein Gewässer gab, dessen einzige Grenze der Himmel war, erzählte Salome lange Zeit niemand. Als es schließlich doch geschah, war sie nicht nur der frühen Kindheit entwachsen, zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihre Großmutter bereits drei Mal umgebracht.
Tilda Sommer hatte die Erziehung des Mädchens übernommen, nachdem seine Mutter im Kindbett gestorben war, denn wenn er nicht gerade Forellen fangen wollte, war der Vater in seinem Reisebureau beschäftigt. Es oblag also ihrer Verantwortung, dass die Kleine nicht auf Abwege geriet und das häusliche Glück untergrub, und das verhinderte man am besten, wenn der Tag mit sinnvollen Tätigkeiten gefüllt war.
Eine dieser Tätigkeiten war das Klavierspiel, und das Mindeste, was Tilda verlangte, war, zwei Stunden täglich zu üben. Allerdings hielt sie sich meist schon nach zehn Minuten die Ohren zu, denn Salome versuchte keine bekannten Melodien nachzuspielen, sondern drückte auf die Tasten, um Töne zu erschaffen, als rieselte Tau über Grashalme oder hämmerten Zwerge in unterirdischen Höhlen an Waffen.
Eines Tages begnügte sich Tilda nicht mit dem drohenden »Du bringst mich noch ins Grab!« Sie seufzte nur und sagte: »Jetzt, genau jetzt geschieht’s!«
Ihre Finger, die ansonsten auf den Deckel des Klaviers klopften, um einen Rhythmus vorzugeben, verkrampften sich zur Faust. Mit dieser Faust schlug sie sich auf die Brust, dann sackte sie mit dem Oberkörper auf den Klavierkorpus. In dieser äußerst unbequemen Haltung verweilte sie nicht lange, nein, sie rutschte hinunter auf den Boden. Salome hatte gerade jene hohen Töne geklimpert, die eine Forelle machte, wenn sie durch türkisfarbenes Wasser schoss. Erst als auch die dunklen hinzukamen – eine dreckerstarrte Hand versuchte, die Forelle zu packen –, sah sie die Großmutter wie tot neben dem Klavier liegen.
Salome war erstaunt. Irgendwann hatte sie gehört, dass die Augen von Toten weit aufgerissen wären, die der Großmutter aber waren geschlossen. Was sie auch irgendwann gehört hatte, war, dass Augen augenblicklich die Farbe verloren. Ob sie ganz schwarz oder weiß wurden, wusste sie allerdings nicht. Sie kniete sich neben Tilda, versuchte, die Lider zurückzuziehen. Es stellte sich heraus, dass die Augen immer noch braun waren. Und es stellte sich ebenfalls heraus, dass Tilda Sommer noch lebte.
»Das ist ja die Höhe!«, schrie sie und fuhr hoch. »Anstatt vor Scham und Trauer zu vergehen, willst du mir die Augen ausstechen?«
Als der Vater am Abend aus dem Reisebureau zurückkehrte, erzählte die Großmutter ihm alles. Arthur Sommer war ein untersetzter Mann, dessen Bäuchlein immer größer war als die Kraft in den schlaffen Oberarmen, und der in Gegenwart seiner Mutter stets um einen halben Kopf kleiner zu werden schien. Es war seine größte Angst, ihren Ärger auf sich zu ziehen, und so lauschte er konzentriert, nickte dann und wann und stellte Nachfragen. Am Ende fiel ihm aber nur eine Lösung ein.
»Vielleicht sollte Salome nicht mehr Klavier spielen«, erklärte er, und Tilda verdrehte die immer noch heilen Augen.
Wenig später starb ihre Großmutter erneut. Zu diesem Zeitpunkt hatte Tilda beschlossen, sie jeden Tag zwei Stunden lang französische Vokabeln lernen zu lassen. Nicht nur, dass Salome die Worte nicht einfach nachsprach, sie sang sie! Und überdies machte sie gern Fantasienamen daraus. Aus dem Raben – le corbeau – wurde zum Beispiel ein Corbinian Petersilian. Dieses Mal beging Tilda nicht den Fehler, ihren Tod wortgewaltig anzukünden wie beim letzten Mal. Und sie war auch nicht so dumm, auf das harte Klavier zu sacken, um dann auf die nicht minder harten Eichendielen zu fallen. Unauffällig positionierte sie sich vor dem Kanapee, stieß ein letztes Ächzen aus und sank – mit dem Gesicht voran – auf den Brokatstoff.
»Elle est morte«, erklärte Salome.
Diesmal stellte sie keine Untersuchungen zur Augenfarbe an, etwas anderes war jedoch nicht minder interessant für sie. Seit sie denken konnte, hatte sie ihre Großmutter nie ohne die schwarze Witwenhaube auf dem Kopf gesehen. Salome hatte sich oft gefragt, ob die Haube mit dem Kopf verwachsen war, und nun hatte sie die Gelegenheit, das herauszufinden. Ganz vorsichtig zog sie daran – zumindest behauptete sie selbst das später. Als Tilda japsend von den Toten auferstand, warf sie ihr vor, sie habe ihr die Haare ausgerissen, anstatt sie zu betrauern.
Arthur Sommer lauschte den Klagen stirnrunzelnd und sorgenvoll seufzend. Am Ende war sein Vorschlag aber nur: »Vielleicht sollte sie nicht mehr Französisch lernen.«
Seine Mutter befolgte ihn nicht. Schließlich hatte Salome elle est morte – sie ist tot – grammatikalisch korrekt ausgesprochen, solch hoffnungsfrohe Ansätze wollte sie nicht im Keim ersticken. Es dauerte ein paar Wochen, bis die härteste aller Erziehungsmaßnahmen weiteren Einsatz fand, weil Salome einmal mehr etwas unaussprechlich Schreckliches getan hatte.
An diesem Tag waren sie in einer der vielen Alleen im Westend spazieren gegangen, und ausnahmsweise hatte Tilda Salome erlaubt, Kastanien zu sammeln. Mit deren Stängeln – gewaschen, zurechtgeschnitten und mit Wachs überzogen – verzierte man nämlich Marzipanobst. Das Problem war nur, dass Salome in das, was eine Birne darstellen sollte, nicht nur einen Stängel steckte, sondern deren viele, sodass das Stück Marzipan am Ende einem Igel glich. Der Pflaume gab sie gar ein Gesicht, und zwar eines mit weit geöffnetem Mund, und den Apfel schmückte sie so, dass er Ähnlichkeiten mit einer Schildkröte hatte.
»Mit Essen spielt man nicht!«, sagte Tilda streng.
Salome blickte sie aus ihren haselnussbraunen Augen eindringlich an. »Die Kastanienstängel dienen nur der Dekoration, man isst sie ja nicht.«
»Seiner Großmutter widerspricht man nicht!«, rügte Tilda. »Du solltest dankbar sein, dass du so etwas wie Marzipan naschen darfst. Als du geboren wurdest, herrschte Krieg, und damit du genügend Milch bekommen konntest, habe ich mir jeden Bissen vom Mund abgespart. Wochenlang habe ich nichts als Pferdefleisch und Steckrüben gegessen.«
Salome ergriff wortlos ein weiteres Marzipanstück. Eigentlich hätte dieses zu Weintrauben geformt werden sollen, doch sie machte ein Pferd daraus – wobei der Schweif so groß war wie ein fünftes Bein.
Mit dem Marzipanpferd hatte sie die Großmutter versöhnlich stimmen wollen, doch jene war überzeugt, dass sie üblen Spott mit ihr trieb. Und weil sie sicher war, dass kein Tadel reichen würde, blieb ihr nichts anderes übrig, als vom Küchenstuhl auf den Boden zu fallen und dort reglos liegen zu bleiben. Leider bestand der Küchenboden aus Stein, war also nicht nur hart, auch kalt, aber Strafe musste sein. Wenn das Mädchen ordentlich erschrak, würde es künftig genauer darüber nachdenken, was es tat und sagte.
Salome erschrak nicht. Sie hatte gelernt, dass ihre Großmutter regelmäßig wieder zum Leben erwachte, wenn man nur lange genug wartete. Und sie hatte auch gelernt, dass man sie in dieser Zeit besser nicht anfasste. Sie formte für das Marzipanpferd noch ein Marzipanfohlen, war allerdings noch nicht bei dessen drittem Bein angekommen, als die Küchentür geöffnet wurde.
»Was ist passiert?«, vernahm sie eine weibliche Stimme. Nein, die Frau, die ihren Kopf durch den Türspalt steckte und die noch sehr jung zu sein schien, höchstens zwanzig Jahre alt, fragte eigentlich: »Was ist passierrrrrt?«
Und genau genommen steckte sie nicht den Kopf durch den Türspalt, nur Unmengen ihrer schwarzen Locken. Sie waren viel kleiner als jene weichen Wellen, in denen Salomes rotbraunes Haar über ihre Schultern fiel, und man sah unter ihnen kaum die Augen. Die Frau war Paola und lebte seit Kurzem in dem kleinen Mansardenzimmer, das zur Sommer’schen Wohnung gehörte, zur Untermiete.
Salome steckte das vierte Bein des Fohlens in ihren Mund. »Meine Großmutter ist gestorben«, flüsterte sie.
Paolas Gesicht, dessen olivfarbener Hautton eigentlich viel dunkler als Salomes alabasterner war, wurde bleich. Und man konnte nun doch die Augen erkennen. Sie waren schwarz und weiteten sich, als sie rief: »Madonna mia!«
»Ach, sie ist schon zum dritten Mal gestorben, ich denke, sie kommt bald wieder zu sich.«
Tilda rührte sich kein Jota, weswegen Paola scheu näher trat. »Vielleicht ist sie nicht gestorben, vielleicht ist sie nur ohnmächtig geworden. Habt ihr etwas Riechsalz?«
Salome zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht einmal, was das ist.«
Paola zuckte ebenfalls mit den Schultern. »Wenn ich es recht im Kopf habe, ist es eigentlich Hirschhornsalz, das gewonnen wird, indem man das Geweih eines Hirsches zu einem feinen Pulver reibt.«
Salome überlegte, aus welchem Marzipanstück sie einen Hirsch mit riesigem Geweih formen konnte, aber das musste warten. »Hirschhornsalz haben wir nicht, nur richtiges Salz«, erklärte sie und führte Paola zum Küchenschrank, in dem etliche weiße Keramikgefäße nebeneinander aufgereiht standen. Sie waren mit goldenen Lettern beschriftet, die – auf Französisch, nicht auf Deutsch – verrieten, was sich darin befand.
»Das muss es sein«, erklärte Salome und deutete auf das Gefäß mit der Bezeichnung SEL.
Paola nahm es an sich und starrte etwas ratlos darauf. »Ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit Wasser mischen und sie nass spritzen oder ihr das Salz ganz schlicht und ergreifend unter die Nase halten sollen.«
Schließlich trat sie entschlossen zur Großmutter, kniete sich neben sie, öffnete den Behälter.
Tilda Sommer fuhr hoch. »Seid ihr verrückt geworden! Ihr wolltet mir tatsächlich Grieß ins Gesicht schütten?«
»Warum denn Grieß?«, fragte Paola verdutzt.
»Es steht doch SEL darauf«, kam Salome ihr zu Hilfe.
Tilda schüttelte den Kopf, worauf es in ihrem Nacken knackste. Sie rappelte sich mühsam auf, worauf es nun auch im Rücken knackste. Immerhin schaffte sie es, drohend den Zeigefinger zu heben, ohne dass sich die morschen Knochen meldeten. Sie deutete erst in Salomes, dann in Paolas Richtung.
»Ich habe Salz und Grieß ausgetauscht. Wenn sich der Grieß im Salzbehälter befindet, lassen ihn die Küchenschaben in Ruhe.«
»Die Küchenschaben können lesen?«, fragte Paola erstaunt.
»Und sie verstehen Französisch?«, fügte Salome hinzu.
»Nun«, Tilda hatte keine Lust, sich über die sprachlichen Fähigkeiten von Küchenschaben auszulassen, »Sie, werte junge Dame, können anscheinend nicht lesen. In Ihrem Mietvertrag steht, dass Sie stets im Mansardenzimmer zu verbleiben und sich nicht hier unten blicken zu lassen haben.«
»Hätte ich Sie denn einfach tot liegen lassen sollen?«, gab Paola zurück, und in ihren dunklen Augen blitzte es.
Tilda ließ den Zeigefinger sinken, aber nur, weil sie sich aufstützen musste.
»In meiner Küche haben Sie jedenfalls nichts verloren. Salome, begleite sie wieder nach oben!«
Salome verließ die Küche nur allzu gern, allerdings nicht ohne ein paar Marzipanfiguren einzustecken. Auf der Treppe, die hoch zum Mansardenzimmer führte, setzten sie und Paola sich und verspeisten sie.
»Wie es sich wohl anfühlt, wenn man wirklich tot ist?«, fragte Salome und gab sich selbst die Antwort: »Ich glaube, sobald man im Sarg ganz tief unter der Erde liegt, kommen Tiere, gegen die die Küchenschaben noch harmlos sind, um den Körper langsam aufzufressen. Man … Man spürt jeden Bissen.« Zumindest war das das Schicksal, das Tilda den unartigen Kindern zugedachte.
»Madonna mia!«, rief Paola erneut. »Was ist das für ein Unsinn. Zu sterben fühlt sich an, als würde man im Meer treiben, ganz weit draußen und am Abend, wenn die Fluten einen roten Schimmer angenommen haben. Das Wasser ist gar nicht kalt, es ist warm und weich, während man langsam untergeht.«
Salome blickte sie verwirrt an. »Was ist denn das Meer?«
»Du kennst das Meer nicht?« Paola lachte rau, stieß dann noch einige Male Madonna mia! aus, erklärte schließlich, dass sie aus Italien stamme, einem Land, das fast nur von diesem Meer umgeben und in dem fast immer Sommer sei. Das Meer sei ein Gewässer, das keinen Anfang und kein Ende habe und an manchen Stellen so tief sei, dass kein Mensch je dorthin vorgedrungen war.
Salome kaute am Marzipan und lauschte interessiert. Richtig vorstellen konnte sie sich das Meer nicht.
Dass Paola seit mittlerweile zwei Monaten in der Mansarde lebte, blieb für Tilda Sommer ein Ärgernis. »Wenn die Zeiten bloß nicht so schlimm wären!«, rief sie oft.
»Sind sie etwa schlimmer als die Zeiten, da es nur Pferdefleisch und Steckrüben zu essen gab?«, fragte Salome, als sie sie einmal mehr klagen hörte.
Tilda blickte sie lange an, überlegte, ob sich hinter diesen Worten eine wie auch immer geartete Beleidigung verbarg, winkte sie dann mitzukommen. Aus der gläsernen Vitrine holte sie einen Porzellanteller mit goldenem Rand, auf dem sich das lorbeerumkränzte Konterfei eines bärtigen Mannes in Uniform befand. Der Bart wirkte ziemlich spitz, ob sich der Löffel wohl daran stach, wenn man eine Suppe aß?
Tilda Sommer sprach nicht von Suppen. »Es war ein Opfer für Kaiser und Vaterland, dass ich jahrelang darbte, und dieses Opfer habe ich gern erbracht. Jetzt aber haben wir keinen Kaiser mehr, und deswegen schützt uns keiner vor unserem Bürgermeister. Der ist der Meinung, dass in Frankfurt Wohnungsnot herrscht und leerstehende Mansardenzimmer und Kellerräume vermietet werden müssen. Gottlob ist unser Mansardenzimmer so klein, dass uns eine ganze Familie mit greinenden Bälgern erspart bleibt. Dass hingegen in unserem feinen Wohnviertel Pack Einzug erhält, können wir nicht verhindern.« Sie hauchte auf den Teller, polierte ihn, bis er glänzte, fügte raunend hinzu: »Es gibt ein Gerücht, wonach alle Menschen, die auf ein Mansardenzimmer angewiesen sind, schon mindestens einmal im Zuchthaus gesessen haben. Und für Menschen aus Italien gilt das sowieso.«
Alles, was Salome bisher über Italien gehört hatte, hatte rein gar nichts mit ihren Vorstellungen von einem Zuchthaus gemein. Sie wartete, bis ihre Großmutter den Teller wieder weggestellt und sich mitsamt Spitzenhäubchen auf dem Kopf zum Mittagsschlaf gebettet hatte, dann schlich sie hoch ins Mansardenzimmer.
Der Raum war nicht hoch genug, als dass ein groß gewachsener Mann hätte aufrecht stehen können, bot jedoch nicht nur Platz für ein Bett, auch für ein weiteres Möbelstück – jenes Kanapee, auf das Tilda Sommer, als sie zum zweiten Mal gestorben war, gesunken und dessen vierter Fuß gebrochen war. Für Paola reichten drei heile Füße, unter den fehlenden vierten hatte sie einen Blumentopf geschoben, an dem noch ein paar verwelkte Blätter einer Zimmerpalme hafteten. So gut wie kein Licht drang in den Raum, denn das winzige ovale Fenster war mit Zeitungspapier zugeklebt – und zwar sehr altem, wie die Schlagzeilen verrieten: Der Kaiser hat abgedankt. Thronverzicht des Thronfolgers. Ebert wird Reichskanzler.
Kaum ein Fleckchen Boden war nicht mit Kleidern, Schuhen und Haarbändern bedeckt, und sämtliche Bilderrahmen, in denen im Übrigen keine Bilder hingen, waren verstaubt. Wo Reinlichkeit fehlt, da fehlt alle Anmut, Lieblichkeit und Wärme, sagte Tilda stets seufzend. Salome fand es dagegen recht gemütlich. Nachdem Paola sie lächelnd in den Raum gewinkt hatte, setzte sie sich neben sie auf das Kanapee, das nur ein wenig knarrte, nicht zusammenbrach.
Paola hielt sich eine Glasscheibe vors Gesicht, die sie als Spiegel nutzte, und schminkte sich. Die Tiegelchen und Döschen lagen auf dem ungemachten Bett verstreut, einige waren umgefallen, hatten bunte Flecken verursacht. Für eine derartige Untat würde Tilda wohl keine Worte finden, die Tatsache, dass eine Frau sich Farbe ins Gesicht schmierte, würde sie gar als gefährlich werten, hatten doch Schönheitsmittel aller Art die Zerstörung der Gesundheit zur Folge. Paola machte allerdings nicht den Eindruck, dass sie krank war. Ihr Gesicht nahm zwar mehr und mehr Ähnlichkeit mit dem befleckten Bett an, aber Salome fand sie wunderschön. Derart versunken in ihren Anblick versäumte sie die Frage zu stellen, wegen der sie hergekommen war, sodass Paola irgendwann hochblickte, sie von der Seite musterte und fragte: »Willst du auch etwas Rouge auftragen?«
»Ich?«, rief Salome erstaunt.
»Bist du nicht deswegen gekommen?«
Salome schüttelte den Kopf, nahm allen Mut zusammen, stieß endlich hervor: »Ich wollte wissen, wie es im Zuchthaus war.«
Paola zog gerade mit einem schwarzen Stift die rechte Augenbraue nach. Ihre Hand zitterte nicht, obwohl sie den Mund sehr weit aufriss, um zu erklären: »Grrrauenhaft.« Während sie die andere Braue nachzog, schilderte sie die schrecklichen Arbeiten, die sie im Zuchthaus hatte verrichten müssen. »Ich musste Abfälle sortieren. Mit den Kartoffelschalen und Apfelschalen wurde das Vieh gefüttert, die Eierschalen bekamen die Hühner zu fressen, und mit den abgenagten Knochen wurden Felder gedüngt.«
»Hühner fressen ganze Eierschalen?«, fragte Salome.
»Nein, eben nicht! Man muss sie mit einem Mörser mahlen, bis nur mehr Staub bleibt, und den mischt man später unters Futter. Und natürlich werden nicht ganze Knochen auf den Feldern verstreut, auch diese werden kleingerieben. Kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das ist?«
Salome zuckte die Schultern. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Arbeit ist, die man in einem Zuchthaus zu tun hat.«
»Das stimmt«, gab Paola unumwunden zu.
Während sie sich den Mund mit einem dunklen Himbeerrot ausmalte, verriet sie, dass sie noch nie in ihrem Leben im Zuchthaus gewesen sei, jedoch eine Zeit lang als Dienstmagd gearbeitet habe. Ihre Herrschaften seien schlimmer als jeder Kerkermeister gewesen.
»Du hast dich gewiss zurück nach Italien gesehnt«, murmelte Salome.
Paola ließ den Lippenstift sinken. »Mein Vater stammte von dort, ich selbst war noch nie in Italien.«
»Das heißt, du hast auch noch nie das Meer gesehen?«
»Ich habe es zumindest gefühlt. Mein Vater war ein Zauberer, musst du wissen. Er kannte einen Trick, mit dem er jeden Menschen glauben machen konnte, er blicke auf das Meer, atme die frische Brise ein, fühle die warme Sonne auf der nackten Haut. Ich erzähle dir irgendwann mehr davon, aber jetzt solltest du gehen. Hör doch, deine Großmutter ruft nach dir, und wir wollen ihr nicht zumuten hochzukommen. Nicht dass sie uns wieder stirbt.«
Paola zwinkerte Salome verschwörerisch zu, was dazu führte, dass die Schminke verwischte. Salome fand sie immer noch schön. Paolas Gesicht verhieß das Gleiche wie das unaufgeräumte Zimmer – dass sie nie wieder an Langeweile leiden würde, wenn ihre Großmutter ihren Mittagsschlaf hielt.
Auch über diese Stunde hinaus wurde es bald ein Leichtes, regelmäßig mit Paola zu plaudern. Nachdem sie vier Monate bei Familie Sommer gelebt hatte, kam Tilda eine Idee, wie sie die Schande, eine Untermieterin zu haben, ausmerzen konnte – indem sie besagte Untermieterin nämlich nicht verjagte, sie jedoch zum Hausmädchen machte. Schließlich war es immer schwieriger geworden, den Bekannten und Nachbarn zu verschweigen, dass das bisherige gekündigt hatte, weil es keinen Lohn mehr bekommen hatte. Paola musste man keinen Lohn zahlen, ihr nur die Miete erlassen.
»Dafür komme ich aber nur jeden vierten Tag«, hatte Paola verkündet, was Tilda zähneknirschend akzeptierte, obwohl Paola ihr – wie übrigens auch Salome – die Antwort schuldig blieb, was sie die übrigen drei Tage machte.
Das Erste, was Paola als Hausmädchen zu machen hatte, war, den Inhalt sämtlicher Porzellanbehälter umzufüllen: Reis sollte sie mit Mehl tauschen, Zimt mit Pfeffer und Milchpulver mit Grieß. Salome saß auf dem Boden, wohin jede Menge Mehl und Milchpulver und Zimt rieselten, und malte Blumen in den Staub.
»Ich finde, wir sollten die Küchenschaben noch mehr verwirren«, erklärte Paola, »und da sie bereits Französisch verstehen, habe ich mir überlegt, ihnen auch Italienisch beizubringen.«
Die Küchenschaben verstanden das offenbar als Drohung, sie ließen sich nicht blicken. Allerdings wollte Salome ebenso gern Italienisch lernen, und während Paola den Boden aufwischte – nicht gründlich genug, wie Tilda später tadelnd feststellte –, brachte sie ihr die ersten Brocken bei.
Vier Tage später folgte die nächste Lektion. »Il mago«, ließ sie Salome nachsprechen.
»Was heißt das?«
»Das heißt Zauberer, ich habe dir doch erzählt, dass mein Vater ein Zauberer war und einen ganz besonderen Trick kannte.«
Salome wollte gern mehr über diesen Trick erfahren, doch vorerst lag ihr eine andere Frage auf den Lippen. »Hat dein Vater denn am Meer gelebt?«
Paola schüttelte den Kopf, und Salome erfuhr zu ihrer Überraschung, dass es in Italien doch nicht nur das Meer und die Sonne gab, sondern zudem die weite Po-Ebene, wo ständig Mücken surrten, aber auch viel Getreide wuchs, was bedeutete, dass die Menschen immer reicher und die Mücken immer dicker wurden. Und dann waren da weitere Gegenden, in die sich keine Mücken wagten und wo leider kein Getreide wuchs, was bedeutete, dass die Menschen dort immer ärmer wurden. Die Orte trugen zwar liebliche Namen wie Belluno oder Tarvisio, waren aber von vielen schroffen Bergen umgeben, durch die keine Straßen führten, nur alte Ziegenpfade, und in deren Tälern keine Städte errichtet worden waren, nur unscheinbare Hütten. Die Menschen schliefen darin auf Betten aus Reisig, nicht auf Matratzen, trugen kratzige Kleidung aus selbst gesponnener Schafwolle und aßen nur Polenta.
»Das heißt, manchmal aßen sie etwas anderes. Sie kannten schließlich das geheimnisvolle Rezept, von dem ich dir erzählt habe.«
»Ich dachte, dein Vater kannte einen Trick.«
Paola füllte auf Tildas Befehl hin gerade das nächste Porzellangefäß um, wieder staubte es auf den Boden, wieder malte Salome Blumenmuster hinein. Paola überlegte eine Weile, sprach dann davon, dass viele Menschen die Dörfer verlassen hatten – einige, um in den reichen Po-Ebenen zu schuften, was allerdings bedeutete, dass ihre Rücken von Mücken zerstochen wurden, andere, wie der Vetter ihres Vaters, um nach Argentinien auszuwandern, wo es auch Mücken gab, der Wind aber so stark wehte, dass sie sich nicht in Ruhe auf Menschen- und Tierleiber niederlassen konnten. Ihren Vater wiederum hatte es nach Hamburg verschlagen. Paola sagte nicht Hamburg, sie sagte Amburgo, und wie alle Orte, die sie erwähnte, klang es wie der Name eines Zauberlandes. »Dort hat er mithilfe der geheimnisvollen Rezeptur Träume zubereitet«, fuhr Paola fort.
Salome kannte nur das Rezept von Bethmännchen. Für diese brauchte man Mandeln, Rosenwasser, Eigelb und Puderzucker. Träume hatten aber wohl eine andere Konsistenz, Träume waren schließlich ganz leicht und konnten fliegen.
»Hat er ein Soufflé gebacken?«, fragte sie.
Paola lachte. »So etwas Ähnliches. Die Träume meines Vaters gab es in allen möglichen Farben, in Grün und Rot und Blau und Braun. Allen gemein war, dass sie süß waren. Und da so viele Menschen von den Träumen kosten wollten, gestatteten sie Italienern wie meinem Vater, ohne Visum nach Hamburg zu reisen und dort zu bleiben.«
Salome dachte fieberhaft nach. »Sahen die Träume etwa wie Bonbons aus?«
»Hm.« Paola wiegte den Kopf. »Mit Bonbons hatten die Träume meines Vaters zumindest gemein, dass sie in großen kupfernen Kesseln zubereitet wurden. Jeden Morgen rührte er zwischen sechs und neun Uhr die Zutaten zusammen.«
»Und dann wurden sie gebacken?«
»Madonna mia, Träume dürfen doch nicht warm werden! Nein, er füllte sie in zylinderförmige gekühlte Metallbehälter und zog diese mit einem Kastenwagen durch die Straßen. Der Kastenwagen wurde von einem purpurroten Baldachin überragt, und an ihm war eine Drehorgel befestigt, die immer dieselbe Melodie spielte.«
»Welche Melodie?«
»Nun, die Marcia Reale, die Hymne der Italiener, die sie glauben machen sollte, sie wären ein Volk, obwohl die Menschen in der Po-Ebene so reich sind und die Menschen in den Bergen so bitterarm.« Paolas Stimme nahm einen bitteren Klang an, aber das Lächeln blieb süß, als sie fortfuhr: »Viva il Re! Viva il Re! Viva il Re!, spielte die Drehorgel, aber die Hamburger verstanden das natürlich nicht. Viele verstanden auch nicht, dass es Träume waren, die mein Vater verkaufte. Sie behaupteten, seine Ware schmecke widerlich, Männer wie er würden die guten Sitten und seine Träume die Gesundheit ruinieren, erst recht, wenn man sie auf leerem Magen genieße. Es wurde sogar verboten, die Träume an Kinder unter vierzehn Jahren zu verkaufen, waren sie angeblich doch ebenso schädlich wie Zigaretten und Schnaps. Was für ein Unsinn. Von den Träumen meines Vaters wurde man nicht krank! Wenn sie langsam auf der Zunge schmolzen, wusste man, was das Meer ist, auch wenn man es nie gesehen hatte, und es glitzerte im hellsten Türkis, selbst wenn der Tag noch so grau war.« Paola schmatzte genießerisch, schloss die Augen. Als sie sie wieder öffnete, schimmerten Tränen darin. »Gewiss, im Winter konnte mein Vater die Träume nicht verkaufen, im Winter röstete er in den Kupferbehältern Kastanien und verkaufte sie zur Marcia Reale. Auch diese waren köstlich, nur nicht ganz so süß und erst recht nicht so bunt. Sie brachten die Menschen nicht dazu, vom Meer zu träumen, wie es das gelato tat.«
»Gelato?«
»Das heißt … Speiseeis. Mein Vater war Eisverkäufer.«
Dieses italienische Wort blieb nicht das letzte, das Salome lernte. Paola brachte ihr auch das Wort für Krieg bei, guerra. »Obwohl es schön klingt, verheißt es etwas Grässliches«, sagte sie kummervoll.
Nach diesem Krieg wurden die Italiener nämlich als Verräter bezeichnet, was ihren Vater nicht nur gegrämt, nein, ihn am Ende ins muore mai, ins Land, in dem man niemals starb, getrieben habe.
»Wo befindet sich dieses Land?«, fragte Salome.
»Keine Ahnung. Ein Märchen, das mir mein Vater oft erzählt hat, handelt jedenfalls davon.«
»Und wie sieht es dort aus?«
»Keine Ahnung«, sagte Paola wieder. »Wahrscheinlich wie im Knoblauchwald, der in einem anderen Märchen vorkommt. Der Knoblauch treibt dort Tausende weißer Blüten. Und im muore mai schwimmen wohl Tausende von diesen weißen Blütenblättern auf dem Meer. Mein Vater … Mein Vater wurde eine davon.«
»Er ist also gestorben«, stellte Salome fest.
Paola nickte nur, wischte sich die Tränen ab, verrieb auf diese Weise einmal mehr ihre Schminke.
»Meine Mutter ist auch tot«, sagte Salome leise. »Willst du … Willst du meine Mutter sein?«
»Madonna mia!«, rief Paola nun wieder mit fester Stimme. »Ich bin doch nicht alt genug, um deine Mutter zu sein.« Als sie sah, dass Salomes Unterlippe zu zittern begann, fügte sie allerdings schnell hinzu: »Nein, deine Mutter werde ich nicht sein, aber so etwas wie eine sorella.«
Sorella, erfuhr Salome, hieß Schwester.
Ein halbes Jahr war Paola nun Salomes sorella, wenngleich nur das Mädchen sie so nannte, niemals Tilda. Die bezeichnete sie weiterhin als Hausmädchen, das nunmehr jeden zweiten Tag kam und dafür sogar bezahlt wurde. Tilda beklagte sich zwar häufig über die klebrigen Böden und darüber, dass man an Paolas staubtrockenen Kuchen fast erstickte. Sie sprach während dieser Tage aber immer seltener von etwas, das in Salomes Ohren so furchterregend wie guerra klang – der Inflation.
Paola wusste nicht, was Inflation auf Italienisch hieß. Ein anderes Wort hingegen kannte sie nur auf Italienisch, nicht auf Deutsch. Piscina.
»Was genau ist das?«, fragte Salome.
»Das ist so etwas wie eine riesige Badewanne, in der man das Meer einzusperren versucht«, erklärte Paola.
Salome wusste nicht genau, was eine Badewanne war. Einmal in der Woche ging sie mit Tilda ins Volksbrausebad, wo man für ein paar Pfennige nicht nur ein Handtuch und eine Seife in die Hand gedrückt bekam, sondern sich überdies in einem kleinen Wellblechgebäude unter eine der fünf Brausen stellen konnte. Jedes Mal, wenn sie es verließen, erklärte Tilda: »Irgendwann werden wir wie andere Familien auch ein Bad in der Küche oder im Schlafzimmer haben.«
Salome hatte sich bis jetzt keine Gedanken darüber gemacht, wie ein solches Bad aussah, Paola erklärte indessen, eine Badewanne sei so etwas Ähnliches wie das Wasserklosett, das es in ihrer Wohnung immerhin bereits gab. »Nur ist die Badewanne viel größer als das Klosett. Und eine piscina wiederum ist viel größer als eine Badewanne.«
Erst als Paola hinzufügte, dass man darin schwamm, anstatt sich darin zu waschen, erkannte Salome, worauf sie hinauswollte.
»Du meinst ein Schwimmbecken!«, rief sie. »So wie die Mosler’sche Badeanstalt eines hat.«
»Warst du schon einmal dort?«, fragte Paola.
»Ich kann nicht schwimmen.«
»Dann bringe ich es dir bei.«
»Und wenn ich untergehe?«
»Warum solltest du untergehen? Tiere gehen im Wasser auch nicht unter, sie beginnen zu strampeln.«
Salome runzelte die Stirn und überlegte, welches Tier so groß und schwer war, dass es sich unmöglich über Wasser halten konnte. Ihr Vater hatte ihr einmal von Afrika erzählt und dass es dort Tiere gab, die Hörner auf der Stirn trugen. Sie wusste nicht mehr genau, wie diese hießen.
»Einhörner können nicht schwimmen«, sagte sie nun.
»Einhörner gibt es ja auch nur im Märchen«, erwiderte Paola lachend.
Das Lachen verging ihr, als sie Tilda vorschlug, Salome in der Mosler’schen Badeanstalt das Schwimmen beizubringen.
»Wo denken Sie hin! Schwimmen läuft dem weiblichen Charakter zuwider!«, lehnte Tilda entrüstet ab.
»Sagt wer?«
»Sagt Meyers Konversations-Lexikon.«
Dieses Buch war für Tilda von ähnlich großer Bedeutung wie der Ratgeber von Henriette Davidis Der Beruf der Jungfrau. Als Paola sie skeptisch anblickte, zog Tilda ihn aus dem Regal, schlug ihn auf der entsprechenden Seite auf und hielt ihn ihr unter die Nase.
»Hier wird nur vom Besuch einer Badeanstalt abgeraten, in der Frauen und Männer gemeinsam schwimmen«, sagte Paola, nachdem sie die Zeilen gelesen hatte. »In diesem Fall würde die sinnliche Reizung die Wirkung des Bades vereiteln.«
Salome hatte keine Ahnung, was eine sinnliche Reizung war. Als sie Paola später fragte – Tilda hatte das Konversationslexikon längst wieder zugeschlagen –, konnte diese es auch nicht erklären. Vielleicht, kamen sie zum Schluss, war damit so etwas gemeint wie zu tief in der Nase zu bohren. Prompt fiel Salome der Name des afrikanischen Tieres wieder ein, von dem der Vater ihr erzählt hatte.
»Nashörner können auch nicht schwimmen!«
»Warum sollten sie es nicht können?«, gab Paola zurück. »Und glaub mir: Du wirst es noch diesen Sommer lernen.«
Tatsächlich änderte Tilda Sommer ihre Meinung drei Tage später. Es war am frühen Morgen, als sie wieder einmal einen Ratschlag aus Henriette Davidis’ Jungfrauenbuch umsetzte. Für ein junges Mädchen, stand darin, war es nicht nur wichtig, dass es Ordnung hielt, bescheiden war und alles erlernte, um dem Mann ein wohliges Heim zu schaffen, nein, es müsste auch stets eine gerade Haltung einnehmen. Und um diese Haltung zu erreichen, sollte es sich zweimal täglich – nach dem Aufstehen und vor dem Zubettgehen – an zwei hölzerne Ringe hängen, die mit Stricken an Deckenbalken befestigt waren. Dort musste es so lange wie möglich verharren, während ihm der Rücken mit einer Mischung aus Kampfer und Seifenspiritus eingerieben wurde.
»Madonna mia!«, rief Paola wie so oft, als sie den Kopf durch die Tür zu Salomes Kinderzimmer steckte, weil die Deckenbalken so laut quietschten. Sie sah dem Treiben eine Weile kopfschüttelnd zu, ehe sie erklärte: »Gut, dass Salomes Körper nicht die gleiche Konsistenz wie ein Strudelteig hat, sonst wäre sie nun doppelt so lang wie noch gestern.«
Das Rezept für den Strudelteig stammte aus dem Wiener Kochbuch, das Tilda Paola am Tag zuvor in die Küche gelegt hatte, damit ihre Kuchen nicht mehr so staubtrocken wurden.
Bei der Vorstellung, ein Strudelteig zu sein, musste Salome so heftig kichern, dass sie die Holzringe losließ und auf das Bett plumpste. Tilda fuhr grimmig zu Paola herum.
»Wie fördern denn Italienerinnen wie Sie den schönen Wuchs einer jungen Maid?«
»Oh, durch nichts wird ein gerader Rücken besser erreicht als durch regelmäßiges Schwimmen«, erklärte Paola. Und ehe Tilda einmal mehr auf Meyers Konversations-Lexikon verweisen konnte, schob sie hinterher: »Am Sachsenhäuser Ufer östlich der Alten Brücke gibt es übrigens ein Schwimmbad nur für Damen.«
Tilda suchte nach einem Gegenargument, aber weil ihr keines einfiel, befahl sie Salome lediglich knapp, sich wieder an die Ringe zu hängen. Am Ende überließ sie ihrem Sohn die Entscheidung, ob Salome schwimmen lernen sollte oder nicht, und Arthur Sommer stellte als einzige Bedingung, dass das nicht im Raunheimer See geschehen würde, weil die Ufer dort so matschig waren.
Nachdem Paola am nächsten Tag einen hauchdünnen Apfelstrudel gebacken hatte, stieg sie hoch ins Mansardenzimmer, um ihre Badekleidung zu holen, während Tilda die für Salome auf ihrem Bett unter den Holzringen ausbreitete.
»Ich dachte, wir gehen schwimmen, nicht auf eine Beerdigung«, sagte Paola, als sie sie wenig später betrachtete.
Ihr Badekostüm war aus hellblauem Crêpe de Chine, hatte einen tiefen Ausschnitt und ein Röckchen, das nicht einmal bis zu den Knien reichte. Das Badekostüm, das Salome dagegen von Tilda bekommen hatte – sie war zwar ein dünnes, zugleich aber großes Mädchen, sodass es ihr halbwegs passte –, bestand nicht nur aus einem langärmeligen schwarzen Oberteil mit Kragen und Korsett, sondern außerdem einer Hose, die unter den Knien zusammengebunden werden musste. In den Saum waren sicherheitshalber Bleiblättchen eingenäht, falls der Knoten sich löste, konnte der Stoff nicht hochrutschen. Über der Hose wurde obendrein ein Rock getragen, der mit Rüschen, Borten und Schleifen besetzt war. Wie Paola meinte, glich er mehr einem Schildkrötenpanzer als einer zweiten Haut.
»Das ist ja sein Sinn und Zweck«, erklärte Tilda. »Selbst wenn der Stoff nass wird, bleibt er nicht am Körper kleben, sodass der sich für jedermann sichtbar abzeichnet.«
»Salome könnte doch wenigstens die Hosen weglassen«, schlug Paola vor.
»Unterstehen Sie sich, dieses Wort auszusprechen. Eine anständige Dame spricht nicht von Hosen, sie spricht von Beinkleidern. Und nun zieh dich um, Salome, und danach setzt du dir den Hut auf.« Sie deutete auf einen riesigen breitkrempigen Sonnenhut.
»Wenn du darunter untergehst, merke ich es erst eine Stunde später«, sagte Paola, als Tilda das Schlafzimmer bereits verlassen hatte.
Salome zuckte die Schultern. Dass Tilda ihr den Besuch der Badeanstalt erlaubt hatte, war ein so großes Entgegenkommen, sie wollte nicht auch noch auf leichter Kleidung bestehen.
Paola hingegen brachte die Hose auf eine Idee. Während Salome noch ihre Bluse aufknöpfte, stieg sie kichernd aufs Bett und band die Hosenbeine so an die hölzernen Reifen, dass sie Ärmeln glichen. Sie verknotete das Oberteil damit, sodass dieses einem Rock glich, und steckte danach den Hut zwischen den Deckenbalken fest.
»Was jetzt noch fehlt, ist ein Kopf!«, rief sie lachend. »Was könnten wir als Kopf verwenden?«
Salome kicherte. »Vielleicht das Kissen«, schlug sie vor.
»Ich fürchte, das ist zu schwer für die Hosen … Äh …«
Ratlos blickte sie sich um, und in diesem Augenblick kam Tilda zurück, betrachtete erst Paola, dann Salome, dann das dunkle Ding, das von der Decke hing. Es hatte Ähnlichkeit mit einer Vogelscheuche.
Salomes Kichern verstummte, Paola jedoch fragte ungerührt: »Haben Sie vielleicht einen Kopf für uns?«
Tilda hatte keinen Kopf für sie, sie griff sich nur wortlos an den eigenen. Vielleicht wollte sie sich die Schläfen reiben, vielleicht den entsetzten Schrei, der ihr entfuhr, dämpfen. Bevor die Hand das Gesicht erreichte, verkrampfte sie sich jäh. Sie schwankte so heftig, dass das Spitzenhäubchen verrutschte, stieß ein Ächzen aus, das keinem Laut glich, wie ihn Henriette Davidis oder Meyers Konversations-Lexikon für weibliche Lippen vorsahen. Und obwohl sie im Sterben eigentlich geübt war, kippte sie wie ein Baum um und prallte mit dem Gesicht voran auf den Boden.
Nun war auch Paola das Lachen vergangen.
»Soll ich … Soll ich das Salz aus dem Grießgefäß holen?«, fragte Salome.
»Das Salz befindet sich jetzt nicht mehr im Grieß-, sondern im Reisbehältnis«, murmelte Paola geistesabwesend. »Ich habe es erst gestern ausgetauscht.«
Sie kletterte vom Bett, wälzte Tilda auf den Rücken. Dort, wo sie mit der Stirn auf den Boden aufgeprallt war, prangte ein großer roter Fleck. Nicht der machte Salome Angst, als sie sich über ihre Großmutter beugte, aber die Augen – weit aufgerissen und starr.
Diesmal hatte Tilda sie nicht bloß getäuscht, sie war wirklich tot. Und der Tod fühlte sich nicht an, als würde man im warmen Meer geradewegs auf die rötliche Sonne zutreiben.
Der Tod war nicht warm, der Tod war nicht rötlich. Der Tod war kalt.
Salome begann bitterlich zu weinen und ließ sich nicht beruhigen. Als Paola meinte, jemand müsse ihrem Vater Bescheid sagen, weinte sie noch heftiger, und Paola entschied, bei ihr zu bleiben. Sie legten sich ins Bett, zogen sich die Decken bis zum Kinn, kuschelten sich aneinander, die kopflose Vogelscheuche hing über ihnen und flatterte im Luftzug. Irgendwann zogen sie sich die Decke über den Kopf, bis es unerträglich heiß wurde.
Der Tod war immer noch kalt.
Bevor sie auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt werden sollte, wurde Tilda drei Tage lang in einem prächtigen Ebenholzsarg mit Silberbeschlägen in der Kirche Sankt Antonius aufgebahrt. Der rote Fleck auf der Stirn hatte sich bläulich verfärbt, sodass Salomes Vater beschloss, sie nicht nur mit ihrem schwarzen Witwenkleid, sondern auch mit einem schwarzen Hut zu beerdigen.
»Der breitkrempige Strohhut fürs Baden wäre groß genug«, schlug Paola vor. Arthur Sommer blickte etwas ratlos darauf, entschied sich am Ende für einen spitzenbesetzten mit Blumen. Salome hatte keine Ahnung, wer Tilda Sommer das Häubchen abgenommen und den Hut auf ihren Kopf gesetzt hatte. Sie konnte jedenfalls nicht hinschauen, als sie am offenen Sarg ihre letzte Aufwartung machten. Und sie konnte erst recht nicht hinschauen, als am Tag der Beisetzung der Sarg geschlossen wurde. »Schade um den Hut, jetzt wird er eingedrückt«, sagte Paola.
»Und was, wenn auch die Nase eingedrückt wird?«, rief Salome entsetzt.
»Na ja, das spürt sie ja nicht mehr.«
Mit diesen Worten vergrößerte sie Salomes Entsetzen nur. Es war doch nicht möglich, nichts mehr zu spüren … nichts mehr zu sein. Sie klammerte sich an Paolas Hand, um wenigstens selbst noch etwas zu spüren … etwas zu sein, nämlich ihre sorella, und fühlte sich ähnlich getröstet wie in den vorangegangenen Nächten, da sie nicht in ihrem Bett geschlafen hatte, sondern hoch zu Paola in deren Mansardenzimmer gestiegen war.
Auch in der folgenden Nacht würde es kaum anders sein, es galt nicht nur das Begräbnis, sondern ebenso den anschließenden Leichenschmaus durchzustehen. Er fand in der Gastwirtschaft Hettrich in der Klüberstraße statt, nicht weit entfernt vom Reisebureau des Vaters. Nach der Arbeit trank Arthur Sommer dort manchmal ein Glas Bier oder Wein. Als er die Gaststube an diesem Tag betrat, erklärte er, es müsse etwas Stärkeres sein, am besten Cognac, und nachdem er das Glas gekippt hatte, waren seine Augen tiefrot, weil er ein so scharfes Gesöff nicht gewohnt war. Die Gäste dachten, er würde weinen, und um ihn zu trösten und auch, um das zähe Schweigen zu füllen, begannen sie Geschichten über Tilda Sommer auszutauschen.
Die Brüder Ries, die in der Guiollettstraße eine der ersten Frankfurter Hochgaragen errichtet hatten, erzählten, mit wie viel Empörung Tilda ihre Art, Geld zu verdienen, verurteilt hatte. Was das Automobil anbelangte, war sie nämlich derselben Meinung wie der Kaiser gewesen: Es wäre ja doch nur eine vorübergehende Erscheinung, sie glaube an das Pferd.
Vom Geschäft des Herrn Wyss aus der Schweiz, dessen Firmensitz sich an der Ecke der Taunusanlage befand, hatte sie ebenfalls keine hohe Meinung. Der Elektronkonzern verkaufte solch absonderliche Geräte wie Staubsauger, einen Dampfkochtopf, der nichts anderem als der Zubereitung von Pudding diente, und eine elektrische Brotschneidemaschine, mit der man das Brot nicht nur in Stücke schnitt, nein, gleichmäßig die Butter darauf streichen konnte.
»Was sollen denn die Frauen mit der Zeit anfangen, die sie dadurch gewinnen?«, hatte Tilda einmal zu Herrn Wyss gesagt. »Sie kämen ja doch nur auf unnütze Gedanken.«
Die Brüder Ries und Herrn Wyss hatte sie immerhin stets gegrüßt, lange Jahre jedoch nicht den jüdischen Bankier Frohmann, obwohl sich dessen Haus in ihrer Nachbarschaft befand. Zu ihrem Begräbnis kam er trotzdem, wiederholte in der Gaststube die tröstlichen Worte, die er schon auf dem Friedhof gesagt hatte: Di tsayt iz der bester dokter. Und während Salome überlegte, ob die Zeit etwa auch eine schwarze Tasche trug wie ihr Hausarzt, berichtete er, dass Tilda Sommer ihn nach dem Krieg doch noch wahrgenommen hatte. Da er bereit war, jubelnd als Held für des Reiches Herrlichkeit zu sterben und die unseligen Franzosen und Briten zu vernichten, konnte sie ihm nachsehen, dass seinesgleichen Jesus getötet hatte.
»Jetzt hert doch uff, aale Kamelle zu lehre«, schaltete sich Herr Breul, der Abteilungsleiter vom Kaufhaus Wronker auf der Zeil ein, wo Tilda Sommer oft gewesen war, aber fast nie etwas gekauft hatte. »Den Damme off de Beul haale, des is doch e gude Eigenart. Unn selwer woannse noch so geizisch war. De Käs is gesse. Und wenn de Käs gesse is, isser gesse.«
Paola blickte hoch. »Gibt es etwa Käse als Leichenschmaus?«
Es wurde kein Käse serviert, sondern Frankfurter Tafelspitz – gekochte Ochsenbrust mit Salzkartoffeln und Grüner Soße. »Liewer zu viel gesse, als zu wennisch gsoffe«, erklärte Herr Breul und machte sich über seinen Teller her.
Salome aß nur eine Kartoffel. Ihr Vater aß überhaupt nichts, sondern leerte mehrere Gläser Cognac. Als sie nach Hause kamen, stolperte er über die Stufen im Treppenhaus, rappelte sich wieder hoch, stolperte wenig später über die Schwelle ihrer Wohnung, rappelte sich wieder hoch. Salome folgte Paola ins Mansardenzimmer, und er lief ihnen unerwartet nach, stolperte dort aber über Paolas Kleidung und blieb auf dem Boden liegen.
»Kann ich auch hier schlafen?«, lallte er.
Paola hatte Salome eben erneut versichert, dass die Nase der Großmutter gewiss nicht gebrochen, gut möglich, dass sie hart wie das Horn eines Nashorns war. Nun half sie Arthur auf.
»Aber nicht auf dem Boden«, erwiderte sie. »Kommen Sie zu uns ins Bett.«
Wenn der Sarg schon viel zu eng für Tilda ist, wie sollen drei Menschen Platz in diesem schmalen Bett finden?, dachte Salome. Doch irgendwie fiel keiner hinaus. Sie konnte sich nur nicht mehr an Paola klammern, weil nun ihr Vater zwischen ihnen lag, und an ihm wollte sie sich nicht festhalten, weil seinem Mund ein säuerlicher Geruch entwich und weil er plötzlich zu weinen begann.
»Es ist schlimm, seine Mutter zu verlieren«, sagte Paola, obwohl ihre eigene, wie sie Salome erzählt hatte, zu früh gestorben war, als dass sie sich an sie erinnern konnte.
Salome sehnte sich auch nicht nach ihrer Mutter, jedoch nach der Schwester, die Paola jetzt für sie war. Sie überlegte, über ihren Vater zu klettern, blieb aber steif liegen, denn eben stieß Arthur Sommer schluchzend aus: »Ich weine doch nicht, weil ich um meine Mutter trauere. Ich weine, weil ich keine Ahnung habe, wie ich ohne ihre Hilfe mein Reisebureau führen soll.«
Zweites Kapitel
Zum Zeitpunkt von Tilda Sommers Tod war Arthur achtunddreißig Jahre alt und hatte schon viele Reisen gemacht. Mit einer Karawane war er von Kairo über Assuan nach Khartoum gezogen und von dort zu den Quellgebieten des Nils. Er war auf einem Dromedar geritten, und als seine Karawane in einen Sandsturm geriet und sich verirrte, hatte er das Dromedar geschlachtet und einen Höcker aufgeschnitten, um das Wasser, das darin gespeichert war, zu trinken. Zumindest lautete so eine Variante der Geschichte. In einer anderen war das Dromedar von einem Krokodil im Nildelta angefallen worden. In einer wieder anderen Geschichte hatte er selbst ein solches Krokodil auf einer Jagdreise durch Uganda erschossen. Es blieb nicht seine einzige Beute, er hatte obendrein zwei Flusspferde erlegt, die zwar deutlich harmloser ausgesehen hatten, aber gleichwohl gefährliche Tiere waren.
Am allergefährlichsten war jedoch seine Reise durch Abessinien gewesen, einem gänzlich unerschlossenen Land, in dem es keine Straßen gab, nur schmale Pfade für die Elefanten. Um auf einem Elefanten zu reiten, musste man ihn natürlich erst einmal ersteigen, ohne von seinen Stoßzähnen aufgespießt zu werden. Diese Stoßzähne waren mindestens so spitz wie der Dolch, mit dem Arthur den Höcker des Dromedars aufgeschnitten hatte. Oder wie der Zahn eines Dinosauriers, der im kürzlich eröffneten Senckenberg-Museum in Frankfurt zu sehen war.
Nun gut, das Senckenberg-Museum hatte Arthur Sommer wirklich besucht, die Reisen nach Ägypten und Uganda und Abessinien hatte er nur im Kopf unternommen. Leider. Er wollte so gern reisen, aber sein Vater hatte eine andere Vorstellung davon gehabt, wie man eine Reiseagentur am besten leitete, und ihm lediglich beigebracht, mit welcher Art von Reisen sich das meiste Geld verdienen ließ.
Die Reiseagentur Sommer trug erst seit der Jahrhundertwende diesen Namen. Ursprünglich war sie ein Gasthof Sommer gewesen, in dem Auswanderer nächtigten, wenn sie vom Süden Deutschlands zu den Häfen im Norden reisten. Später war aus dem Gasthof eine Auswanderungsagentur geworden, die den Gästen nicht nur ein Bett, das sie sich mit drei Mitschläfern teilen mussten, und ein wenig Proviant, bestehend aus einem Hartkäse, der selbst die lange Fahrt nach Amerika mühelos überstand, anbot, sondern ebenso die Tickets für die Fahrt nach Übersee. Damit hatte Arthurs Großvater irgendwann so viel Geld verdient, dass er die breiten Betten aus den Räumen hatte schaffen und lange genug hatte lüften lassen, bis der Geruch nach Käse, auch nach verschwitzter Kleidung und vor allem Armut, verzogen war. Er hatte ein Bureau eingerichtet, das keinem andren Zweck mehr diente, als Fahrkarten zu verkaufen. Und als es Mode geworden war, dass nicht nur verschwitzte Leute vor der Armut in eine bessere Zukunft fliehen wollten, sondern auch nobel gekleidete Menschen ferne Länder bereisen, war aus der Auswanderungsagentur eine Reiseagentur geworden. »Und zwar die älteste Reiseagentur«, pflegte Arthur Sommer senior stolz zu sagen.
Er verschwieg, dass es, wenn überhaupt, nur die älteste in Frankfurt war. Rominger in Stuttgart gab es schon viel länger, und lange vor diesem hatte in Berlin bereits Carl Stangen Gesellschaftsreisen angeboten.
Mittlerweile zog es jedenfalls viele Menschen in die Ferne, und mittlerweile war die Arbeit der Agentur nicht mehr nur auf das Ausstellen von Fahrscheinen beschränkt. Das nahm zwar viel Zeit in Anspruch, waren doch lediglich für die gängigen Strecken die Tickets vorgedruckt, alle anderen hatte man handschriftlich auszufüllen. Aber es gab noch vieles andere zu erledigen – mithilfe von Hotel-Coupons Übernachtungen zu verkaufen, persönliche Reiseführer zu verfassen oder Listen mit Trinkgeldern, die man in anderen Ländern vergab, zu erstellen.
Während Arthur über dieser Arbeit saß, unternahm er im Kopf weitere Reisen. Er schlug sich durch das ewige Eis und fischte mit den Eskimos in Alaska und an der grönländischen Küste, wobei er nicht sicher war, ob Eskimos weiße Gesichter hatten, weil sie im Schnee lebten, oder schwarze, weil sie schließlich rückständige Wilde waren. Zweifellos schwarz waren die Indianer, die nur mit Lendenschurz bekleidet den Amazonas entlang zum Fuß der Anden ruderten. Ob er in ihrer Gesellschaft auch nur einen Lendenschurz oder lieber einen Leinenanzug tragen würde, wusste er nicht so genau, ganz sicher unternähme er keine Reise ohne seinen Tropenhut.
Die Anden waren in Arthurs Fantasien noch nicht erreicht, als im wirklichen Leben – im Jahr 1909 nämlich – der Vater starb. Arthur ließ über dem Eingangsbereich einen Trauerflor anbringen und das Schild darunter austauschen. Fortan hieß die Reiseagentur Reisebureau, weil das Arthurs Meinung nach weltmännischer klang. Er begnügte sich nicht mit dieser Veränderung. Wochenlang brütete er über einer Route für die Weltreise, die er künftig anbieten würde. Es bedurfte zwar viel Planung und Organisation, aber unmöglich war es nicht, alles bis ins letzte Detail vorzubereiten. Schließlich ließen sich für sämtliche Dampfer- und Eisenbahnverbindungen der Welt Fahrkarten zwei Jahre im Voraus buchen. Und wer das einmal gemacht hatte, wusste, dass das Ausstellen eines Tickets von Panama nach San Francisco oder von Borneo nach Neu-Guinea keine größeren Umstände machte als das einer Fahrt von Hamburg nach Helgoland.
Als er die Reiseroute zusammengestellt hatte, fragte Herr Theodor: »Wäre es nicht angängig, dass sich Ihre honette Frau Mutter davon nicht nur frappiert, gar affrontiert fühlt?«
Herr Theodor war ein Mitarbeiter des Reisebureaus, der eine überaus schöne Handschrift hatte, sich nie verrechnete, aber anders als Arthur rein gar nichts von der Welt wusste. Seine Sprache hatte die Färbung des letzten Jahrhunderts, und er zog das Schreibpult dem neumodischeren Tisch vor. Steif wie ein Stock, wie er war, war das gerade Stehen wohl die einzige Haltung, die seinem Charakter entsprach. Wahrscheinlich, dachte Arthur manchmal gönnerhaft, würde er die Fische der Eskimos mit Messer und Gabel essen, nicht einfach mit der Hand, und den ersten Bissen erst in den Mund nehmen, nachdem er »Wünsche wohl zu speisen« gemurmelt hätte.
Nun, er wusste es besser. Herr Theodor wiederum kannte Arthurs Mutter besser.
Kurz darauf kam Tilda ins Reisebureau, wischte sich über die Augen, als sie den Trauerflor sah, schüttelte den Kopf, als sie auf dem Schild Reisebureau statt Agentur las, und ließ sich von Arthur seine Pläne zeigen. Er war noch nicht aus Europa herausgekommen, als sie ihm bereits ins Wort fiel.
»Was ist denn das für ein Unsinn?«
Arthur zog die Schultern hoch. »Ich will nicht in Frankfurt hocken und versauern. Ich will die große, weite Welt sehen! Ich will in die Fremde!«
»Ich erzähle dir was über diese Fremde«, gab Tilda Sommer ungerührt zurück. »Dein Vater hat sich einst eingebildet, auf Gesellschaftsreise nach Ägypten zu gehen, und weil ich auf ihn aufpassen musste, habe ich ihn begleitet. Ich habe mich auf das Schlimmste gefasst gemacht, als das Schiff in Alexandria einlief, aber erstaunlicherweise machte die Stadt einen recht vernünftigen Eindruck. Ich meine, die Menschlein, die da herumlaufen, haben zwar allesamt schwarze Gesichter, aber als ich eines herbeiwinkte und es fragte: ›Du da, kleiner Mufti, kannst du unsere Sachen tragen?‹, ja, weißt du, was dieses Ding da zu mir sagte? ›Sehr wohl, Madame!‹«
Ihre Stimme hatte an Schärfe gewonnen, die sich Arthur nicht erklären konnte. »Hat euch das Menschlein etwa eure Koffer geklaut, anstatt sie ins Hotel Khedivial zu bringen?«, fragte er.
Mit der Erwähnung des Hotelnamens wollte er der Mutter beweisen, wie viel auch er von Alexandria wusste, doch die achtete nicht auf solche Details, schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie, »die Koffer sind unbeschädigt angekommen. Aber dass dieses schwarze Ding fehlerfreies Deutsch gesprochen hat, war doch die Höhe! Gut, dass ich mich an der Strickleiter festgehalten habe, ich wäre vor Schreck ins Wasser gefallen. Man will doch in die Länder reisen, um die Wilden zu beobachten. Aber der einzige Wilde war ein Herr aus unserer Reisegruppe, der mit seinem Spazierstock ständig auf ägyptische Händler einschlug. Zugegeben, die Skarabäen und die mumifizierten Finger, die sie uns andrehen wollten, waren nicht echt. Aber Betrüger findet man auch hier. Wie viele Händler der städtischen Markthalle wollen dir einreden, dass ihr plumper Sauermilchkäse ›Fromaasch de Brie‹ ist? Um übers Ohr gehauen zu werden, musst du keine weite Reise machen. Man hat uns übrigens nicht einmal zugemutet, auf Eseln zu reiten. Und im Hotel gab es warmes Wasser und eine Badewanne.«
Die Verärgerung über diesen Umstand konnte Arthur nun doch etwas nachvollziehen. Dass ein ägyptisches Hotel mehr Komfort versprach als die eigene Wohnung, war gewiss eine Kränkung. Er rang dennoch um Widerworte, wollte einwenden, dass für die restliche Welt nicht gelten musste, was für Ägypten galt. Doch da schob seine Mutter die Reisepläne schon zur Seite.
»Dein Vater hat kurz vor seinem Tod gesagt, es komme gerade in Mode, innerhalb von Deutschland zu verreisen. Die Leute haben schließlich nicht viel Geld, aber für eine kurze Sommerfrische oder eintägige Ausflüge reicht es. Du wirst künftig Rundgänge durch Frankfurt anbieten, wozu der Besuch des Doms ebenso gehört wie der einer Apfelweinwirtschaft in Sachsenhausen. Und du wirst Ausflüge in den Taunus anbieten, nach Kronberg und Königstein und all den anderen Burgen. Selbstverständlich wirst du selbst die Führung übernehmen, für die Omnibusfahrscheine sorgen und Gasthöfe für Übernachtungen auswählen.«
Sie redete noch weiter, schmückte ihre Pläne aus, doch Arthur hörte nicht mehr richtig zu. Bis jetzt war es ihm leichtgefallen, sich fremde Länder vorzustellen, aber nun schien die Welt in seinem Kopf zur Wüste zu werden, obendrein einer, über der der Nebel waberte. Er war zwar nicht sicher, ob es in der Wüste Nebel gab, aber was wusste er schon. Wahrscheinlich war es gemütlicher, am Schreibtisch zu sitzen oder mit einer Reisegruppe durch den Taunus zu spazieren, als einen Lendenschurz anzuziehen.
Die Stimme der Mutter verstummte, eine andere meldete sich zu Wort. »Haben Sie wohlfeil bedacht die Entscheidung getroffen, dass forthin das Reisebureau Ihrer Führung anheimgestellt ist, Frau Sommer?«, fragte Herr Theodor.
»Ich?«, rief Tilda ganz erschrocken. »Wie käme ich dazu? Sagen Sie nicht, dass Sie das nicht durch und durch schockant fänden, Herr Theodor! Die liebste Aufgabe der Frau ist es, durch Aufmerksamkeit und treue Pflichterfüllung den Mann zu beglücken und ihm das häusliche Leben zu verschönern. So habe ich es bei meinem Mann gehalten, so werde ich es bei meinem Sohn halten. Wie käme ich dazu, ihm Vorschriften zu machen. Was weiß ein schlichtes Frauchen darüber, wie man ein Reisebureau führt.« Sie hielt kurz inne. »Die Reisegruppen sollten nie mehr als zwölf Personen überschreiten. Versuche vor allem, das gehobene Bürgertum anzusprechen, beim Adel ist, so leid es mir tut, nicht mehr viel zu holen. Ich denke, du solltest einen Fotografen engagieren, der Bilder vom Taunus macht, im Sommer, Herbst und Winter. Und wenn du wirklich etwas Fremdes sehen willst, dann geh in den Frankfurter Zoo. Dort gibt es exotische Tiere mit Hörnern auf der Stirn. Wie heißen sie noch?«
In Arthurs Kopf waberte immer noch der Nebel. Er konnte sich solch ein Tier nicht vorstellen. Er konnte sich plötzlich auch nicht mehr den Amazonas und die Savanne und das Nildelta vorstellen.
»Einhörner«, murmelte er.
»Unsinn! Ich rede von Nashörnern. Und jetzt gehe ich nach Hause, um für dich ein feines Mahl zuzubereiten.«
Als Arthur nach Hause kam, servierte seine Mutter pünktlich das Abendessen, aß aber selbst nichts, sondern machte weitere Pläne, die in den kommenden Wochen und Monaten immer mehr Gestalt annahmen. Arthur übernahm sie willig und vergaß irgendwann, dass es nicht die eigenen Pläne waren. Die Ausflugsfahrten, die das Reisebureau anbot, sollten demnach unter dem Motto »Wir wandeln auf den Spuren der deutschen Kaiser« stehen.
In Eppstein gab es schon seit Jahrhunderten eine Burg, aber erst seit fünfzehn Jahren den Kaisertempel. Da die Burg schon genügend Besucher gesehen hatte, konnte man sie getrost vernachlässigen, den Kaisertempel aber ganz ausführlich inspizieren. Die Wanderungen auf dem Feldberg mussten wiederum über jene Wege führen, die Kaiser Wilhelm erst kürzlich genommen hatte. Leider kam Arthur auf steileren Wegstrecken immer schnell außer Atem.
Etwas gemütlicher war der Ausflug nach Kronberg, wo er Geschichten von Kaiser Friedrich erzählte. Der hatte im Jahr 1888 nur neunundneunzig Tage lang geherrscht und in dieser Zeit sämtliche seiner Befehle auf Zetteln notiert, anstatt sie laut auszusprechen. Den Grund hierfür – der Kaiser litt an Kehlkopfkrebs – teilte Arthur den Reisegruppen natürlich nicht mit. Wie es sich anfühlte, wenn es einem die Sprache verschlug – ihm geschah das jeden Tag beim Abendessen mit seiner Mutter –, wusste er selbst dagegen ganz genau. Da der Kaiser nach kurzer Zeit im Amt gestorben war, war er selbst zwar nie nach Kronberg gekommen, aber seine Gattin Victoria hatte diesen Ort als Witwensitz auserkoren.
Pflichtgemäß berichtete Arthur seinen Reisegruppen von der Trauer der Kaiserin und dass sie bis zuletzt behauptet hatte, ihr Leben sei nur ein Schatten dessen, was es hätte sein können. Bevor er sich zu gefährlich an den Gedanken heranwagte, dass auch sein Leben nur ein Schatten war, begann er den Gruppen von den Reisen zu erzählen, die er in seiner Jugend angeblich unternommen hatte. Die interessierten »Ahs!« und »Ohs!« vertrieben den Nebel in seinem Kopf, ganz deutlich konnte er wieder die fremden Länder vor sich sehen, und die Geschichten, die er sich ausdachte, wurden mit der Zeit zunehmend wilder. Mit den Amazonasindianern ruderte er nicht länger, er machte Jagd auf Piranhas. Mit den Eskimos wiederum fischte er nicht nur mehr, er röstete mit ihnen Schlangen auf dem Herdfeuer.
Niemand fragte, ob es im ewigen Eis von Grönland wirklich Schlangen gab, und deswegen rechnete er auch nicht mit Widerspruch, als er beim nächsten Ausflug behauptete, die Krokodile im Nildelta sprächen Deutsch.
Ein glockenhelles Lachen ertönte. Es kam von ganz hinten, wo ein Fräulein mit ungemein dicken Zöpfen stand. Alles andere an ihr war dünn. Das Lächeln war so liebreizend, wie die Sommersprossen es waren, und die Augen vom Farbton der Kornblumen waren es erst recht. Arthur versank regelrecht in ihrem Anblick.
»Krokodile können doch nicht sprechen!«, rief das Fräulein.
»Nun ja, ich habe auch nicht die Krokodile gemeint, sondern die schwarzen Muftis, die auf ihnen reiten.«
Das Lachen wurde lauter.
»Welche Geräusche machen Krokodile eigentlich?«, fragte ein Herr aus der Reisegruppe.
Arthur hatte keine Ahnung, runzelte die Stirn.
»Uaaaaah«, machte das Fräulein beherzt.
Wie konnte aus einem solch süßen Gesicht nur ein solch grollender Laut kommen! Lange hielt er im Übrigen nicht an, dann begann das Fräulein zu husten. Arthur wagte es nicht, ihm auf den Rücken zu klopfen, schlug nun aber den Besuch der Gastwirtschaft Adler vor. Hier vergaß er ganz und gar, von der berühmten Malerkolonie zu erzählen, die einst an diesem Ort gewohnt hatte. Stattdessen blickte er stumm in die kornblumenblauen Augen, hatte er doch gegenüber dem Fräulein Platz genommen, und umklammerte mit beiden Händen sein Apfelweinglas, um deren Zittern zu verbergen.
Es dauerte eine Weile, bis er einen Schluck nehmen konnte, und noch länger, bis er sich krächzend zu fragen überwand: »Wer sind Sie?«
Weiter hinten ertönten die Klänge eines Akkordeons. Der Wirt spielte immer auf, wenn er mit seiner Reisegruppe kam – was diese für einen Zufall hielt, während Arthur ihn in Wahrheit dafür bezahlen musste. Für Extrageld sang er wie an diesem Tag eine Volksweise aus dem Taunus:
»Wer lieben will, muss leiden. Ohne Leiden liebt man nicht. Sind das nicht süße Freuden, wenn die Lieb von beiden spricht? Wer Rosen will abbrechen, der scheu die Dornen nicht. Wenn sie gleich heftig stechen, genießt man doch die Frucht.«
»Hm«, sagte das Fräulein, »wer ich bin? Vielleicht eine … Rosenzüchterin?«
»Wirklich?«
»Unsinn. Das habe ich mir nur ausgedacht. In Wahrheit bin ich Opernsängerin.«
»Wirklich?« fragte Arthur wieder und verschluckte sich fast.
»Nein«, das Fräulein lachte, »auch das habe ich mir nur ausgedacht. Aber in der Frankfurter Oper arbeite ich in der Tat.«
Von der Frankfurter Oper wusste Arthur bislang nur, dass sie Tilda verärgerte. Ein Opernbesuch war zwar kein solch frivoles Vergnügen wie der Besuch des Kinematografen, doch sie verstand nicht, warum das Bockenheimer Tor nun Opernplatz hieß. Da sich alles auf dieser Welt so schnell veränderte, sollte man sich doch wenigstens auf die Namen verlassen können.
Der Name des jungen Fräuleins war Erika, wie es ihm nun verriet, desgleichen, dass es in einer Oper mehr Aufgaben gab, als nur zu singen. »Ich muss den Sängern zum Beispiel den Schweiß abtupfen, wenn sie wieder einmal am Lampenfieber leiden«, berichtete Erika lachend. Arthur war nicht sicher, ob sie flunkerte. Er war ja auch nie sicher, wann er selbst flunkerte. Wenn er von seinen Reisen erzählte, glaubte er in diesem Augenblick immer, er hätte sie tatsächlich unternommen. »Und manchmal«, fuhr sie fort, »tupfe ich Blut ab.«
Nun war er sich sicher, dass sie log. »Das ist doch nicht möglich!«
»Oh, doch, aber ich meine natürlich kein echtes Blut. Eigentlich wurde ich angestellt, um auf der Bühne regelmäßig Staub zu wischen, aber als ich eines Tages sah, dass ein Bühnenbild beschädigt war, habe ich es repariert. Der Requisiteur war so begeistert, dass er mir manchmal Arbeiten übertrug. Jüngst zum Beispiel …«
Arthur fiel ein, dass er doch mehr von der Oper wusste als gedacht, er sogar eine kannte. »Haben Sie den Drachen für den Ring der Nibelungen gebaut?«, rief er aufgeregt. »Und sah der womöglich wie ein Krokodil aus?«