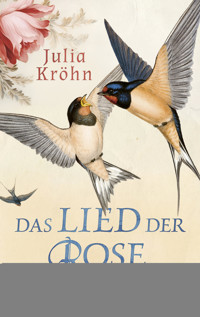9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Riviera-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Farbenpracht der Riviera, die Wirren des Krieges und zwei junge Frauen im Ringen um Zukunft, Glück und Freiheit ...
Frankfurt, 1938: Für die Nazis gilt die Sehnsucht nach Italien als »urdeutscher Trieb«, und Reisen dorthin erfreuen sich weiter großer Beliebtheit. Salome nutzt die Trips nach Rom, die das Reisebüro ihres Vaters organisiert, um jüdischen Familien zur Ausreise aus Deutschland zu verhelfen. Als Mussolini diese nicht länger in seinem Land duldet, flieht sie mit ihnen über das Mittelmeer nach Frankreich. Auf einem ihrer waghalsigen Unternehmen begegnet sie Félix, und die Gefühle von einst sind wieder da. Als der Krieg aufflammt und die deutsche Wehrmacht Frankreich überrennt, wird die Lage für die jüdischen Emigranten immer prekärer – und Salome und Félix müssen sich zwischen Liebe und Widerstand entscheiden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Frankfurt, 1938: Für die Nazis gilt die Sehnsucht nach Italien als »urdeutscher Trieb«, und Reisen dorthin erfreuen sich weiter großer Beliebtheit. Salome nutzt die Trips nach Rom, die das Reisebüro ihres Vaters organisiert, um jüdischen Familien zur Ausreise aus Deutschland zu verhelfen. Als Mussolini diese nicht länger in seinem Land duldet, flieht sie mit ihnen über das Mittelmeer nach Frankreich. Auf einem ihrer waghalsigen Unternehmen begegnet sie Félix, und die Gefühle von einst sind wieder da. Als der Krieg aufflammt und die deutsche Wehrmacht Frankreich überrennt, wird die Lage für die jüdischen Emigranten immer prekärer – und Salome und Félix müssen sich zwischen Liebe und Widerstand entscheiden ...
Autorin
Die große Leidenschaft von Julia Kröhn ist nicht nur das Erzählen von Geschichten, sondern auch die Beschäftigung mit Geschichte: Die studierte Historikerin veröffentlichte – teils unter Pseudonym – bereits über dreißig Romane. Nach ihrem jüngsten Erfolg, »Das Modehaus«, ein Top-20-SPIEGEL-Bestseller, folgt nun mit ihrem Riviera-Zweiteiler die nächste opulente Familiensaga vor schillernder Kulisse, für die sie an den Originalschauplätzen recherchiert hat.
Weitere Informationen unter: http://juliakroehn.at/
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Julia Kröhn
Riviera
Der Weg in die Freiheit
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Julia Kröhn
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
© 2020 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Margit von Cossart
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (PIXEL to the PEOPLE; SCOTTCHAN) und Elisabeth Ansley/Trevillion Images
Karte: © Daniela Eber
KW·Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24498-9 V002
www.blanvalet.de
Karte
Was bisher geschah …
Arthur Sommer führt ein renommiertes Reisebureau in Frankfurt – und sein Name wird zum Programm. Als die lebenslustige Italienerin Paola in sein Leben tritt, möchte er den Tourismus im Süden ausbauen. Bis jetzt zieht die mondäne Riviera die Gäste vor allem im Winter an, gilt die Sommerhitze am Mittelmeer doch als unerträglich und gesundheitsschädlich. Während einer Reise nach San Remo im Jahr 1923 erkennt er aber, dass Urlaub am Mittelmeer auch in der wärmsten Jahreszeit möglich ist. Er läutet die Geburt des modernen Badeurlaubs ein.
Bald arbeitet Arthur eng mit dem italienischen Hotelier Renzo Barbera zusammen: Er investiert in die Renovierung dessen Hotels in San Remo. Und nicht nur beruflich sind die Familien bald eng verbunden. Salome, Arthurs Tochter aus erster Ehe, schließt Freundschaft mit Renzos schüchterner Tochter Ornella, die bis jetzt stets im Schatten ihrer älteren Halbbrüder Gedeone und Agapito stand.
Nachdem Ornella Salome vor dem Ertrinken rettet, sind die Mädchen fortan unzertrennlich. In den kommenden Jahren verbringen sie jeden Sommer gemeinsam in San Remo. Doch 1929 legt sich ein Schatten auf das Paradies. Der erstarkende Faschismus vergiftet immer mehr den Alltag. Und was am schlimmsten ist: Renzos und Arthurs Zusammenarbeit endet abrupt, als das faschistische Regime allen italienischen Hotels und Tourismusunternehmen eine klare Weisung erteilt, die Beziehungen mit ausländischen Reiseagenturen einzustellen.
Salome und Ornella halten über Briefe Kontakt, erst Ende 1932 sehen sie sich wieder. Aus den beiden Mädchen sind mittlerweile junge Frauen geworden. So unterschiedlich sie auch sind – Salome selbstbewusst und voller Lebensgier, Ornella still und scheu –, ihre Freundschaft ist ungebrochen. Nicht zuletzt auf ihr Betreiben hin eröffnet Arthur einmal mehr eine Filiale seines Reisebureaus im Süden, diesmal im französischen Menton, der »Perle des Mittelmeeres«. Mittlerweile kooperiert Renzo mit Maxime Aubry, einem reichen Bankier, der nach dem Ersten Weltkrieg preisgünstig Hotels erwerben konnte, mit deren Leitung er aber überfordert ist. Renzo und Maxime schließen ihre Häuser zu einer der ersten Hotelketten zusammen, und Arthur soll dafür sorgen, dass diese ausgebucht sind.
Renzo und Maxime möchten das Geschäft auch durch einen privaten Bund besiegeln – Ornella nämlich soll Maximes Sohn Félix heiraten.
Tatsächlich schwärmt Ornella seit Jahren heimlich für Félix Aubry. Doch der eigenwillige junge Mann, der sich lieber mit Literatur und Philosophie beschäftigt als mit dem Hotelfachgewerbe und der von einer Karriere als Schriftsteller träumt anstatt von Liebesglück, weist Ornellas schüchterne Avancen zurück und brüskiert sie nicht nur einmal mit seiner arroganten Art. Salome will das nicht tatenlos hinnehmen. All ihr Ehrgeiz richtet sich ab sofort darauf, dem jungen Mann den Zynismus und die Überheblichkeit auszutreiben und dafür zu sorgen, dass er sich in Ornella verliebt. Während sie zu dritt die Küste Südfrankreichs erforschen, gelingt es ihr, zu seinem weichen Kern vorzudringen. Auf diese Weise kommt sie, die sie ihn bald besser versteht als Ornella, ihm jedoch näher, als ihr lieb ist. Gefühle erwachen, die sie in einen schweren Gewissenskonflikt stürzen.
1935 kommt es zur Katastrophe. Nicht nur, dass Paola Arthur all die Jahre mit Renzo betrogen hat und ihre Affäre nun auffliegt, überdies macht erneut der Nationalismus alle hochtrabenden Pläne zunichte. Zwei Jahre nach ihrer Machtergreifung bestimmen die Nazis, dass Deutsche keine Devisen mehr für Privatreisen nach Frankreich erwerben dürfen, weswegen es unmöglich wird, dort Urlaub zu machen. Arthur muss seine Filiale schließen, in den Hotels der »Perlenkette«, wie man sie mittlerweile nennt, drohen die Gäste auszubleiben. Als der seit Jahren spielsüchtige Maxime im Spielcasino von Monte Carlo überdies sein Vermögen verliert, begeht er Selbstmord, und so egoistisch Félix sich bis jetzt oft verhalten hat – um seine sensible Mutter Hélène vor der Armut zu bewahren, geht er trotz seiner Gefühle für Salome eine Vernunftehe mit Ornella ein.
Salome schmerzt es zutiefst, dass Félix diese Entscheidung ohne sie getroffen hat und Ornella über ihre Gefühle hinweggegangen ist. In ihrer Verzweiflung gibt sie sich Agapito, Ornellas Bruder, hin, der ihr seit Jahren Avancen macht. Doch eine Heirat, die ihr zu einem Leben an der Riviera verhelfen könnte, kann auch er ihr nicht bieten, denn er zieht mit seinem Bruder Gedeone in den Abessinienkrieg.
Enttäuscht kehrt Salome nach Deutschland zurück. In Frankfurt muss sie miterleben, wie ihr Vater das Reisebureau ganz in den Dienst der NS-Organisation Kraft durch Freude stellt, die die Freizeit- und Urlaubsgestaltung der deutschen Bevölkerung maßgeblich beeinflussen will. Nach und nach wird sie sich bewusst, dass sie – auch wenn Félix keine Rolle mehr in ihrem Leben spielt – viel von dessen politischen Überzeugungen übernommen hat. Zwar kann sie ihre Liebe zu ihm nicht leben, und ihre Freundschaft zu Ornella ist nicht mehr das, was sie einst war, doch sie hofft, einen neuen Lebenssinn zu finden, als sie beschließt, sich stärker in die Geschäftsführung des Reisebureaus einzubringen und auf diese Weise Widerstand zu leisten …
»Ist die Niederlage endgültig? Nein!
Was auch immer passiert,
die Flamme des Widerstandes wird nicht erlöschen.«
CHARLES DE GAULLE
1938
Erstes Kapitel
Die Frau fiel auf die Knie, hob langsam die Hand, zögerte aber noch, die Pflastersteine zu berühren. Endlich fuhr sie mit der Fingerkuppe darüber, die Miene nahezu ehrfürchtig, wie man sie sonst nur an Pilgern sah, die im Petersdom den Fuß der Petrusstatue streichelten.
»Was macht sie denn da?«, vernahm Salome eine Stimme. »Das sind doch nur gewöhnliche Pflastersteine.« Sie drehte sich um, sah einen Mann aus dem Café treten, vor dem sie stand. Das karierte Geschirrtuch, das um seine Schultern hing, wies ihn als dessen Besitzer aus. Als Salome nicht antwortete, fügte er hinzu: »Denkt sie etwa, dass Julius Cäsar auf diese Pflastersteine getreten ist, nachdem er Kleopatra aus dem Teppich gerollt hat?« Salome lachte kurz auf, verkniff sich aber jeden amüsierten Ton alsbald, da sie nicht die Aufmerksamkeit der gesamten Gruppe auf sich ziehen wollte. Die anderen Reisenden knieten zwar nicht nieder, betrachteten die Frau aber mit Wohlwollen. »Oder ist sie der Meinung, dass Nero hier vorbeikam, nachdem er über dem brennenden Rom die Laute gespielt hat?«, fragte der Wirt.
Salome zuckte die Schultern. »Ich habe keine Ahnung, ob Cäsar oder Nero jemals hier vorbeigekommen sind. Wer aber ganz sicher vor einigen Monaten diese Straße entlanggeschritten ist, war Signor Hitler. Im letzten Mai hat er Italien einen einwöchigen Staatsbesuch abgestattet.«
»Aha«, sagte der Mann mit undurchschaubarer Miene, nahm das Geschirrtuch von der Schulter und fächerte sich damit etwas frische Luft zu. »Das ist sicher gut für mein Geschäft.«
Wahrscheinlich war er nicht der erste Café- oder Restaurantbesitzer, der wachsende Einnahmen verbuchte, seitdem zum Anlass von Hitlers Romreise etliche neue Pracht– und Aufmarschstraßen wie die Via dell’Impero oder die Via dei Trionfi angelegt worden waren. Über diese konnte man vom Kolosseum zum Regierungssitz Mussolinis, dem Palazzo Venezia, gehen, ohne die engen, winkeligen Gassen von Roms Altstadt durchqueren zu müssen. Und auch das Reisebureau Sommer, das seit zwei Jahren regelmäßig Romfahrten von Frankfurt aus anbot, zog aus Hitlers Italienreise großen Nutzen – die Anmeldungen waren seit dem vergangenen Mai sprunghaft angestiegen.
»Diese Menschen wollen unbedingt auf Signor Hitlers Spuren wandeln«, murmelte Salome und lehnte sich an die Hauswand. Ihre Füße schmerzten, weil sie seit dem frühen Morgen unterwegs war, und wahrscheinlich würde die Dame sich nicht so schnell zum Weitergehen bewegen lassen. Einige begannen nun Fotos von der Straße zu schießen – mehr als zuvor vom Titusbogen.
»Aber warum«, fragte der Mann neben ihr eben, »berührt sie ausgerechnet diese Pflastersteine?«
»Nun«, sagte Salome, und diesmal konnte sie sich ein Grinsen nicht verkneifen, »ich habe vorhin erzählt, dass Signor Hitler genau hier stehen blieb, als Mussolini ihm erklärte, das faschistische Italien sei der engste Freund Deutschlands und würde gemeinsam mit ihm bis zur letzten Konsequenz marschieren.«
»Und das stimmt wirklich?«, fragte der Mann skeptisch. »Mein Hund mag diese Stelle übrigens auch. Er markiert sie regelmäßig.«
»Der Führer liebt Hunde.«
»Meiner ist aber eine Kreuzung aus Terrier und Pudel und hat nur mehr ein halbes Ohr.« So undurchdringlich seine Miene bis jetzt gewesen war, der Spott in seiner Stimme war nun unüberhörbar.
»Gewiss wollen Sie Ihrem Hund heut einen ganz besonders großen Knochen kaufen«, sagte sie amüsiert, »ich werde dafür sorgen, dass Sie ein gutes Geschäft machen.«
Sie löste sich von der Wand, klatschte in die Hände, um sich die Aufmerksamkeit der Reisegruppe zu sichern, und riss sogar die kniende Frau aus ihrer Andacht, als sie laut verkündete: »Wir werden in diesem Café eine kurze Pause einlegen. Soeben wurde mir zugetragen, dass unser Führer höchstpersönlich hier einen Kaffee getrunken hat.«
Augenblicklich erhob sich die Frau, und auch die restlichen Reisenden strömten zügig in das Café. Einzig ein Mann, der sich ihr als Herr Otto vorgestellt hatte und dem die südliche Sonne nicht bekam, wurde sein Kopf doch mit jeder Stunde röter, zögerte einzutreten.
»Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist?«
Salome unterdrückte ein Seufzen. Herr Otto gehörte zu jenen Reisenden, die sich akribisch vorbereiteten und sich selbst zum Reiseleiter berufen fühlten, umso mehr, wenn sich herausstellte, dass ein junges Fräulein die Gruppe durch Rom führen würde. Dass dieses junge Fräulein perfekt Italienisch sprach und seit Jahren für das Reisebureau ihres Vaters arbeitete, machte keinen Eindruck auf Herrn Otto – immerhin, so hatte er erklärt, wisse er, dass man im Italienischen das H nicht ausspreche. Zu Hamburg sage man Amburgo, und wenn jemand statt Heil Hitler »Eil Itler« sage, sei das keine Beleidigung, sondern ein sprachliches Defizit. Die stolze Miene verriet, dass er sich deswegen befähigt fühlte, mit jedem Italiener politische Debatten zu führen. Alles, was Salome sagte, zog er grundsätzlich in Zweifel, und sie wappnete sich instinktiv gegen seinen Einspruch, wonach der Führer niemals Kaffee trinke, sein Blick richtete sich indes misstrauisch auf die schwarzen Locken des Cafébesitzers.
»Keine Angst«, erwiderte Salome, ahnte sie doch, was ihm durch den Kopf ging. »Wenn man das Mittelmeer bereist, kommt es des Öfteren vor, dass man Menschen mit jüdischen Merkmalen sieht, und man neigt leicht zu der Annahme, es seien Juden oder Judenmischlinge«, wiederholte sie die Worte, die sie in einem Italienführer gelesen hatte. »Das in zahlreiche Kriege verwickelte Italien unterlag nun mal einem stärkeren Mischungsprozess. Dennoch haben sich die Romanen in ihren Hauptzügen rein erhalten.«
»Hm«, machte Herr Otto. Sein Gesichtsausdruck wurde noch misstrauischer. Immerhin zögerte er nun nicht länger, das Café zu betreten.
In der nächsten Viertelstunde war Salome damit beschäftigt, für die Gäste Bestellungen aufzugeben und sich zu vergewissern, dass sie mit dem bisherigen Verlauf des Tages zufrieden waren. Eine Dame, die sich noch am Morgen über Chaos und ständige Verspätungen beschwert hatte, zeigte sich immerhin über das »Hitler-Wetter« an diesem goldenen Septembertag beglückt. Einen anderen hörte sie schwärmen, dass der Duce es geschafft habe, aus Rom ein pulsierendes Zentrum zu machen, in dem der Geist des imperialen Italiens neu erwacht sei.
»Ich dachte ja schon, wir würden auf Pritschen liegen, aber die Betten in unserem Grandhotel sind weiß und das Bettzeug ist mitnichten verschmutzt und verlaust.«
Salome half, ein paar Gläser mit aranciata oder acquavite an die Tische zu tragen, und bemerkte erst danach, dass Herr Otto nur vor einem Glas Wasser saß und nicht einmal aus diesem einen Schluck nehmen wollte. Himmel, dachte sie, warum legt er ausgerechnet heute Wert darauf, nüchtern zu bleiben?
»Sie gestatten doch, dass ich mich zu Ihnen geselle?«, fragte sie und nahm neben ihm Platz, ohne seine Zustimmung abzuwarten.
Über Herrn Ottos gerötete Stirn perlten die Schweißtröpfchen, während am Nebentisch nicht länger über die Hotelbetten, sondern über die Duschen gesprochen wurde. Aus diesen kam tatsächlich ein dicker Strahl warmen Wassers, nicht wie befürchtet ein Rinnsal. Offenbar hielten die Herrschaften auch das für den Verdienst des Duces.
»Benito Mussolini wird als der letzte Römer in die Geschichte eingehen«, sagte Herr Otto finster, »aber hinter seiner massigen Gestalt hat sich nur ein Volk von Zigeunern verborgen.«
Salome blickte sich kaum merklich um. Ein Vorurteil wie dieses hörte sie nicht zum ersten Mal, doch ihretwegen konnte sich Herr Otto gern darüber auslassen, Hauptsache, er war abgelenkt.
»Heißt es nicht, das Arisch-Römische und das Nordisch-Germanische seien zwei Sonderformen eines gemeinsamen Urtyps?«, fragte sie, um seinen Redefluss anzuspornen.
»Ach was, der Duce ist der einzige Römer in dieser Zeit, aber ich bin nicht sicher, ob er ein würdiges Volk gefunden hat.«
»Die Beziehung zwischen Italienern und Deutschen gilt doch als besonders tief und schicksalhaft.«
»Mag ja sein, dass das italienische Volk edle Vorfahren hat, mittlerweile ist es dennoch derart durchrasst, dass es auf einer deutlich niedrigeren Kulturstufe angekommen ist.« Er beugte sich etwas vor, was bedeutete, dass einer der Schweißtropfen auf ihrer Hand landete, aber wenigstens blickte er sich nicht länger misstrauisch um. »Sind wir doch ehrlich: Das Land der Makkaroni-Esser und schönen Fischerknaben kann nicht mit dem germanischen Volk mithalten. Statt des Bündnisses mit Mussolini hätte sich der Führer um eine Annäherung an England bemühen müssen, vorausgesetzt natürlich, dass die Briten endlich dem Liberalismus und der Demokratie abschwören.«
»Nun«, Salome bemühte sich darum, freundlich zu klingen, »in London wäre ich Ihnen keine große Hilfe, ich spreche kein Englisch.«
Auf dass die Maske der braven deutschen Reiseführerin keine Risse bekam und Ärger hindurchdrang, erhob sie sich schnell. »Wir gehen jetzt in Richtung Cestius-Pyramide«, verkündete sie.
»Zur Cestius-Pyramide?«, fragte die Dame, die zuvor die Pflastersteine gestreichelt hatte. »Was sollen wir denn dort?«
Ähnliches Missfallen hatte durch ihre Stimme gesprochen, wann immer das Mausoleo di Augusto, das Marcellustheater, das Kapitol oder das Pantheon auf dem Programm gestanden hatte. An diesem Tag aber konnte Salome sie beruhigen.
»Oh, ich will Ihnen nicht zumuten, sich mit Roms Geschichte zu beschäftigen. Als der Führer im Mai nach Rom reiste, kam er im eigens für seinen Besuch erbauten Bahnhof Ostiense an. Und dieser befindet sich in der Nähe der Cestius-Pyramide. Selbstverständlich sehen wir uns nur den Bahnhof an, nicht auch die Pyramide.«
Die Miene der Dame glättete sich augenblicklich. »Stimmt es, dass dieser Bahnhof mit prächtigen Bildern ausgestattet ist?«
Salome nickte ernsthaft. »Gut möglich, dass die Hand des Führers auf einem geruht hat.«
Der Dame konnte es nun gar nicht schnell genug gehen, die Gaststätte zu verlassen, während etliche der anderen Reisenden die Toilette aufsuchten. Noch mehr Zeit verging, bis alle gezahlt hatten, und als sie sich endlich vor dem Café versammelten, rief Herr Otto plötzlich: »Er ist weg!«
Salome zuckte zusammen. Eigentlich hatte sie sich schon seit geraumer Zeit gegen genau diese Worte gewappnet, doch jetzt bedurfte es viel Kraft, sich dem Reisenden mit freundlichem Lächeln zuzuwenden und unschuldig zu fragen: »Einer der Pflastersteine, über den unser Führer geschritten ist? Ich hoffe nicht, dass jemand auf die Idee gekommen ist, ihn auszugraben und als Souvenir in die Heimat mitzunehmen.«
»Ich meine diesen einen … Herrn aus unserer Reisegruppe. Ein sonderbarer Kumpan, wenn Sie mich fragen. Er hat immer seinen Mantel getragen und kaum ein Wort gesagt. Sehen Sie doch selbst … er ist verschwunden!«
Salomes Lächeln verkrampfte sich. Schlimm genug, dass Herrn Otto das Fehlen des Mannes aufgefallen war, noch schlimmer, dass der schon zuvor sein Misstrauen auf sich gezogen hatte.
»Er hat mir vorhin mitgeteilt, dass er sich nicht wohlfühlt und ihm etwas übel ist«, murmelte sie.
Herr Otto öffnete den Mund, aber eine andere Dame kam ihm zuvor: »Kann es sein, dass die Küchen hierzulande so verdreckt sind, wie man munkelt? Oh, ich hätte Zwieback und Äpfel mitbringen sollen.«
»Die Restaurants, die ich für Sie auswähle, lassen nichts zu wünschen übrig«, erwiderte Salome rasch. »Gut möglich, dass Herr Kollwitz schon beim Antritt der Reise krank war.«
Herr Otto schien zu überlegen, ob es überhaupt möglich war, dass ein Deutscher eine Krankheit nach Italien brachte, nicht umgekehrt, und Salome nutzte sein Schweigen, um laut zu fragen: »Wie wäre es, Herr Otto, wenn Sie die Reisegruppe zur Cestius-Pyramide … äh dem Bahnhof führen, während ich Herrn Kollwitz suche? Vielleicht ist er noch auf der Toilette. Falls er wirklich krank ist, sollte er Ihnen allen nicht zu nahe kommen, sondern lieber einen Arzt aufsuchen.«
Die anderen ergingen sich sogleich in Diskussionen, ob den hiesigen Medizinern zu trauen sei, Herr Otto war leider nicht am italienischen Gesundheitssystem interessiert.
»Ist sein Name überhaupt Kollwitz? Hat er sich ganz am Anfang nicht als Herr Koller vorgestellt?«
Salome leckte sich nervös über die Lippen. »Wie auch immer, ich …«
»Die Reisegruppe findet bestimmt allein zum Bahnhof«, unterbrach Herr Otto sie, »ich kann Sie unmöglich unbegleitet durch Roms Straßen irren lassen. Ich werde Ihnen helfen, Herrn Kollwitz oder wie er heißt, zu finden.«
Salome unterdrückte nur mühsam einen Fluch. Der einohrige Köter des Wirts würde Herrn Otto bedauerlicherweise nicht in die Wade beißen, und so würde sie alles tun müssen, um den misstrauischen Reisenden, der eine Fährte gewittert hatte, vom Schnüffeln abzuhalten.
Eine Weile versuchte Salome, Herrn Otto abzuschütteln, doch das war vergebens, und deswegen verlegte sie sich darauf, Zeit zu schinden. Auf dem Weg ins Hotel kehrte sie in jede einzelne Bar, jedes Café ein, beschrieb dort Herrn Kollwitz und fragte, ob man ihn gesehen habe.
»Wie kann man sich einfach von der Gruppe entfernen?«, murrte Herr Otto, als sie wieder einmal nur ein Schulterzucken geerntet hatten. »Es gibt Verhaltensregeln, die man auf Reisen beachten muss, und dazu gehört, den Anweisungen des Reiseleiters stets Folge zu leisten.«
»Ich kann die Suche gern allein fortsetzen, damit Sie sich wieder zur Gruppe gesellen können«, schlug Salome vor.
Herr Otto ging gar nicht erst darauf ein. »Ich verstehe nicht, warum Ihnen Ihr werter Herr Vater so viel Verantwortung aufbürdet, noch dazu in einem fremden Land.«
»Mein Vater ist schwer beschäftigt. Unser Reisebureau arbeitet schließlich mit Kraft durch Freude zusammen und unterstützt unseren Führer auf jede erdenkliche Weise, dem einfachen Arbeiter zu seinem wohlverdienten Urlaub zu verhelfen. Erst kürzlich hat er einwöchige Reisen nach Oberbayern, ins Zillertal und nach Norderney organisiert.«
»Warum begnügen Sie sich nicht mit Deutschlandreisen?«
Sie waren nur mehr etwa hundert Meter vom Hotel entfernt, und Salome wusste, dass sie es nicht mehr länger aufschieben konnte, dort nach Herrn Kollwitz zu fragen und damit zu riskieren, dass ihr Plan aufflog. Sie musste darauf vertrauen, gründliche Vorarbeit geleistet zu haben.
»Ich habe Herrn Kollwitz übrigens genau beobachtet«, murmelte Herr Otto, nachdem sie nicht auf seine Frage eingegangen war. »Er hat bei der Begrüßung die Nationalhymne nicht richtig mitgesungen, es auch an einem ordentlichen deutschen Gruß mangeln lassen. Wissen Sie überhaupt, wo er angestellt ist? Durch solch anstößiges Verhalten auf einer Reise schadet er Ansehen und Ruf seines Betriebes. Das wäre ein Grund, ihn fristlos zu entlassen.«
Salome hatte von solchen Fällen gehört und war erleichtert, dass sie nicht auf seine Worte reagieren musste, betraten sie doch nun die Eingangshalle des Hotels mit den schachbrettartigen Fliesen. Und erst recht war sie froh darüber, nicht den Hotelbesitzer an der Rezeption zu sehen, sondern einen jungen Mann.
»Ich frage nach Herrn Kollwitz, warten Sie hier«, sagte sie.
Natürlich blieb Herr Otto ihr auf den Fersen. Salome stellte dem Rezeptionisten eine Frage, und dessen Antwort begleiteten nicht nur weit ausholende Gesten, auch mehrere »Madonna mia!«, »Santo cielo!« oder »Dio santo!« All das verfehlte die dramatische Wirkung nicht. Herrn Ottos zunächst misstrauische Miene wurde fast ein wenig ängstlich, als Salome so tat, als würde sie schwanken, sich an der Theke der Rezeption festhalten und ebenfalls ein »Mein Gott!« ausstieß.
»Was … was hat er gesagt?«
Eine Weile zögerte sie die Antwort hinaus, stammelte dann etwas von Übelkeit und Bauchkrämpfen, die Herrn Kollwitz befallen hätten. Mit letzter Kraft hätte er es zurück ins Hotel geschafft, sei hier aber zusammengebrochen und augenblicklich ins Krankenhaus gebracht worden. Der junge Portier nickte bekräftigend, machte sogar ein Kreuzzeichen. Alle Achtung, er wusste, worauf es ankam.
Salome griff sich an die Stirn. »Ich muss den Armen sofort besuchen. Ich weiß, es ist nicht meine Schuld, und doch fühle ich mich verantwortlich.«
»Selbstverständlich werde ich Sie begleiten.«
Sie biss sich auf die Zunge, um einen neuerlichen Fluch zu unterdrücken. »Oh, das will ich Ihnen nicht zumuten. Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn auch Sie erkrankten! Womöglich ist dieser schreckliche Durchfall ansteckend. Es könnte die Ruhr sein, gar Typhus, von der Cholera will ich gar nicht erst anfangen. Bei den hygienischen Bedingungen hier wäre es kein Wunder. Ich weiß nicht, ob man sich bei den hiesigen Krankenhäusern auf ausreichende Desinfektion verlassen kann. Jedenfalls will ich die Gefahr lieber allein auf mich nehmen.« Als sie spürte, dass Herr Otto zögerte, fügte sie rasch hinzu: »Und außerdem bräuchte ich Ihre Hilfe an anderer Front. Morgen wollen wir doch die Ausstellung über das faschistische Italien besuchen, und ich habe noch nicht überprüft, welches der kürzeste Weg dorthin ist. Zudem … wenn die Reisegruppe zurückkommt, gilt es, sie zum Abendessen zu begleiten. Ich mute Ihnen viel zu, aber hätten Sie die Freundlichkeit, mich für kurze Zeit als Reiseleiter zu ersetzen?« Seine Überzeugung, dass eine Frau unmöglich ein echter Reiseleiter sein konnte, der zu vertreten war, stritt mit dem festen Willen, die Führung zu übernehmen. »Und unter uns …«, sie beugte sich vertraulich vor, »… Ihnen mag aufgefallen sein, dass Herr Kollwitz unsere Hymne nicht mitgesungen hat, aber ich habe Frau Kleiber dabei erwischt, wie sie die Zeitschrift Leonardo studierte.«
Herr Otto lief rot an. »Wie empörend!«, stieß er aus. »Dabei weiß ja jeder, dass für diese Zeitschrift eine Trientiner Jüdin schreibt.«
Salome nickte. »Sag ich’s doch! Ich finde, Sie sollten unbedingt beobachten, ob sich Frau Kleiber auch auf anderen Gebieten des undeutschen Verhaltens schuldig macht.«
Er nickte so grimmig, als handelte es sich dabei um eine heilige Pflicht, und ließ sie schließlich in der Lobby stehen, um der Reisegruppe entgegenzueilen.
Salome fluchte, um ihrer Anspannung Herr zu werden. Ihr Sommerkleid war schweißnass und zerknittert, und sie merkte erst jetzt, dass sie ihren Strohhut zusammengedrückt hatte.
Der junge Mann an der Rezeption grinste sie indes unverhohlen an, hob seine Hand und hielt sie auf. Sie zog alle Geldscheine, die sie bei sich hatte, aus der Tasche und steckte sie ihm zu.
»Letztes Mal war es mehr«, sagte er, nachdem er sie gezählt hatte.
»Letztes Mal haben Sie viel deutlicher das Wort Cholera gesagt.«
»Dafür habe ich heute ein Kreuzzeichen gemacht. Und es hat doch gewirkt, er ist weg.«
Salome war nicht sicher, ob die Gefahr wirklich gebannt war. Später würde sie Herrn Otto noch davon überzeugen müssen, dass Herr Kollwitz für die Rückreise viel zu geschwächt war und diese zu einem späteren Zeitpunkt organisiert werden musste.
»Für ein paar tausend Lire erzähle ich gern, dass er schwarz angelaufen ist, nicht nur Bauch-, auch Muskelkrämpfe hatte und Schaum vor dem Mund.«
»Das überlege ich mir noch«, murmelte Salome, ehe sie den jungen Mann stehen ließ und zu Fuß die Treppe hocheilte, nicht etwa zu ihrem Zimmer, sondern zum Dachboden.
Es war ein stickiger Raum, randvoll mit großen Kästen, in denen Wäsche aufbewahrt wurde.
»Leo?«, rief sie. »Leo, wo sind Sie?«
Die Dielen knarrten, einer der Schränke auch, als von innen die Tür geöffnet wurde. »Fräulein Salome!«
Sie stürzte auf den Schrank zu, sah den Mann darin, trotz der Hitze mit einem schwarzen Mantel bekleidet – und über und über mit Christbaumschmuck behängt.
»Lieber Himmel! Wie sehen Sie denn aus?«
Leo Adler grinste halbherzig. »In den anderen Schränken war noch weniger Platz. Ich konnte den Christbaumschmuck schwerlich auf den Boden legen, darüber hätte sich jetzt im September jedermann, der den Dachboden betreten hätte, gewundert. Es ist schließlich zu früh, den Christbaum aufzuputzen.«
»Sie schauen selbst aus wie ein Christbaum – ein lebendiger.« Sie pflückte ein paar Kugeln, Glasengel, Strohsterne und rote Schleifen von seinem Mantel.
»Immerhin gibt es in Italien noch echten Christbaumschmuck – in Deutschland hängt man sich neuerdings silberne Hakenkreuze oder SS-Abzeichen an den Weihnachtsbaum.«
Der schwarze Mantel glitzerte ob des Lamettas. Nicht nur deswegen sah Leo Adler merkwürdig aus – auch weil er unter dem Mantel so unförmig war.
»Ist Ihnen nicht heiß?«
»Sie haben mir doch geraten, möglichst viel Kleidung übereinander zu tragen. Wenn wir später das Hotel verlassen, wäre es zu auffällig, wenn ich einen Koffer bei mir hätte.«
Salome nickte. Sie fürchtete, dass sie heute länger warten mussten als bloß bis Mitternacht. Gut möglich zwar, dass Herr Otto frühzeitig ins Bett ging, um sich pünktlich um sieben Uhr zur Morgengymnastik zu erheben oder die anderen Reisenden gar für den Morgenappell zu wecken, wie er auf den Kraft-durch-Freude-Kreuzfahrten stattfand. Aber es war auch nicht auszuschließen, dass er bis spät in der Nacht an der Hotelbar hockte, um Salomes Rückkehr aus dem Krankenhaus abzuwarten.
»Sie müssen nicht mit mir hier warten«, erklärte Leo Adler, »den Rest schaffe ich allein.«
Salome schüttelte den Kopf. »Ich bringe Sie zu Ihrer Familie«, erklärte sie.
Leo widersprach nicht. »Nun ja«, scherzte er, wie er es gerade in verzweifelter Lage oft tat, »wir können uns ja die Zeit vertreiben, indem wir Weihnachtslieder singen.«
Sie verließen das Hotel mitten in der Nacht durch die Küche. Vom Knoblauchkranz, der über dem Herd hing, ging ein durchdringender Geruch aus. Leo ließ es sich nicht nehmen, eine der Weihnachtskugeln daran aufzuhängen, doch obwohl der Anblick Salome amüsierte – sie war so angespannt, dass nur einer ihrer Mundwinkel zuckte. Als sie ins Freie traten, traf sie die Nachtluft, nicht etwa kühl, sondern so warm, als wäre die Stadt ein aufgeheizter Ofen, der selbst dann noch weiterglühte, wenn alles Feuerholz verbraucht war. Salome blickte sich mehrmals um, wappnete sich davor, dass von irgendwo Herr Otto auftauchte. Aber sie erblickte im Schein der Straßenlaternen nur ein paar Katzen, eine davon mit verklebten Augen, hörte in der Ferne das Knattern eines Motorrads.
»Beeilen wir uns.«
»Ich denke, wir sollten eher langsam gehen, nicht rennen wie Diebe, die auf der Flucht sind.«
Dabei war Leo genau das – zwar kein Dieb, aber auf der Flucht. Salome nickte trotzdem, und schweigend legten sie die Strecke zu einem mehrstöckigen Mietshaus in der Via del Santa Maria Maggiore zurück. Die Laterne über dem Eingang verbreitete ein kaltes Licht, das Hunderte von Mücken anzog. Alles in dem Haus schien schief zu sein, die Stufen, das Geländer, die Türen, als hätte es jemand ganz ohne Plan gebaut, mit den Materialien, die gerade vorhanden waren.
Die Tür im obersten Stockwerk quietschte schon, als sie nur daran hämmerten, erst recht, als sie geöffnet wurde.
»Papa!«, ertönte eine helle Kinderstimme, und zum ersten Mal konnte Salome ausatmen, ohne dass sich in der Brust eine Faust zusammenzuballen schien.
»Efraim!«, rief Leo, ehe er sich in der Umarmung eines vierjährigen Knaben wiederfand, der die Hände fest um seinen Nacken schlang. »Solltest du nicht längst schlafen?«, fragte er.
»Und hast du nicht verkündet, dass du ihn aus lauter Trotz künftig Erich nennen wolltest?«, gab die Frau zurück, die jetzt hinter dem Kleinen auftauchte.
Leo drückte den Sohn kurz noch fester an sich, löste sich dann aber, um auf die Frau zuzutreten. Der Gang, der zu den anderen Räumen führte, war eigentlich so schmal, dass kaum zwei Menschen nebeneinander hier stehen konnten, so dünn und feingliedrig, wie sie war, schien sie sich allerdings selbst hier zu verlieren.
»Ach, Hanna …«, sagte er, während sein Blick über ihren Leib glitt, ausdrückte, was er laut nicht sagen wollte. Warum hast du denn aus Sorge um mich aufgehört zu essen? Salome hat doch versprochen, mich mithilfe eines Touristenvisums nach Italien zu bringen, so wie vorher dich, Efraim und deinen Vater! »Nun«, erklärte er, »mittlerweile hat sich Efraim an seinen Namen gewöhnt, und es ist egal, wie er genannt wird, Hauptsache, ich habe meinen Jungen wieder.«
Nachdem er seine Frau an sich gedrückt hatte, nahm Leo seinen Sohn auf den Arm, trat durch den schmalen Gang in ein ebenso schmales Zimmer, in dem gerade mal zwei Feldbetten Platz hatten. Auf einem saß ein älterer Herr – Theodor Feingold. Neben diesem Raum gab es nur noch eine Küche, wo außer einem kleinen Tisch ein drittes Feldbett stand, doch dass es hier keinen Platz für einen weiteren Bewohner gab, war ebenso bedeutungslos wie die Tatsache, dass die Nazis im vergangenen Monat ein neues Gesetz erlassen hatten. Die Juden in Deutschland durften demnach ihren Kindern nur mehr Namen geben, die besonders fremdartig klangen und sich von üblichen deutschen unterschieden – ob Ezekiel oder Mordechai oder eben Efraim. Leo, der den Sohn nach seinem Urgroßvater benannt hatte, hatte in seinem ersten Ärger verkündet, er wolle den Nazis keinen Gefallen tun und werde den Kleinen künftig Erich statt Efraim nennen. Aber was zählte nun ein Name? Es fiel ihm schwer, den Jungen loszulassen, um nun seinen Schwiegervater zu begrüßen.
Salome betrachtete den alten Mann, den sie ihr Leben lang »Herr Theodor« genannt hatte. Über viele Jahre war er ein ebenso treuer wie verlässlicher Mitarbeiter des Reisebureaus Sommer gewesen, hatte jedoch gekündigt, nachdem die Nürnberger Rassengesetze erlassen worden waren und sich ihr Vater ganz in den Dienst der NS-Freizeitorganisation Kraft durch Freude gestellt hatte. Auch er war dünn geworden, was wohl nicht nur an den vielen Sorgen, zudem an den schwindenden Geldreserven lag. Verglichen mit ihm wirkte Leo nahezu fettleibig, doch das täuschte. Als er nämlich nun seinen Mantel ablegte, zeigte sich, wie viele Kleidungsstücke er übereinander trug. Aus der Tasche des Jacketts zog er zwei weitere Christbaumkugeln und hängte sie Efraim wie Kirschen an die Ohren. Der Kleine lachte, und sein Gelächter wurde ganz ausgelassen, als er sah, dass sein Vater über seinen langen Hosen gleich mehrere Unterhosen trug.
»Warum hast du denn so viele Unterhosen an?«, fragte er.
»Ja, sind es wirklich Unterhosen?«, gab Leo zurück, während er aus einer schlüpfte, sie sich auf den Kopf setzte. »Ich glaube doch eher, das wird künftig meine Mütze sein. Und hier ist eine für dich.« Leo zog die nächste Unterhose aus und setzte sie Efraim auf.
Salome entging nicht, dass Hanna lächelte, ihr Blick dagegen blieb ernst. Sie hatte damals auch ihr zu leichtem Gepäck geraten, um nicht weiter aufzufallen. Nun zog sie ein Couvert mit mehreren tausend Reichsmark aus ihrer Tasche, das Leo ihr anvertraut hatte, durften Touristen bei Grenzübertritt doch nicht mehr als zehn Reichsmark bei sich tragen. Sie wollte es ihm überreichen, aber es war Herr Theodor, der es mit zittrigen Fingern übernahm und sie in die Küche winkte, um der kleinen Familie Zeit für sich zu gönnen.
Die Wände waren schwarz vom Ruß, die Lade des kleinen Tisches quietschte wie die Haustür, als Herr Theodor das Geld hineinlegte. Im Reisebureau war er unter anderem für die Buchhaltung zuständig gewesen, hatte stundenlang am Stehpult ausgeharrt, um die Rechnungsbücher auszufüllen. Nun wirkte er, obwohl mit seinen knapp sechzig Jahren noch nicht so alt, nahezu greisenhaft und stützte sich schwer auf den Tisch. Auf den Stuhl wollte er sich nicht setzen, weil es nur einen gab, den zu beanspruchen er viel zu höflich war.
»Bitte nehmen Sie Platz«, drängte Salome ihn. »Ich … ich muss ohnehin zurück ins Hotel.«
Nicht nur, dass sie am nächsten Tag ihre Reisegruppe wieder auf Hitlers Spuren durch Rom führen musste – die eigentliche Herausforderung war es, die Übrigen glauben zu machen, dass einer von ihnen mit Typhus im Krankenhaus lag und erst später zurückreisen konnte.
»Fräulein Salome, ich kann Ihnen gar nicht genug meinen Dank bekunden, dass Sie …«
Sie hob abwehrend die Hände. »Das hatten wir alles schon. Unser Reisebureau hätte ohne Sie die Wirtschaftskrise nicht überlebt.«
»Ich weiß, dass Sie auch vielen anderen Familien geholfen haben. Wie viele Juden haben Sie nun schon auf diesem Weg nach Italien gebracht?«
Salome zuckte die Schultern, tat so, als wüsste sie es nicht. Es waren insgesamt sechzehn Personen gewesen, die ihre Rückfahrkarte nicht benutzt hatten, seit das Reisebureau Sommer auf ihr Drängen hin Romreisen ins Programm aufgenommen hatte.
Herr Theodor versuchte, die Schublade zu schließen, doch sie klemmte. Seine Hände zitterten noch stärker, und rasch half sie ihm.
»Wir müssen sehr sparsam sein«, murmelte er, »ich bin mir nicht gewiss, ob und wie lange Charlotte uns im Notfall noch etwas überweisen kann.«
Charlotte war Herrn Theodors ältere Tochter, die in Deutschland geblieben war, wollte sie sich doch von nichts und niemandem aus ihrer Heimat vertreiben lassen. Salome wusste, dass Herr Theodor, dem nach dem frühen Tod seiner Frau nur seine beiden Töchter geblieben waren, sie inständig angefleht hatte, mit ihnen zu kommen, doch Charlotte hatte stur auf ihrer Entscheidung beharrt.
»Leo wird bestimmt eine Arbeitserlaubnis bekommen«, erklärte Salome. »Der Grund, aus dem so viele Juden aus Deutschland und Österreich hierher und nicht nach Frankreich kommen, ist schließlich der, dass sie hier arbeiten dürfen.«
»Er ist ein Lehrer, der nicht des Italienischen mächtig ist.«
»Er ist ein junger Mann, der zwei gesunde Hände hat, zupacken kann und die Sprache rasch erlernen wird«, ließ sich Leo hinter ihnen vernehmen. »Notfalls arbeite ich als Christbaumverkäufer.«
Salome drehte sich um. Nun, da er fast sämtliche Kleidung abgelegt hatte, sah man auch ihm an, wie die letzten Wochen an ihm gezehrt hatten, als er in Deutschland darauf hatte warten müssen, der Familie zu folgen, weil es unauffälliger gewesen war, die Fahrt getrennt voneinander anzutreten.
Herr Theodor sank nun doch auf den Stuhl. »Fürbass!«, rief er in der ihm eigenen altertümlichen Sprechweise. »Die Menschen hier hassen die Juden tatsächlich nicht so inständig wie in Deutschland. Ich weiß nur nicht, wie lange uns dieses Glück noch hold bleibt.«
Salome rang nach tröstenden Worten, aber ihr fiel keines ein.
»Nun«, schaltete sich Leo ein, »heute sind wir glücklich, dass wir wieder vereint sind. Und die Sorgen, die wir uns morgen machen werden, haben wir ganz allein zu tragen, damit wollen wir Fräulein Salome nicht belasten. Sie hat genug für uns getan.« Er wandte sich an sie. »Ich würde Ihnen ja gern eine Christbaumkugel als Dank überreichen, aber Efraim will alle für sich haben. Ich fürchte also, ein fester Händedruck ist alles, womit ich mich revanchieren kann.«
Sie missachtete seine ausgestreckte Hand, umarmte ihn unwillkürlich. Dann sah sie nach Efraim, der eine der Unterhosen über ein Kissen gezogen hatte, um es als Kuscheltier zu nutzen.
»Es schaut doch aus wie ein Bär, oder?«, fragte er seinen Vater.
»Ein Bär ist langweilig«, erwiderte dieser, »ich denke eher, das ist ein ostasiatisches Wasserreh. Die Männchen haben lange Fangzähne wie ein Vampir, um das Weibchen zu beeindrucken. Wir werden ihm morgen aus Zahnstochern welche basteln, aber jetzt musst du schlafen.«
Efraim lachte wieder.
»Ein ostasiatisches Wasserreh … Wie kommst du nur darauf?«, kam es dagegen mahnend von Hanna.
»Die waren schon immer meine Lieblingstiere. Wusstest du das nicht?«
Hanna runzelte die Stirn. »Das ist nicht die richtige Zeit, um zu scherzen.«
»Und ob! In guten Zeiten kann man Scherze treiben, in dunklen Zeiten muss man es. Wobei wir die Dunkelheit jetzt hinter uns gelassen haben. Wir sind in Roma, einer der schönsten Städte der Welt. Morgen werden wir gemeinsam ein Eis essen und mit den Straßenhändlern um ein Souvenir feilschen. Ich hoffe bloß, sie bieten etwas anderes als Bronzebüsten vom Duce an, vielleicht Strohhüte oder eine Miniatur von den Caracalla-Thermen oder ein Fläschchen Eselsmilch. Du hast bestimmt schon mal gehört, dass Neros Frau Poppaea sich nur mit Eselsmilch gewaschen hat, oder?«
Hanna verdrehte die Augen, musste dann aber doch grinsen.
Salome lächelte und nickte ihnen zu, um endgültig Abschied zu nehmen. Herr Theodor ließ es sich nicht nehmen, sie zur Tür zu begleiten, stützte sich dort an den Rahmen. »Sie hatten die Freundlichkeit, unendlich viel für meine Familie zu tun, derohalben will ich mich nicht erdreisten, auch noch zu erheischen, dass Sie …«
»Ich weiß«, unterbrach Salome ihn schnell, »wenn Ihre Tochter Charlotte sich doch noch entscheidet, Deutschland zu verlassen, werde ich auch sie nach Italien bringen.«
Sie tat etwas, was sie bei einem steifen Mann wie ihm früher nie gewagt hatte: Sie streichelte ihm vorsichtig über die Schultern, ehe sie ihm ein letztes Mal zunickte, sodann die schiefe Treppe hinuntereilte.
Erst als sie ins Freie trat, gewahrte sie, dass deutlich mehr Zeit als gedacht vergangen war. Schon dämmerte der Morgen, erwachte die Stadt zum Leben. Die Katzen hatten sich verzogen, eine stark geschminkte Frau stolperte mit abgebrochenem Stöckelschuh über die Straßen. Der missbilligende Blick eines brusoclinaro traf sie, der noch nicht begonnen hatte, seine Waren – geröstete Kürbiskerne – zu verkaufen, während die werbenden Rufe der Stiefelputzer anschwollen. Am lautesten war die Stimme des strillone, des Zeitungsjungen, der jedem Passanten ein scharfes »Corriere! Avanti! Gazzetta uffiziale!« entgegenbrüllte.
Salome war schon an ihm vorbeigegangen, als sie plötzlich zögerte. Sie drehte sich um, trat zu ihm zurück, murmelte: »Kann ich mal sehen?«
Nur widerwillig ließ er sie auf das Titelblatt der Zeitung lugen, verlangte, als sie nicht zu lesen aufhörte, Geld dafür. Seine Stimme ging in ein Rauschen über, auch die Augen schienen ihr den Dienst zu versagen. Nach der langen Nacht verschwammen die Buchstaben, und selbst als sie daraus Wörter formen konnte, wurden keine Sätze daraus.
Schulen, Universitäten, Akademien … jüdische Schüler und Lehrer … ausgeschlossen …
Nun gut, Leo würde hier ohnehin nicht unterrichten können, aber am Ende des Artikels stand noch etwas anderes, ungleich besorgniserregender.
Das kann doch nicht wahr sein! Ihre Lippen formten die Worte nur.
Laut war dagegen die Stimme des Zeitungsjungen. »Zahlen Sie die Zeitung, oder gehen Sie!«
Er riss sie ihr aus der Hand, ehe sie noch mehr lesen konnte, aber sie hatte bereits genug erfahren, um sich mit dröhnendem Kopf und schmerzhaft pochendem Herzen gegen eine Hauswand zu lehnen.
Zweites Kapitel
Félix hatte sich in seinem Hotel, La Perle de Menton, ein Bureau im Erdgeschoss eingerichtet. Jetzt, im Oktober, zog er spätestens um elf Uhr den Vorhang zu, weil dann die Sonne auf seinen Schreibtisch fiel. Die Vorhänge waren aus dickem grünem Samt angefertigt – wäre es nach ihm gegangen, hätten sie schwarz sein sollen. »In deinem Schlafzimmer kannst du machen, was du willst«, hatte Ornella, seine Frau, zu ihm gesagt, »aber in das Bureau kommen manchmal Gäste. Sie sollen sich nicht wie in einer Gruft fühlen.«
Nun, auch bei den Gästen hatte sich herumgesprochen, dass er ungern gestört wurde, dennoch ertönte heute jäh ein Klopfen. Félix hatte sich gerade erst eine Zigarette angezündet und aus dem Buch, das vor ihm lag – in diesem wurden die Gäste mit Namen, Berufsstand und der Länge des Aufenthalts eingetragen –, ein Blatt gerissen, um daraus einen Papierkranich zu falten.
Er blieb stumm, doch es klopfte wieder, und hinzu kam eine Stimme: »Monsieur Aubry!«
Mühsam unterdrückte er ein Seufzen, brachte ein unwilliges »Herein!« hervor. Er sah nicht hoch, als sich die Tür öffnete, denn er war mit den Flügeln des Kranichs beschäftigt – wobei der Kranich eher einem Spatz glich, der nicht fliegen, sondern Brotkrumen vom Boden aufpicken wollte. Wie wiederum die Frau, die eben das Bureau betrat, aussah, wusste er schon, bevor er sie musterte. Sie hatte gewiss das beste Kleid angezogen, das sie noch hatte, aber auch bei diesem ließ sich nicht verbergen, wie fadenscheinig es mittlerweile war, wie viele Flicken es aufwies.
Schließlich blickte er doch hoch. Das Lächeln im Gesicht der Frau glich gleichfalls einem dünnen Faden, der bald reißen würde. Es lenkte nicht von der Verzweiflung ab, die ihr im Blick stand und aus der kurz Verwunderung wurde, als sie seinen Kranich … Spatz bemerkte. Ungerührt faltete er weiter, machte nur eine kurze Pause, um die Zigarette aus dem Mund zu nehmen und zu murmeln: »Nun setzen Sie sich doch, Frau Teitelbaum.«
Etwas ratlos blickte seine Besucherin auf den Stuhl gegenüber vom Schreibtisch.
»Das ist nicht nötig, ich wollte nur sagen, dass wir … dass wir noch heute abreisen.«
»Jetzt schon?«, rief er überrascht. »Der Oktober ist einer der schönsten Monate in Menton. Anderswo ist es grau und regnerisch, hier hört die Sonne nicht auf, uns zu küssen.«
Der spöttische Ton in seiner Stimme konnte ihr nicht entgangen sein, ihr Blick wurde noch ratloser, als sie die zugezogenen Vorhänge betrachtete. »Ich fürchte, ich kann nicht …«
Das letzte Mal, als sie ihn aufgesucht hatte, hatte sie noch schwere Amethystohrringe getragen, diese aber abgenommen und sie Félix zugeschoben, um damit ihr Zimmer zu bezahlen.
Félix hatte die Ohrringe an sich genommen und sie an seine Ohrläppchen gehalten. »Sehe ich aus, als würden mir Ohrringe stehen?«, hatte er gefragt.
»Sie könnten Sie Ihrer Frau schenken.«
»Für meine Frau ist nur schön, was verwelken kann, nicht, was hart und unzerstörbar ist. Sie verbringt ihre Zeit lieber bei ihren Blumen im Garten als beim Juwelier.«
Am Ende hatte Frau Teitelbaum die Ohrringe einfach liegen lassen, um sich zwei weitere Wochen in der Perle de Menton zu erkaufen.
Félix zerdrückte die Zigarette im Aschenbecher, legte den Kranich … Spatz auf das Buch mit der Gästeliste, öffnete eine Schublade. Ganz hinten befand sich der Briefbeschwerer, und auf dem Briefbeschwerer lagen die Ohrringe.
»Die haben Sie das letzte Mal hier vergessen. Nehmen Sie sie bitte wieder mit.«
Frau Teitelbaums Unterlippe zitterte. »Das … das kann ich nicht annehmen. Wir können wirklich nicht länger bleiben. Ein Hotel ist einfach zu teuer für uns.«
Im Grunde war jede Form der Unterkunft zu teuer für sie. Ihr Mann war Violinist, hatte jedoch schon lange nicht mehr auf seinem Instrument gespielt.
Félix ging nicht darauf ein. »Wenn Sie darauf bestehen, werde ich diese Ohrringe meiner Mutter schenken, aber dafür beehren Sie uns bis mindestens Weihnachten. Was sage ich? Bis Ostern!« Frau Teitelbaum rang um Fassung, wollte etwas erwidern. »Bitte stören Sie mich jetzt nicht länger«, kam Félix ihr zuvor. »Sie sehen doch, ich bin schwer beschäftigt.« Ihr Blick richtete sich auf die Gästeliste, ihr konnte nicht entgehen, dass beide Seiten leer waren, obwohl die Perle de Menton bis zum letzten Zimmer belegt war. Die Augen weiteten sich, als Félix obendrein eine weitere Seite herausriss. »Soll ich jetzt eine Seerose oder einen Schwan falten?«
»Monsieur Aubry …«
»Ich glaube, einen Schwan bekomme ich nicht hin, ohne einen Knoten in seinen langen Hals zu machen. Lassen Sie mich jetzt bitte allein?«
Er nahm eine neue Zigarette, führte sie zum Mund. Bis seinem Mund Rauchkringel entwichen und diese zur Decke hochstiegen, hatte Frau Teitelbaum den Raum verlassen.
Weder hatte der Schwan einen Hals noch die Seerose ein Blütenblatt, als es wieder klopfte. Er überlegte kurz, sich zu verstecken, wahlweise unter dem Schreibtisch oder hinter dem Vorhang, doch bevor er sich entschieden hatte, betrat seine Ehefrau den Raum.
Anders als er scheute Ornella die Sonne nicht, wie ihr gerötetes Gesicht bekundete. Rot waren auch die Früchte an den Zweigen, die sie in den Händen hielt – offenbar vom Sandbeerbaum stammend. Sie setzte immer neue Pflanzen, um zu sehen, wie sie gediehen – und das taten sie meist gut. In Menton, der Stadt der Zitronen, wuchs einfach alles – Oliven und Mandeln, Feigen und sogar Granatäpfel, neuerdings sogar Zürgelbäume, die wohltuenden Schatten warfen. Oh, warum hatte sie nicht just vor dem Bureaufenster einen Baum gepflanzt?
»Frau Teitelbaum«, sagte Ornella. Ihr Tonfall klang eher hilflos als vorwurfsvoll.
»Stell dir vor, ihr gefällt es so gut hier, dass sie uns noch bis Weihnachten beehren wird, vielleicht bis zum Frühling.«
Ornella trat seufzend zum Schreibtisch, warf einen Blick auf die Gästeliste, doch er schlug das Buch zu, ehe sie erkennen konnte, dass auf den Seiten nicht auch nur ein Name stand. »Wir sind ausgebucht, sei froh.«
»Wir sind nicht ausgebucht«, sagte sie leise.
Er tat, als hätte er sie nicht gehört, faltete das Papier, entschied, dass es kein Schwan und keine Seerose, sondern ein weiterer Kranich oder zumindest ein Spatz werden sollte. Nach einer Weile prüfte er, ob er fliegen konnte. Der Papiervogel fiel sofort auf den Schreibtisch. Er nahm ihn, versuchte es aus einem anderen Winkel.
»Félix!«
Selten sprach sie seinen Namen so heftig aus, selten betrat sie überhaupt das Bureau, und wenn, verweilte sie nicht lange. Nun aber setzte sie sich, die Zweige noch in der Hand. Wahrscheinlich hatte sie gerade eine Vase gesucht, als sie gesehen hatte, wie Frau Teitelbaum das Bureau verließ. Die roten Früchte, die wie Perlen aussahen, hoben sich von ihrer hellen Haut, den Haaren in verwaschenem Blond, den farblosen Augen ab.
»Ich weiß genau, was du tust«, sagte sie. »Und es ist nicht so, dass ich keinen Respekt vor dir habe. Ich habe auch nichts dagegen, dass du jüdische Emigranten aus Deutschland aufnimmst, zumindest wenn es ein paar wenige sind. Aber seit letztem Sommer werden es immer mehr. Haben wir überhaupt noch zahlende Gäste?«
Ihre Hand näherte sich dem Gästeregister, rasch zog er es weg. »Das ist meine Sache.«
»Das ist es nicht, dieses Hotel gehört mir genauso wie dir.«
Anders als sonst kam sie dem Grund, aus dem sie geheiratet hatten, gefährlich nahe: Sein Vater hatte sich umgebracht, nachdem er sein Vermögen in Monte Carlo verspielt hatte. Félix hatte das Hotel nur mithilfe von Renzo Barbera, Ornellas Vater, halten können.
»Willst du sie auf die Straße setzen?«, fragte er.
Sie wich seinem Blick aus, umklammerte die Äste fester. »Es kann doch nicht so weitergehen!«
»Was? Dass Menschen in Scharen aus Deutschland fliehen? Juden, Sozialdemokraten, Künstler? Dass hier aber auch Flüchtlinge aus Spanien leben, nachdem dort der republikanische Widerstand endgültig zusammengebrochen ist, die Franzosen deshalb sagen, wir haben kein Geld zu verschenken, wir müssen schon bei allem sparen, dem bezahlten Urlaub und dem Ausbau von Schulen, um gegen Hitler aufzurüsten? Dass immer mehr Parteien aus ihren Löchern kriechen, deren Mitglieder wissen, dass sie für jede antisemitische Parole, die sie brüllen, mindestens eine Wählerstimme gewinnen? Oh, ich kann dir sagen, das wird nicht nur weitergehen, das wird noch schlimmer werden.«
»Félix, du kannst nicht die ganze Welt retten. Die wenigen … echten Gäste beschweren sich bereits.«
»Worüber genau? Dass sie morgens, wenn sie bei Café au lait und Baguette mit Butter sitzen, in verzweifelte Gesichter starren müssen? Dass am Abend, wenn sie an der Bar Likör trinken, nicht nur der neueste Klatsch zu ihnen dringt wie die Frage, ob die Mutter von Charlotte, der einzigen Tochter von Monacos Fürsten, wirklich eine Wäscherin oder ein Modell erotischer Bilder war? Dass sie stattdessen Gespräche darüber führen müssen, ob die Maginot-Linie im Zweifelsfalle bei einem Angriff Deutschlands hielte? Was für eine Zumutung aber auch, dass die große Politik den eigenen wohlverdienten Urlaub kaputtmacht. Warum werden nicht irgendwo Löcher in den Sand gebohrt, um die Emigranten einfach darin verschwinden zu lassen?«
Ornella erhob sich abrupt, doch als er schon hoffte, er hätte sie vertrieben, trat sie zum Vorhang und zog ihn beiseite. Er verzog die Stirn, als die Sonne auf ihn fiel.
»Es fällt mir etwas schwer zu glauben, dass du ein Menschenfreund bist und das alles nur tust, weil du ein großes Herz hast. Wäre es so, würdest du unserer Ehe endlich eine Chance geben! Ich liebe dich, Félix, ich habe dich immer geliebt, doch du … du stößt mich beharrlich von dir. Dir hat es von jeher schon großen Spaß gemacht, jemandem in die Suppe zu spucken – ob das nun deine Frau ist, die dir zuwider ist, oder ob es die Franzosen sind, die grölend fordern, die Juden sollen aus ihrem Land verschwinden.«
Sie zog den Vorhang nicht wieder zu, wandte sich aber immerhin zum Gehen.
»Du bist mir nicht zuwider, nur …«, setzte er leise an.
»Ich langweile dich. Dein ganzes Leben langweilt dich. Da kannst du ein bisschen Nervenkitzel gut gebrauchen, nicht wahr?«
Ihre Stimme hatte an Schärfe zugenommen. Unwillkürlich warf Félix den Papierkranich … Spatz in ihre Richtung. Diesmal stürzte er nicht ab, sondern flog knapp an ihrer Schläfe vorbei. Blitzschnell fing sie ihn auf.
»Besser ist es, ich setze den Vogel im Garten auf einen Baum«, sagte sie seufzend, »hier geht er ja doch nur ein.«
»Beim nächsten Regen wird er sich auflösen.«
»So wie du? Manchmal denke ich, du bist aus Papier, in das man Tabak rollt und das am Ende in Rauch aufgeht.« In ihrer Miene stand jäh Trauer. »Wenn das Hotel bankrottgeht, werden wir alles verlieren, auch die Vorhänge, die du so gern zuziehst, um dich vor der Sonne zu verstecken. Sämtliche Emigranten werden auf der Straße landen. Wenn du wirklich ihr Wohl im Blick hast, solltest du vernünftige Pläne verfolgen, anstatt Papiervögel zu falten. Und wenn ich dir wirklich nicht zuwider bin, dann wirst du …«
Sie brach ab. Er wusste ja auch so, dass sie nicht nur Respekt einforderte, zusätzlich etwas anderes. Doch das, was sie sich am meisten wünschte, verweigerte er ihr starrsinnig.
Er öffnete das Buch, riss die nächste Seite heraus. »Ich falte dir einen Fisch für deinen Teich.«
Er sah nicht, ob sie die Augen verdrehte, war aber überzeugt davon, dass sie das tat, ehe sie hinauseilte. Ob des Luftzugs, der von der Tür kam, löste sich eine der roten Perlen von den Ästen, kullerte auf den Boden. Dem unsinnigen Bedürfnis daraufzusteigen, gab er nicht nach, erhob sich stattdessen hastig, um den Vorhang wieder zuzuziehen. Kaum hatte er es gemacht, riss erneut jemand die Tür auf.
»Was ist? Hast du dich entschieden? Willst du einen Goldfisch, einen Hecht oder einen Hai und …«
Er verstummte, als er sich umdrehte, sah, dass nicht Ornella vor ihm stand, sondern ein junger Mann. Er hatte sich die Kappe vom Kopf gezogen, knetete sie unruhig in den Händen.
»Herrgott, Jérémie!«, entfuhr es Félix. »Wir haben doch vereinbart, dass Sie nicht hierherkommen. Damit machen Sie bloß die Polizei auf uns aufmerksam, und Sie wissen ja, wie viele Emigranten hier weder Visum noch Aufenthaltsgenehmigung haben. Nach den neuen Gesetzen können wir froh sein, wenn sie nur eine Geldstrafe bekommen, ihnen nicht auch noch das Gefängnis droht und …«
Er brach ab, als er gewahrte, dass seine Worte den anderen nicht erreichten.
»Haben Sie es noch nicht gehört?«, fragte Jérémie knapp.
»Was soll ich gehört haben?«
»Italien«, lautete die knappe Antwort. »Italien.«
Wenig später betraten sie eine der Suiten im obersten Geschoss, wo sich die Privatwohnungen befanden. Félix hatte Jérémie den Dienstbotenaufgang hochgeführt, und obwohl sie niemandem begegnet waren, hatte dieser sich mehrfach umgedreht. Nun zögerte er, über die Schwelle zur Suite zu treten, war doch aus dem Nebenraum Gemurmel zu vernehmen.
»Nur mehr ein Löffel, mein Kleines, ich bitte dich, du musst zu Kräften kommen.«
Jérémie erstarrte. »Wer ist das?«
»Meine Mutter«, sagte Félix. »Und sie kann Sie ruhig sehen. Sie hat sich noch nie für gesunde Menschen interessiert, nur für kranke.«
»Na los«, ließ sich wieder Hélène Aubrys Stimme vernehmen, »wenn du noch drei Löffel nimmst, kannst du hinterher vielleicht sogar kurz aufstehen.«
»Und dieser Kranke, den sie betreut?«
Félix winkte energisch, damit Jérémie ihm endlich in den Raum folgte. Der gehorchte zwar, verharrte aber in der Nähe der Tür, während Félix auf einen Wandschrank zutrat.
»Keine Angst. Der Kranke, den meine Mutter betreut, ist in einem zu erbärmlichen Zustand, um zu erkennen, dass ein Mitarbeiter des Unterstützungskomitees für Flüchtlinge von der israelitischen Gemeinde Nizzas in meinem Hotel ein und aus geht. Meine Mutter würde uns erst recht nicht verraten. Mit ihr teile ich alles, mit Ihnen nur den Cognac.«
Er nahm eine Flasche aus dem Wandschrank, doch Jérémie hob abwehrend die Hände. Er war ein schmächtiger Mann mit dichten schwarzen Locken und gehetztem Blick. Alles an ihm war ständig in Bewegung, auch jetzt fiel es ihm sichtlich schwer, still zu stehen.
»Das ist nicht die rechte Zeit zu trinken«, sagte er.
Félix nahm einen Schluck direkt aus der Flasche, ehe er sich eine Zigarette ansteckte. »Im Gegenteil. Es ist nicht die rechte Zeit, nüchtern zu bleiben. Ich wüsste gar nicht, wie man die Welt ohne Alkohol erträgt.«
»Wir … wir brauchen einen klaren Kopf, um nachzudenken.«
»Nachzudenken?«, Félix stieß ein Glucksen aus. »Dabei wird das freie Denken doch gerade abgeschafft.«
Er wurde rasch wieder ernst. Erneut ließ sich Hélènes Stimme vernehmen. »Nun mach endlich den Mund auf, wirklich, es ist zu deinem Besten …«
Félix stellte die Cognacflasche ab, trat zum Fenster, zog diesmal ausnahmsweise nicht den Vorhang zu, sondern betrachtete die Palmen, die sich vom Blau des Meeres abhoben.
»Der Glatzkopf wirft also alle Juden aus Italien«, stellte er fest.
»Nicht alle. Mussolini will nur die loswerden, die nach 1919 ins Land gekommen sind. Laut Dekret, das am 7. September veröffentlicht wurde, haben sie ein halbes Jahr Zeit, das Land zu verlassen, also bis März 1939.«
»Und wohin genau sollen sie seiner Meinung nach gehen? Hat er nicht mitbekommen, dass niemand sie haben will? Dass auf der Konferenz von Évian, zu der etliche Länder zusammengekommen sind, um das Flüchtlingsproblem zu lösen, keinerlei Beschluss gefasst wurde, weil sich nicht ein Land fand, das freiwillig Flüchtlinge aufnehmen will?«
Jérémie zuckte die Schultern. »Mussolini ließe sie notfalls im Mittelmeer ersaufen, Hauptsache, sein schönes Italien wird nicht mehr von einer außereuropäischen Rasse verunreinigt. Hitler hat ihn ja nun endlich davon überzeugt, dass als solche nicht länger nur die Afrikaner, auch die Juden zu gelten haben.«
»Das ist ja wie Schnupfen«, sagte Félix, »wenn man nur lange genug den Kopf mit einem Kranken zusammensteckt, kriegt man irgendwann eine rinnende rote Nase und kann nichts mehr riechen.«
»An Schnupfen stirbt man nicht.«
Obwohl die Fenster verschlossen waren, drangen gedämpft die üblichen Geräusche der Stadt in den Raum – die Musik der kleinen Strandrestaurants, wo mittelmäßige Sänger französische Schlager zum Besten gaben, das Knirschen der Räder jener Eselskarren, die sich im Stau der Automobile einreihten, die Rufe von Melonen- und Fischhändlern und das Signalhorn einer Jacht, die nach einem Ausflug in den Hafen einlief.
»Man stirbt auch nicht, wenn man ohne Visum nach Frankreich kommt«, sagte Félix.
»Aber nach allem, was ich gehört habe, ist die französische Regierung wegen dieses Dekrets höchst alarmiert und will die Grenzen dichtmachen …«
»Ach herrje. Unsere liebreizende Regierung lässt sich natürlich von all jenen Mächten vor sich hertreiben, denen nicht nur die Nase trieft, sondern aus deren Gehirn und Herz nichts weiter als Rotz fließt. Und anstatt ein Taschentuch bereitzuhalten, es muss ja keins aus Seide sein, es reichte schon eins aus normalem Leinen, wird einfach …«
Jérémie verlor die Geduld und machte einen so energischen Schritt auf Félix zu, dass die Cognacflasche, die dieser abgestellt hatte, fast umgefallen wäre. »Die jüdische Gemeinde von Nizza hat ein weiteres Komitee gegründet. Es dient ausschließlich dem Zweck, so viele jüdische Flüchtlinge wie möglich aus Italien hierherzubringen und zu verstecken. Ich weiß, Sie haben in Ihrem Hotel schon mehr als genug Emigranten aufgenommen, aber … aber Sie verfügen hier in Menton doch sicher über Kontakte, stehen im Austausch mit anderen Hoteliers, Besitzern kleiner Pensionen und Privatunterkünfte …«
»Wie lange kennen wir uns, Jérémie?«, fiel Félix ihm ins Wort.
»Seit einem guten Jahr.«
»Seit einem Jahr, richtig.«
Vage erinnerte er sich daran, wie der gehetzte Mann ihn angesprochen hatte, gefragt hatte, ob er eine jüdische Emigrantenfamilie beherbergen könne, für zwei, drei Nächte höchstens. Er nehme sie nur auf, wenn einer von ihnen Schriftsteller sei, hatte Félix bekundet. Einst habe er selbst einer werden wollen, sein Talent sei ihm jedoch nicht ausreichend erschienen.
Keiner der besagten Familie war Schriftsteller, der Vater lediglich Bibliothekar. Obdach hatte er ihnen am Ende doch gewährt – aus den zwei, drei Nächten waren mehr als dreißig geworden.
»Da Sie mich also so lange kennen, sollten Sie wissen: Ich pflege keine Kontakte, ich pflege erst recht keine Freundschaften, ich bin ein schrecklicher Ehemann. Meine Frau unterstellt mir wahlweise, dass ich nur aus Langeweile Emigranten helfe oder weil ich mich gern in Gefahr begebe. Sei’s drum. Ich tue es trotzdem. Sie werden nicht nur Unterkünfte brauchen, auch Boote.«
»Boote?«
»Na, über den Landweg werden es die Flüchtlinge nicht nach Frankreich schaffen, oder? Und selbst wenn, könnte ich dabei keine Hilfe sein. Die Grenze liegt inmitten von Bergen und Kalkfelsen, und so viel wie ich rauche, würde am Ende nicht ich einen Emigranten schleppen, sondern er mich – es sei denn, ich wäre zuvor schon abgestürzt. Aber gegen eine lauschige Bootsfahrt bei Mondschein habe ich nichts einzuwenden. Und um einen Fischer zu bezahlen, damit er mit seinem Kutter, statt Makrelen und Sardinen zu fangen, Menschen einsammelt, braucht man keine Kontakte, wie Sie es nennen, nur Geld.«
Jérémie starrte ihn lange an. »Und Sie würden dieses Geld dafür zur Verfügung stellen?«
»Noch lieber würde ich natürlich mit Ihnen etwas trinken, aber Sie wollen ja nichts von meinem Cognac haben. Also schauen Sie, dass Sie fortkommen, wir treffen uns von jetzt an immer am Dienstag um drei Uhr bei der alten Bastion, um die Fahrten der kommenden Woche zu besprechen.«
Jérémie betrachtete ihn nachdenklich, und in das Schweigen hinein ertönte wieder Hélènes Stimme. »Siehst du, es war gar nicht so schlimm. Und jetzt nimm deine Medizin.«
Jérémie runzelte die Stirn.
»Meine Mutter wird wirklich nichts verraten, glauben Sie mir«, sagte Félix. »Ich bin sicher, sie hat nicht einmal gehört, was wir besprochen haben. Und nun gehen Sie endlich! Wenn Sie meiner Frau begegnen, sagen Sie ihr, Sie wären mein Zigarettenhändler, der mich höchstpersönlich beliefert hat.«
Nachdem Jérémie gegangen war, betrat Félix Hélènes Schlafzimmer, einen kleinen Raum, der förmlich überquoll. Da waren Rundstuckaturen an der Decke, Schnitzereien und Spiegel an den Wänden, Plüschpolster auf jedem Möbelstück. Von jedem hing mindestens eine Lederquaste, desgleichen wie sämtliche damastene Tischdeckchen Fransen hatten.
»Sie will ihre Medizin nicht nehmen«, erklärte seine Mutter seufzend.
»Woran leidet sie denn?«, fragte Félix vermeintlich mitleidig. »An Schnupfen?«
Hélène blickte nachdenklich auf ihre Patientin, eine kleine Puppe mit Porzellangesicht, deren Bäckchen rot, deren Glasaugen strahlend blau waren und auf deren künstlichen blonden Locken ein Häkelhäubchen saß. Neben dieser lagen noch zehn andere sorgsam nebeneinander aufgereiht auf dem Bett.
Früher hatte Hélène Aubry in der Polyclinique ehrenamtlich ausgeholfen und echte Patienten betreut, doch irgendwann hatte sie begonnen, Fehler zu machen, hatte Tumorpatienten mit denen verwechselt, die nur an einer harmlosen Warze litten. Eines Tages hatte ein Arzt Félix beiseitegenommen, seinen Verdacht bekundet, dass Hélène einen Schlaganfall erlitten habe und als dessen Folge an vaskulärer Demenz leide. Als Hélène von der Diagnose erfahren hatte, hatte sie alles über diese Krankheit herausfinden wollen, hatte medizinische Bücher gewälzt, die Symptome auswendig gelernt, zu denen nicht nur der Verlust des Gedächtnisses, auch der des Geruchssinns zählte. Doch schon einige Tage später hatte sie alles wieder vergessen. Mittlerweile wusste sie nicht mehr, woran sie litt. Sie wusste ja nicht einmal, dass ihre Patientinnen nur Puppen waren, keine Menschen aus Fleisch und Blut.
»Ich bin sicher, sie wird wieder gesund«, murmelte Félix.
Hélène hob den Blick, musterte ihn, wie er da im Türrahmen stand, schon wieder rauchte oder noch immer. »Du darfst in der Krankenstube nicht rauchen.«
Félix zerdrückte die Zigarette am Türrahmen, die Asche fiel auf den dicken, flauschigen Teppich, und er trat so lange darauf herum, bis ein grauer Fleck entstand. »Wie wäre es, wenn du deinen Kranken einen Mundschutz häkelst?«, fragte er.
Hélène legte den Kopf schief, als würde sie ernsthaft darüber nachdenken. Am Ende sagte sie zu seinem Erstaunen aber nur: »Es ist gefährlich.«
»Was?«
»Mit dem Boot zu weit aufs Meer hinauszufahren. Dein Grandpère hat immer davor gewarnt.«