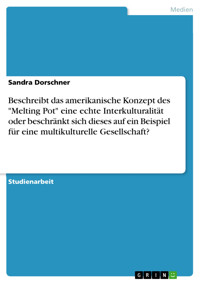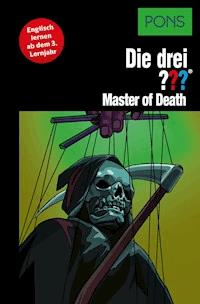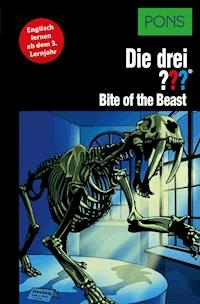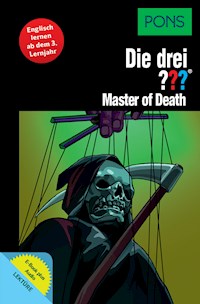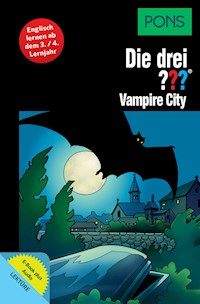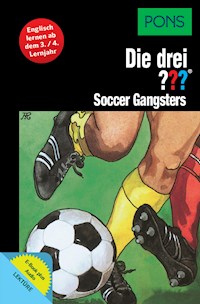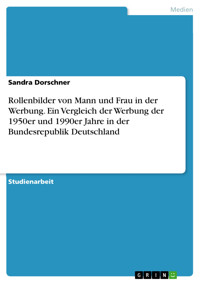
Rollenbilder von Mann und Frau in der Werbung. Ein Vergleich der Werbung der 1950er und 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland E-Book
Sandra Dorschner
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media, Note: 1,7, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Fachgebiet Interkulturelle Wirtschaftskommunikation), Veranstaltung: Wirtschaftsbezogene Kulturgeschichte Deutschlands, Sprache: Deutsch, Abstract: Das vorrangige Ziel von Werbung ist die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, um damit zum Kauf anzuregen. Dadurch sollen ein möglichst großer Absatz und Gewinn für das Unternehmen erzielt werden. Dabei werden Kampagnen gestartet, die in den Werbemitteln Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und auf Plakaten verbreitet werden. Sie sollen die Zielgruppen zum Kauf anregen. Oft werden auf Plakaten oder Anzeigen in Zeitschriften und in Fernsehwerbespots Männer- und Frauenbilder abgebildet, mit denen sich die Konsumenten identifizieren sollen bzw. die Sympathien wecken. Solche Rollenbilder sind eng mit gesellschaftlichem Wandel verbunden. Mit Hilfe von Leitbildern „verstärkt [die Werbung] die vorherrschenden Grundströmungen und liefert Muster für typisches, zeitgemäßes Verhalten. Sie spiegelt und sie lenkt den Zeitgeist.“. Vor allem bedient sie sich dabei an Männer- und Frauendarstellungen, die den traditionellen Rollenzuweisungen der jeweiligen Zeit entsprechen und sich während der Jahrzehnte verändern. Die Periode zwischen den 1950er und 1990er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ist von tiefgreifenden gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. Inwieweit sich diese Veränderungen bezüglich der Rollenzuweisungen in der Werbung in den 1950er und 1990er Jahren widerspiegeln, soll in dieser Hausarbeit näher untersucht werden. Dabei wird jeweils zunächst ein Überblick über die gesellschaftlichen Bedingungen und die Erscheinungen der Werbung im Allgemeinen gegeben, bevor danach die Männer- und Frauenbilder der beiden Jahrzehnte analysiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Rollenzuweisungen in der Werbung der 1950er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
2.1 Gesellschaftliche Situation der Zeit
2.2 Allgemeine Tendenzen der Werbung
2.3 Die Darstellung des Mannes
2.4 Die Darstellung der Frau
3. Rollenzuweisungen in der Werbung der 1990er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
3.1 Gesellschaftliche Situation in der Zeit
3.2 Allgemeine Tendenzen in der Werbung
3.3 Die Darstellung des Mannes
3.4 Die Darstellung der Frau
4. Zusammenfassung
5. Anhang
5.1 Abbildungen von Werbung der 50er Jahre
5.2 Abbildungen von Werbung der 90er Jahre
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das vorrangige Ziel von Werbung ist die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, um damit zum Kauf anzuregen. Dadurch sollen ein möglichst großer Absatz und Gewinn für das Unternehmen erzielt werden. Dabei werden Kampagnen gestartet, die in den Werbemitteln Fernsehen, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und auf Plakaten verbreitet werden. Sie sollen die Zielgruppen zum Kauf anregen.
Oft werden auf Plakaten oder Anzeigen in Zeitschriften und in Fernsehwerbespots Männer- und Frauenbilder abgebildet, mit denen sich die Konsumenten identifizieren sollen bzw. die Sympathien wecken.
Solche Rollenbilder sind eng mit gesellschaftlichem Wandel verbunden. Mit Hilfe von Leitbildern „verstärkt [die Werbung] die vorherrschenden Grundströmungen und liefert Muster für typisches, zeitgemäßes Verhalten. Sie spiegelt und sie lenkt den Zeitgeist.“[1]. Vor allem bedient sie sich dabei an Männer- und Frauendarstellungen, die den traditionellen Rollenzuweisungen der jeweiligen Zeit entsprechen und sich während der Jahrzehnte verändern.
Die Periode zwischen den 1950er und 1990er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland ist von tiefgreifenden gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt. Inwieweit sich diese Veränderungen bezüglich der Rollenzuweisungen in der Werbung in den 1950er und 1990er Jahren widerspiegeln, soll in dieser Hausarbeit näher untersucht werden. Dabei wird jeweils zunächst ein Überblick über die gesellschaftlichen Bedingungen und die Erscheinungen der Werbung im Allgemeinen gegeben, bevor danach die Männer- und Frauenbilder der beiden Jahrzehnte analysiert werden.
2. Rollenzuweisungen in der Werbung der 1950er Jahre in derBundesrepublik Deutschland
2.1 Gesellschaftliche Situation der Zeit
Da die Rollenbilder in der Werbung den Normen und Werten der Gesellschaft in einer bestimmten Periode entsprechen, werden zunächst die Lebensbedingungen in den 50er und zu Beginn der 60er Jahre in der BRD charakterisiert.
Die ersten Nachkriegsjahre bis Anfang der 1950er sind durch den Wiederaufbau des Staates und der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse gekennzeichnet.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den sogenannten „Trümmerfrauen“. Sie führten in vielen Bereichen einen Kampf ums Überleben und nahmen eine enorme Verantwortung für die Versorgung der Familie auf sich. Es gab für sie kaum Gelegenheit, um über ihre Rolle nachzudenken, vielmehr entdeckten sie ihre Stärke und entwickelten ein neues Selbstbewußtsein. Sie forderten gleiche Rechte und Pflichten und erfuhren seitens der Gesellschaft steigende Anerkennung.[7]Begünstigt wurde diese Entwicklung durch die Tatsache, dass die heimgekehrten, von Selbstzweifeln geprägten Männer sich schwer taten in das Alltagsleben zurückzufinden. Zusätzlich waren sie durch die Tüchtigkeit ihrer Frauen und deren gesteigertes Selbstbewußtsein verunsichert. Schnellstmöglich wollten sie ihre Rolle während des Zweiten Weltkrieges vergessen lassen. Ein passendes Mittel war die Werbung, die einen prägenden Einfluss auf das Geschlechterverhältnis nahm.[8]
Mit der Währungsreform vom 20. Juni 1948 setzte eine Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs, des „Wirtschaftswunders“, ein. Somit wuchs auch die Vorherrschaft der Männer in wirtschaftlich und politisch wichtigen4Positionen. Das weibliche Geschlecht begab sich wieder in die Rolle der Hausfrau und Mutter, jegliche Ansätze von Emanzipation oder Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wurden rückgängig gemacht.3 [9]
Doch bereits Ende der 1950er drangen immer mehr Frauen in die männliche Domäne der Berufswelt ein, so dass der „Doppelverdienerhaushalt“ zur Regel wurde.
Nachdem 1959 das Güterangebot wieder ausreichend gesichert war, schuf die Wirtschaft neue, künstliche Bedürfnisse, die mit neu geschaffenen Gütern befriedigt werden sollten. Vorherrschend war jedoch immer noch das „Sicherheits- und Wohlstandsstreben“[10], welches die Bürger eher zum Sparen oder Kauf von langlebigen Konsumgütern bewegte, als zu kurzfristigen Investitionen. Es vollzog sich der Wandel von der Nachkriegs- zur Wohlstandsgesellschaft, in der auch „die [...] ‘guten’ deutschen Tugenden wie Sauberkeitsbewußtsein, Strebsamkeit, Sicherheitsdenken usw. [...] wieder gepflegt [wurden]“[11]. Man zog sich in der Freizeit in das Privatleben zurück.
Das größte Vorbild in dieser Zeit waren die USA.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die 50er Jahre durch eine „Restauration der Geschlechterrollen“[12]gekennzeichnet sind. Ansätze von Emanzipation sind seit dem Wirtschaftswunder kaum noch zu erkennen, erst in den 60ern gelingt es den Frauen weiter in das Berufsleben vorzudringen und nicht mehr nur in der klassischen Rolle als Hausfrau, Mutter und Ehegattin erfüllt zu sein.
2.2 Allgemeine Tendenzen der Werbung
Angepaßt an die wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik steht die Werbung der Fünfziger zunächst ganz im Zeichen der „Bedarfsdeckung“[13]. In der seit 1949 wieder einsetzenden Wirtschaftswerbung verweisen die „Es gibt wieder Kampagnen auf die Wiederverfügbarkeit von Produkten[14]. Es stehen vor allem einfache Konsumartikel, wie Zigaretten, Bohnenkaffee oder Nylonstrümpfe im Mittelpunkt. Man kann sich wieder an Luxusgütern erfreuen[15].