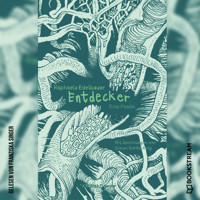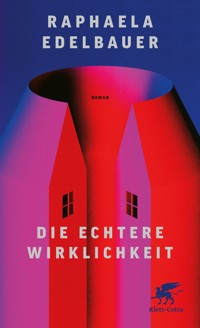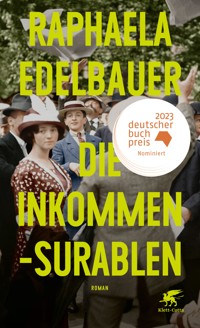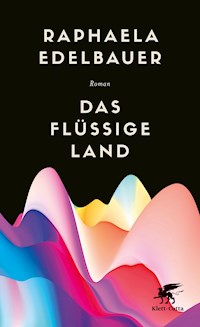13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ein überragendes Talent und erzählerisches Universalgenie.«Clemens Setz Sprache als Grundbaustein des Universums: Keine andere Autorin unserer Zeit denkt Naturwissenschaften, Literatur und Philosophie so radikal zusammen wie die preisgekrönte österreichische Autorin Raphaela Edelbauer. Ihre Poetikvorlesungen zeugen davon und bieten eine verblüffend neue Perspektive auf die Literatur. Im Werk von Raphaela Edelbauer greifen naturwissenschaftliches Denken und literarischer Erkenntnisdrang scheinbar mühelos ineinander. Dem liegt die These zugrunde, dass Naturwissenschaften, Literatur und Philosophie Kehrseiten ein und derselben Medaille sind und demzufolge auch mit ähnlichen Methoden erschlossen werden können. Wie das gelingt, zeigt die Autorin in faszinierenden Abschnitten zur Fiktionalität, zur Schreibpraxis und zur Metapherologie. Die Vorträge wurden für die Wiesbadener Poetikvorlesungen konzipiert und werden nun erstmals publiziert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Raphaela Edelbauer
Routinen des Vergessens
Wiesbadener Poetikvorlesungen
COTTA
Raphaela Edelbauer wurde für ihr Werk bereits vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Hauptpreis der Rauriser Literaturtage, dem Publikumspreis beim Bachmann-Wettbewerb, dem Theodor-Körner-Preis und dem Förderpreis der Doppelfeld-Stiftung. Ihre Romane »Das flüssige Land« und »Die Inkommensurablen« waren für den Deutschen Buchpreis nominiert, für ihren Roman »DAVE« erhielt sie den Österreichischen Buchpreis. 2023 wurde ihr die Poetikdozentur in Wiesbaden zuerkannt. Raphaela Edelbauer lebt in Wien.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Cotta
www.klett-cotta.de
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Esser printSolutions GmbH, Bretten
ISBN 978-3-7681-9808-0
E-Book ISBN 978-3-7681-9851-6
Besonderer Dank gilt meinem Vater, ohne dessen Buch »In welchen Himmel kommen tote Sonnen?« dieser Text nie entstanden wäre.
Einleitung
Die Texte, die im vorliegenden Band versammelt sind, entstanden anlässlich meiner ersten Poetikdozentur in Wiesbaden. Ich hatte zugegebenermaßen schon lange auf einen solchen Anlass gewartet, denn bereits mein erstes Buch Entdecker. Eine Poetik beinhaltet die Idee, dass Sprache der Grundbaustein des Universums ist, und zwar in einem ganz eigentlichen, literalen Sinn. Dass man eine so radikale Position irgendwann ausführlicher begründen muss, versteht sich von selbst, und gerade dies versuchen die folgenden Texte mit je eigenen Schwerpunkten.
Der erste Text zur Fiktionalität geht der Frage nach, wie Sprache in der Welt real wirksam werden kann. Im zweiten Abschnitt zur Praxis wird herausgearbeitet, mit welchen Mitteln der*die Schreibende ein so endloses Feld wie die Sprache überhaupt erkunden kann. Im dritten und letzten Teil über die Metapher verleihe ich der Ansicht Ausdruck, dass es so etwas wie Eigentlichkeit gar nicht gibt und dass statt einer oberflächlichen Ähnlichkeit sogenannter »Bilder« vielmehr ein Konzept wirksam wird, das ich als »Tiefengrammatik« beschreibe. Gerade dieser letzte Gedanke, dass Sprache die basalste Struktur ist, die uns zugänglich ist – und selbst Dingen wie logischen Gesetzen vorgeschaltet ist –, kann meine anfängliche These vielleicht etwas erhellen.
Zuletzt will ich vorausschicken, dass meine Texte auf der Auffassung beruhen, dass Philosophie und Literatur ein und dasselbe Feld sind, auch wenn sie sich durch die Konventionen der jeweiligen Betriebe an der Oberfläche sehr unterscheiden. Kurz gefasst sind die Qualitäts- und Wahrheitskriterien bei beiden insofern ästhetischer und selbstreflexiver Natur, als es auf eine »innere Stimmigkeit« des Textes ankommt. Nicht zuletzt versucht die Auswahl an Texten also auch, meiner Vorstellung literarischen Philosophierens näherzukommen und Anschaulichkeit und Freude am Kommunizieren in komplexen Themenfeldern zu vermitteln.
Fiktionalität
1.
Eine Anekdote, die mir mein Vater über den Beginn seines Philosophiestudiums erzählt hat, geht so: Er hatte sich für Physik inskribiert und besuchte am ersten Tag des Semesters ein Propädeutikum. Die Vortragenden wollten die jungen Student*innen für ihr Fach einnehmen und begannen die Einheit mit Experimenten – elektromagnetische Induktion mittels zweier Spulen, Schallausbreitung in der Vakuumglocke, Druckausbreitung in Gasen und so weiter. Erst wurde der Effekt des jeweiligen Mechanismus kalkuliert, dann die Ergebnisse verglichen und abschließend mittels Anschauung verifiziert. Als die Flammen wie berechnet züngelten, hob mein Vater die Hand und fragte, warum in aller Welt sich die Natur so verhalte, wie sie es auf ihrem Papier errechnet hatten. Statt einer Antwort gab ihm der Dozent einen Rat, den er letzten Endes auch befolgte: »Gehen Sie lieber rüber ins NIG zu den Philosophen.« Trotz dieser spröden Reaktion bin ich der Meinung, dass mein Vater hier etwas sehr Wesentlichem auf der Spur war. Die Frage, wieso wir mittels sprachlicher Zeichen und ihrer Relationen die Zukunft vorhersagen oder zumindest den Mechanismen der Natur in der sogenannten Realität nachstellen können, ist in keiner Weise trivial. Sie tangiert das Rätsel, wie und warum Begriffe sich auf die Welt beziehen können – aber auch jenes, warum uns das nicht als das Wunder erscheint, das es meiner Ansicht nach ist.
***
Etwa 34 Jahre später machte mich während meines eigenen Studiums ein Professor namens Richard Heinrich in einer Vorlesung über Rationalismus mit dem sogenannten Pappusproblem bekannt. Es handelt sich dabei um eine mathematische Frage, die Pappus von Alexandria im 4. Jahrhundert nach Christus stellte (und beantwortete) und die später René Descartes zu einigen Grundlegungen der analytischen Geometrie motivierte.[1] Bei einem Pappusproblem handelt es sich um ein sogenanntes Ortsproblem, womit eine Aufgabe gemeint ist, bei der zu gegebenen Bedingungen ein geometrischer Punkt (»ein Locus«) gefunden werden soll, der eben diese erfüllt.
In jenem Fall, den Pappus beschrieb, waren
beliebig viele Geraden l1 … lx,
eine Anzahl festgelegter Winkel w1 … wx sowie
bestimmte Längenverhältnisse der Linien, die den gesuchten Locus mit den Geraden im Winkel w verbinden (also z. B. ), gegeben.
Zur Illustration ein etwas konkreteres Beispiel: Gefunden werden soll ein Punkt zu drei gegebenen Geraden, sodass, wenn man den Punkt mit eben diesen Geraden in einem bestimmten Winkel (z. B. 45 Grad) verbindet, für die Längen der so entstandenen Distanzen gilt: .
Punkte, die diese Bedingungen erfüllen, gibt es dabei unendlich viele, denn aus ihnen entsteht eine Kurve.
Spannend ist nun die Methode, die Pappus vorschlägt, um die Punkte zu ermitteln. Seine Strategie liegt nämlich darin, so zu tun, als hätte man bereits die Lösung. Man setzt ein Zeichen ein, das die Lösung vertritt – das, was wir heute als Platzhalter für mathematische Objekte (z. B. Zahlen) einsetzen und als Variable bezeichnen. Mit dieser lässt sich bekanntlich so rechnen, als würde dort bereits eine Zahl stehen. Descartes’ Beschreibung, in der er sämtliche solcher Ortsprobleme durch die Erfindung des (naheliegenderweise) »kartesischen Koordinatensystems« generalisierte, ist viel komplexer, aber mir geht es nur um diesen einen Gedanken – dass man mit etwas eigentlich noch nicht Gefundenem rechnen kann.
Dass uns dieses Vorgehen in der Schule als vollkommen ordinär beigebracht wird, verschleiert, wie unglaublich radikal diese Idee war und bis zu einem gewissen Grad noch ist. Wir können nämlich nicht nur mit dem Imaginären so umgehen, als wäre es real, und es in die Lücken der Wirklichkeit hineinschreiben, sondern wir sind hier sogar auf das Antizipierte angewiesen, um es ins Reale zu überführen. Die Zahl tritt erst als Abwesend-Imaginäres, als bloßer Stellvertreter, auf; sobald man sie jedoch gefunden und damit »bewiesen« hat, noch einmal als sie selbst. Eine Fiktion dient hier dazu, durch Permutation der Verhältnisse in die Wirklichkeit überzugehen, sich gleichsam selbst aufzufinden.
***
Eine tiefergehende Analyse dessen, was die Frage meines Vaters und Pappus gemeinsam haben, steckt im Wesentlichen ab, was eine Fiktionalitätstheorie für mich leisten muss. Beide Beispiele zeigen – aus je verschiedenen Bereichen kommend –, dass das sogenannte »Echte« und das Imaginäre an gewissen Punkten permeabel zueinander sind. In den folgenden Abschnitten wird immer deutlicher hervortreten, dass sie sogar aufeinander angewiesen sind oder, noch radikaler formuliert, dass das, was wir normalerweise als Realität bezeichnen, nur eine sehr spezielle und privilegierte Form der Fiktion ist. Das kehrt auf den ersten Blick die Richtung um, in der viele literaturwissenschaftliche Fiktionalitätstheorien operieren, indem sie annehmen, die Fiktion sei eine verzerrte, erfundene Variante der echten Welt.1 Ich will mich hier jedoch auf einen anderen Punkt konzentrieren – und zwar auf das Rätsel, warum Fiktion selbst in den Naturwissenschaften eine tragende Rolle spielt. Der ontologische Status fiktionaler2 Objekte hat es in sich, und meine These ist es, dass die Mechanismen literarischer Fiktion all unsere Erkenntniswerkzeuge, bis hin zur wissenschaftlichen Modellbildung, erst ermöglichen.
2.
Es ist kein Geheimnis, dass ich in meinem Schreiben maßgeblich von den Spielen der Firma Nintendo beeinflusst wurde. Zwar kaufe ich zuweilen auch Titel anderer Entwicklerstudios oder das ein oder andere Indie-Spiel, aber etwas an den Blockbustern meiner Lieblingsfirma ist über die letzten 30 Jahre unvergleichlich geblieben und zieht immer neue Generationen von Spieler*innen in seinen Bann. In den sich wandelnden Moden der Videospielbranche hat Nintendo sich seine Einzigartigkeit bewahrt, indem die Marke immer eisern an ihrer Identität festgehalten hat. Dieses Festhalten drückt sich vor allem in einer sehr bestimmten Haltung aus, die für große Studios höchst ungewöhnlich ist. Shigeru Miyamoto, der Franchises wie Supermario oder Zelda erfunden hat, fasste diese Besonderheit einmal treffend zusammen: Nintendo ginge es nicht um Realismus in den Spielen, sondern um Realität. Das zeigt sich nicht nur in der Software, die Nintendo produziert, sondern auch in der Hardware, denn die Nintendo Switch hat eine 1.6 Mal langsamere CPU und 4 Gigabyte weniger RAM als die gleichzeitig erschienene Playstation 4. Das ist ein Zeichen recht eindeutiger Prioritäten. Andere Studios wie Virgin Games, Activision oder Ubisoft produzieren mit immer aufwendigerer Technik nahezu fotorealistische Spiele, die aufgrund der hohen Anforderungen an die Grafik jedoch immer linearer werden. Keine Frage, das kann Spaß machen, aber es bringt auch erhebliche Limitierungen mit sich. Denn das Problem an diesen Blockbustern – sagen wir »The Last of Us« – ist, dass sie einem Anspruch nachlaufen, der niemals eingelöst werden kann: Sie versuchen, die echte Welt zu simulieren. Dieser Realismus stürzt einen von einem Uncanny Valley ins nächste; die kleinsten Imperfektionen wirken vor dem Hintergrund des generellen Realismus gespenstisch. Eine Frage bleibt bei einer solchen Strategie ungeklärt: Basiert unsere Weltwahrnehmung wirklich auf dem »Aussehen« dieser Welt oder einer exakten Replikation einer bestimmten, genormten Sinneserfahrung? Ist es sinnvoll, dass eine immer bessere Grafik und eine höhere Rechenleistung für mehr NPCs eine permanent komplizierter werdende Täuschung erzeugen? Oder ist es etwas ganz und gar anderes, das uns den Eindruck schenkt, einer neuen, reichhaltigen Welt zu begegnen? Einer Welt, die vollkommen kohärent und fast real erscheint, obwohl sie offenkundig nicht echt ist? Warum wirken »The Legend of Zelda: Breath of the Wild« mit seinen comichaften Cel-Shading-Elementen, oder »Pikmin 4« mit seinen überzeichneten Makroansichten, warum das animehafte »Xenoblade« so komplett und eben: wirklich? Warum scheint das Indie-Spiel »Stardew Valley« einen Kosmos mit allen notwendigen Möglichkeiten zu enthalten, obwohl er buchstäblich im 8-bit-Look daherkommt?
Weil Realität priorisiert wird, nicht Realismus. Realität bedeutet hier, dass die Kohärenz von Naturgesetzen oder die Vollständigkeit einer Welt in sich stimmig ist, unabhängig davon, ob diese mit der echten Welt übereinstimmt. Realismus hingegen ist Mimesis, und diese muss an einem gewissen Punkt immer scheitern, weil sie, selbst wenn sie das Nachgeahmte einholen könnte, maximale Doppelung wäre. Realität hingegen ist der Grundbaustein nicht nur einer, sondern aller denkbaren Welten.
Diese Dichotomie lässt sich weiterdenken und auf die Literatur übertragen. Die eigentlich erstaunliche Tatsache, dass erfundene Welten – ja, sogar solche, die es niemals geben wird – bedeutungsvoll für uns sein können, hat damit zu tun. Sie sind unrealistisch, aber real. Warum erschafft z. B. die »Foundation«-Trilogie von Isaac Asimov eine Form von Plausibilität, Kohärenz – ja, eine Form von Wahrhaftigkeit –, wenn alles, wovon erzählt wird, kontrafaktisch ist? Es ist, ganz wie in Nintendos Pikmin-Spielen, ausgeschlossen, dass dies qua Repräsentation geschieht – das Repräsentierte gibt es schlicht und einfach nicht. Alle erzählende Literatur hat wenigstens in einer abgeschwächten Form mit diesem Widerspruch zu tun, der in der philosophischen Fachliteratur heftig debattiert wird.
Unter dem Paradox of Fiction versteht man ein von Colin Radford und Michael Weston 1975 beschriebenes Dilemma.[2] In ihrem Paper geht es um die Frage, warum wir für fiktive Figuren, wie beispielsweise Anna Karenina, Empathie empfinden können. Erweitert man diesen Gedanken auf alle Übertrittsflächen, an denen Literatur real wirksam wird, entstehen weitere Fragen: Warum überhaupt können wir Prosa auf unser eigenes Leben beziehen oder aus fiktiven Versuchsanordnungen etwas lernen? Wie wird ein politisches Theaterstück für einige Zuschauer*innen realpolitisch wirksam, und warum hat Nabokovs Lolita seinerzeit eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst, wenn doch alles darin ausgedacht ist? Ich würde sagen: Weil Fiktion nichts mit Erfindung zu tun hat. Gute Literatur findet ihr Spielfeld nicht im Realismus, sondern in der Realität und ist in dieser Bemühung zuweilen realer als die wirkliche Welt selbst.3
***
Für die Anschaulichkeit dessen, was ich unter dem speziellen Wahrheitsanspruch der Dichtung und den Mechanismen verstehe, die es ihr erlauben, in der Welt zu wirken, habe ich drei Punkte im Sinn. Ich nenne sie: a) Zusammenfall von Sinn und Bedeutung, b) Wahrheitsanspruch der Methode, c) Notwendigkeit des Kontingenten. Sie alle beschreiben Eigenschaften, in denen Fiktion sich von alltäglichem Sprechen unterscheidet und die deswegen bemerkenswert sind.
Zusammenfall von Sinn und Bedeutung
Die Logik – und auch unsere Alltagssprache – fordert, dass ein Satz und seine Wahrheitsbedingungen voneinander getrennt sind. Sage ich etwa zu Ihnen: Wiesbaden ist eine Stadt von etwa 283 Millionen Einwohner*innen, so können Sie diesen Satz anhand von Fakten, die außerhalb des Satzes liegen, nachprüfen. Sie werden bei Wikipedia nachschauen, einen kundigen Menschen fragen oder bei der Stadtverwaltung anrufen. Was Sie nicht tun werden, ist, den Satz 200 Mal zu lesen, denn die Erwartung, dass Sie dadurch mehr über seine Wahrheit lernen, wäre absurd. Dieser zentrale Anspruch unseres Weltverständnisses, dass eine Behauptung unterschieden ist von dem, was sie wahr macht oder wie wir sie überprüfen, gilt in der Fiktion jedoch nicht. Würde ich etwa schreiben: »Es war ein kalter November in Wiesbaden, und es regnete schon den fünften Tag in Folge«, so wäre damit gleichzeitig eine Welt geschaffen und etwas, was in ihr wahr ist. Wie grundlegend dieser Unterschied ist, zeigt auch ein zweites Beispiel: »In Atlantis zahlten wir Steuern auf das Schnäuzen.« Dieser Sprechakt besagt zum einen, dass Atlantis existiert, und zugleich wird etwas über Atlantis behauptet.
Literarische Sätze sind an nichts zu überprüfen, außer an sich selbst und dem sie umgebenden Text. Diese Besonderheit, die ich im Frege’schen Sinne[3] als Zusammenfall von Sinn (dem Satzgehalt) und Bedeutung (dem Wahrheitswert) bezeichne, ist eine wirklich einzigartige Besonderheit fiktiven Erzählens, die uns nur deswegen nicht auffällt, weil wir sie so gewohnt sind. Der Begriff von Wahrheit ist hier, da er quasi selbstreferenziell ist, so speziell, dass er radikal von unserem »normalen« unterschieden ist und zu bizarren Folgen führt, auf die ich später noch eingehen werde.
Wahrheitsanspruch der Methode
Ein berühmtes Beispiel in der Fiktionalitätstheorie angelsächsisch-analytischer Prägung ist Sherlock Holmes, der wie ein Kistenteufel aus allen Papers springt. Eine der beliebten Fragestellungen geht etwa so: Was bringt uns dazu, »Sherlock Holmes was a brilliant detective« als wahr zu betrachten, aber »Sherlock Holmes was a plodding policeman« als falsch, wenn es ja eigentlich gar keinen Sherlock Holmes, also gar kein Referenzobjekt, gibt? Ein solcher Satz sei elliptisch, sagt David Lewis[4], und bedeute eigentlich: »In Arthur Conan Doyle’s book Sherlock Holmes was a brilliant detective.« Aber dieser Gedanke wirft einige Probleme auf. Leser*innen erfahren aus der Holmes-Lektüre beispielsweise auch, dass London die Hauptstadt Englands ist. »In Arthur Conan Doyle’s book London was the capital of England« klingt aber ebenso falsch wie »In Patrick Süßkinds Roman kann Parfum durch Mazeration hergestellt werden«. Beide Sätze würden, obschon aus den Büchern gelernt, ohne den ersten Teil des Satzes wesentlich richtiger klingen. Platon bezichtigte die Dichter wegen ihres fiktionalen Sprechens bekanntlich als Lügner.[5] Aber warum können wir dann Tatsächliches aus ihnen lernen?
Auch wenn Kendall Walton in seinem berühmten Essay von 1978 Literatur eine Qualität namens »fiktionaler Wahrheit« zuspricht,[6] verfehlt er jedoch meiner Ansicht nach, was die wirkliche Bedeutung eines Textes ist. Weder die Tatsache, dass Sherlock Holmes in der Bakerstreet wohnt, noch seine Drogenabhängigkeit bilden den eigentlichen Gehalt eines Textes. Hoch spannend ist dagegen die Erkenntnis, dass sich Fakten der Welt in bestimmter Weise deduzieren lassen. Wie sich die Elemente der Geschichte zueinander verhalten und sich die Form des Textes aufschließen lässt, generiert am Ende die Bedeutung des Textes – und dies ist eine tatsächliche, keine fiktionale Wahrheit. Hier geht es demnach auch nicht um die Textinterpretation. Der epistemologische Kern eines literarischen Textes verweist durch seine Struktur auf eine tatsächliche Wahrheit, die in der sogenannten »Welt« gilt. Die fiktionalen, nicht in der Welt geltenden Wahrheiten sind dagegen nur eine Art Hilfskonstruktion wie die imaginäre Variable im Pappusproblem. Beides lässt sich an folgendem Beispiel veranschaulichen: In meinem Roman Das flüssige Land wird in der Gemeinde Groß Einland eine Physikerin namens Ruth Schwarz mit der Vertuschung eines in der Vergangenheit liegenden Verbrechens durch eine Gräfin konfrontiert. All diese Elemente sind erfunden, also nicht im eigentlichen Sinne wahr. Die Relation dieser Dinge aber, die durch eine formale Präsentation behauptet