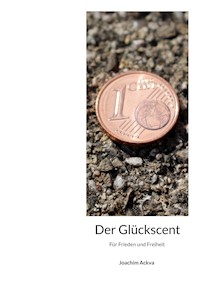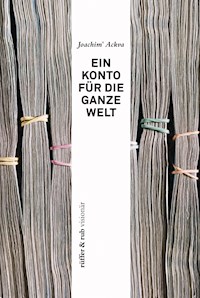
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rüffer & Rub
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: rüffer&rub visionär
- Sprache: Deutsch
Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Frieden: Die Welt gibt mehr Geld für Rüstung aus als im Kalten Krieg. Wohlstand: Für viele nicht erreichbar. Naturerhalt: Seit 1970 halbierten sich die Populationen jener Tiere, die eine wichtige Grundlage des Ökosystems bilden. Die Politik ist zur Lösung der Probleme nicht fähig. Seit 2015 gibt es zwar erstmals in der Geschichte global verhandelte, konkrete Ziele, die 17 UN Global Goals. Doch das Allgemeinwohl ist nicht die Aufgabe nationaler Regierungen. Der nächste Schritt liegt bei der Zivilgesellschaft, bei jedem Einzelnen von uns. Joachim° Ackva fordert, dass jeder Mensch auf ein Konto, welches das UN-Sekretariat verwaltet, freiwillig ein Tausendstel des Privatvermögens einzahlt. Damit könnten alle UN Global Goals entscheidend vorangebracht werden. Multinationale Umfragen weisen darauf hin, dass viele Menschen dazu bereit sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Joachim° Ackva
EIN KONTO FÜR DIE GANZE WELT
Der Autor und der Verlag bedanken sich für die großzügige Unterstützung bei
Elisabeth Jenny-Stiftung Stiftung Corymbo
Erste Auflage Herbst 2016 Alle Rechte vorbehalten Copyright ©2016 by rüffer & rub Sachbuchverlag GmbH, Zürich [email protected] | www.ruefferundrub.ch
Schrift: Filo Pro Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Papier: Werkdruck holzfrei (FSC) bläulichweiß, 90 g/m², 1.75 E-Book: Clara Cendrós
ISBN 978-3-906304-04-5 ISBN e-book: 978-3-906304-09-0
Inhalt
Vorwort [von Anne Rüffer]
Überblick
Der Ist-Zustand der globalen Zusammenarbeit
Soll-Zustand
Mittelverwendung: Welche Ziele bringt das Weltkonto konkret voran?Mittelverwaltung: Welche Art von Weltkonto kann in kurzer Zeit tatsächlich funktionieren?Mittelherkunft: Wie finanziert sich das Weltkonto?Dank
Umfrage
Anhang
Anmerkungen
Bildnachweis
Vorwort
2. Dezember 2015, Genf. Im voll besetzten »Auditorium Ivan Pictet« hat sich ein hochrangiges Publikum versammelt, um die aktuellen Preisträger des Alternativen Nobelpreises zu ehren. Selten stimmt die Adresse eines Ortes so unmissverständlich mit den Inhalten der Veranstaltung überein wie an diesem Abend: »Maison de la Paix«. Deutschlands Umweltministerin Barbara Hendriks und UN-Generaldirektor Michael Møller eröffnen den Anlass, der unter dem Titel steht: »On the Front-lines and in the Courtrooms: Forging Human Security.«
In der darauf folgenden Diskussion der vier Preisträger von 2015 fällt auf einmal die Aussage, die mich elektrisiert: »Die UN wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um nachfolgende Generationen vor der Geisel des Kriegs zu bewahren. Seither hat es über 170 Konflikte gegeben – und ihr habt die Möglichkeit einer Abschaffung von Kriegen nie diskutiert? Come on, guys, das ist doch unglaublich!« Verlegenes Gelächter und ungläubiges Staunen im Publikum, doch Dr. Gino Strada, Gründer der internationalen Hilfsorganisation »Emergency« weiß nur zu gut, wovon er spricht: Seit den frühen 1990er-Jahren baut er Kliniken in Kriegsregionen und kümmert sich um die zivilen Opfer – 10 % sind Kämpfer der verschiedenen Kriegsparteien, 90 % Zivilisten. Er beendete sein Statement mit der Feststellung: »Nennt mich ruhig einen Utopisten, denn alles ist eine Utopie, bis jemand seine Idee in die Tat umsetzt.«
Einer der wohl meistzitierten Sätze der letzten Jahrzehnte lautet: »I have a dream.« Nicht nur Martin Luther King hatte einen Traum – viele Menschen träumen von einer gerechteren Welt für alle. Und es sind einige darunter – mehr als wir wissen und noch lange nicht genug –, die ihren Traum mit Engagement, Herz und Verstand realisieren. Es sind Pioniere in ihren Bereichen, man mag sie – wie Gino Strada, Martin Luther King, Mutter Teresa oder Jody Williams – durchaus Utopisten nennen. Doch: Jede große Errungenschaft begann mit einer Idee, einer Hoffnung, einer Vision.
Den Funken einer Idee, einer Hoffnung, einer Vision weiterzutragen und damit ein Feuer des persönlichen Engagements zu entzünden, das ist die Absicht, die wir mit unserer neuen Reihe – wir nennen sie »rüffer&rub visionär« – verfolgen. Im Mittelpunkt steht die persönliche Auseinandersetzung der Autoren mit ihrem jeweiligen Thema. In packenden Worten berichten sie, wie sie auf die wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Frage aufmerksam geworden sind und was sie dazu veranlasste, sich der Suche nach fundierten Antworten und nachhaltigen Lösungen zu verpflichten. Es sind engagierte Texte, die darlegen, was es heißt, eine persönliche Verpflichtung zu entwickeln und zu leben. Ob es sich um politische, gesellschaftliche, wissenschaftliche oder spirituelle Visionen handelt – allen Autoren gemeinsam ist die Sehnsucht nach einer besseren Welt und die Bereitschaft, sich mit aller Kraft dafür zu engagieren.
So vielfältig ihre Themen und Aktivitäten auch sein mögen – ihr Handeln geschieht aus der tiefen Überzeugung, dass eine bessere Zukunft auf einem gesunden Planeten für alle möglich ist. Und: Wir sind davon überzeugt, dass jeder von uns durch eigenes Handeln ein Teil der Lösung werden kann.
Anne Rüffer
Überblick
Seit mehr als zwei Millionen Jahren wandert unsere Gattung Homo über die Erde. Wir modernen Menschen blicken auf 200 000 Jahre Dasein und einige Tausend Jahre der Zivilisation zurück. Nun ist ein neues Zeitalter angebrochen. Wissenschaftler nennen es »Anthropozän», das »von Menschen gemachte«. Der Homo sapiens ist der Hauptfaktor für die Veränderung der Erdphysik geworden, inklusive Klima, biologischer Vielfalt, Kohlenstoff-, Wasser- und Stickstoffzyklus.
»Man kann das Ausmaß und die Geschwindigkeit der Veränderungen kaum überschätzen«, analysiert das Stockholm Resilience Centre.1 »In einer Generation ist die Menschheit zu einer planetenweiten geologischen Kraft geworden.« Mit der Macht, alles zu verändern, wächst uns Verantwortung zu. Unsere Kraft in eine Bahn zu lenken, die zu Frieden, Wohlstand und Naturerhalt führt, ist die Herausforderung des Anthropozän.
Man mag an dieser Stelle den Kopf schütteln. Frieden? Die Welt gibt mehr für Rüstung aus als im Kalten Krieg. Wohlstand? Für viele nicht erreichbar. Und für die Besitzenden steht ihr Wohlstandszuwachs auf den tönernen Füßen einer globalen Rekordverschuldung. Naturerhalt? Seit 1970 halbierten sich weltweit die Populationen jener Tiere, die das Gewebe der lebenserhaltenden Ökosysteme bilden. Es ist klar: Die bisherige Politik wird der Herausforderung des Anthropozäns nicht gerecht – und sie ist auch bei bestem Willen dazu nicht fähig. Denn die Globalisierung trägt in sich einen strukturellen Managementfehler, der angemessene Zusammenarbeit in globalen Fragen verhindert. Dadurch werden Krisenursachen oft nicht angepackt, das Vertrauen schwindet, die reaktionärnationale Versuchung wächst. Ein wichtiger Schritt zum Beheben dieses Problems wurde bereits getan: Es gibt erstmals in unserer Geschichte global verhandelte, konkrete und menschheitsweite Ziele, die UN Global Goals. Sie wurden auf Betreiben der UN im September 2015 von den Regierungen der Welt beschlossen. Die Ziele stehen nun zumindest auf dem Papier – entscheidend ist, was davon wirklich umgesetzt wird. Nationale Regierungen tragen dazu meist nur begrenzt bei – das globale Allgemeinwohl ist naturgemäß nicht ihre Aufgabe. Daher liegt der nächste Schritt bei uns als Zivilgesellschaft, bei jedem Einzelnen von uns. Wir können den bislang politisch und bürokratisch oft gelähmten UN-Dienst zu einer starken »Globalen Hausverwaltung« ausbauen, welcher die Menschheitsziele fördert und koordiniert. Wir können ihn dazu mit einer neuen Gemeinschaftskasse ausstatten. Was für ein Betrag ist dafür erforderlich? Auf jeden umgerechnet, ist es ein Tausendstel des eigenen Privatvermögens. Beispiel: Wer 1000 Euro besitzt, hätte 1 Euro freiwillig einzuzahlen. Multinationale Umfragen weisen darauf hin, dass viele Menschen bereit sind, diesen Beitrag zu leisten – sowohl Arme wie Reiche. Wer diese Vision real werden lassen möchte, kann ab November 2016 auf ein »Pilot-Weltkonto« überweisen. Jeder Einzahler entscheidet dabei selbst, welche der 17 Global Goals gefördert werden sollen. Damit wirkt die Einzahlung gleichzeitig wie eine Abstimmung über das, was uns wichtig ist. Dieses Pilotkonto wird später dem UN-Generalsekretär António Guterres angeboten, verbunden mit der Bitte, die Einrichtung eines echten UN-Weltkontos zu prüfen. Mit dem Multi-Partner-Trust-Fund-Konzept verfügt der UN-Dienst bereits heute über eine passend skalierbare Infrastruktur.
Das Risiko-Chance-Profil eines UN-Weltkontos: Im schlimmsten Fall ist ein Tausendstel des eigenen Vermögens verloren. Im besten Fall bewirken wir entscheidend mehr globale Kooperation: Der UN-Dienst kofinanziert im Auftrag der Zivilgesellschaft die Menschheitsziele und bewegt viele Staaten, die Krisenursachen gemeinsam mit uns als Zivilgesellschaft anzupacken. Wir schaffen damit einen sichtbaren Leuchtturm des globalen Gemeinsinns. Wir sorgen für mehr Orientierung, Ausgleich, Vertrauen und Stabilität. Wir bewahren uns vor persönlichen Verlusten, die weit höher als ein Tausendstel des Vermögens ausfallen können. Wir beenden den Rückzug der globalen Zivilgesellschaft und schützen unsere persönliche Freiheit vor politischen Verwerfungen. Die kommenden Seiten beschreiben den Ist-Zustand des globalen Managements, den Soll-Zustand und schließlich die resultierenden, persönlichen Maßnahmen für jene, die mitwirken möchten.
Joachim° Ackva, Juli 2016
Der Ist-Zustand der globalen Zusammenarbeit
Es gibt weltweit mehr Privatvermögen denn je. Eine für unsere Vorfahren kaum vorstellbare Technik wartet auf unsere Befehle. Wir globalisieren Ressourcennutzung, Warenströme und Informationen, begleiten dies jedoch nicht mit einer passenden Organisation des menschlichen Miteinanders. Wir verfügen über immer mehr Kräfte und werden dennoch ratloser, weil es kaum Strukturen gibt, um sie zielgerichtet auf globaler Ebene zu entfalten.
In der Presse lesen wir Beschreibungen wie die des »ZEIT«-Journalisten Jörg Lau:2 »Zerfall ganzer Staaten(-systeme) wie in Arabien; weltweite Renaissance des Autoritären; Wiederkehr von Tribalismus und Glaubenskriegen; Selbstschwächung des Westens durch einen Kapitalismus, der soziale Unwuchten verstärkt; Flüchtlingsströme als nächste Globalisierungsstufe. Wie in dieser Lage eine freiheitliche Ordnung gedeihen kann, weiß in Wahrheit niemand. Jedenfalls nicht durch Machtgehabe, ›Gleichgewichtspolitik‹ und die übliche ratlose Abfolge von Schurkenknutschen und -bombardieren.« Der Publizist Richard David Precht ergänzt:3 »Wir sind Getriebene und treiben nichts voran. Eine Zukunftsstrategie dagegen ist bei keinem Konfliktherd in Sicht … der gesamte Westen scheint gelähmt … und auch ein paar Milliarden mehr für Entwicklungshilfe sind keine Lösung. Ohne Strategie und kluge Menschen, die sie entwickeln, wird es nicht gehen … Doch bei Google und Facebook werden weiterhin Tausende Genies mit Milliardenaufwand ungezählte kommerziell erfolgreiche Antworten auf nicht gestellte Fragen finden – die wirklichen Probleme der Welt lassen sie stumm.«
Vieles davon trifft sicher zu, doch existiert auch ein konstruktiverer Blickwinkel: Eine Zukunftsvision ist vorhanden – die Weltordnung –, die von Genies wie de Groot, Kant und Einstein vorgedacht wurde. Nur haben wir diese Vision bislang nicht verwirklicht. Dadurch bleibt das globale Geschehen unter den knapp 200 Nationalstaaten unnötig chaotisch. Das Beispiel einer Wohnanlage mag dies illustrieren: Angenommen, 200 Wohnungseigentümer leben in einem Gebäudekomplex mit Grünanlagen und möchten diesen instand halten.
Möglichkeit 1 | Man betraut die einzelnen Wohnungseigentümer mit dieser Aufgabe. Um sich abzustimmen, werden sie endlos konferieren: Was will wer, wann und wo, von wem bezahlt tun? Dach, Fassade, Fenster, Kinderspielplatz, Treppenhaus, Keller, Wasserleitungen, Telekommunikation, Teich- und Baumpflege, Reinigungsdienst, Brandschutz und Müllsammelstelle? Manche werden sich engagieren, andere sich zurücklehnen, wieder andere viel versprechen und wenig halten. Aber das ist erst der Anfang. Die ganz unterschiedlich veranlagten Eigentümer sind weder professionell, noch kann man sie rechenschaftspflichtig für Gemeinschaftseigentum machen. Das alles verletzt eine Grundregel des erfolgreichen Managements: Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung gehören möglichst auf gleiche Ebene. Da diese Regel im vorliegenden Beispiel nicht beherzigt wird, sind die Hausbewohner bald zerstritten, und das Gemeinschaftseigentum leidet. Genau das beobachten wir in unserer planetaren Wohnanlage.
Die Politik nennt gemeinschaftliche Güter »Global Public Goods« (GPGs).4 Darunter fallen z.B. Frieden, Sicherheit, funktionierende Finanz- und Gütermärkte, stabiles Klima oder Regenerationsfähigkeit der Erde. Die meisten von uns wollen diese Gemeinschaftsgüter erhalten. Doch was tun wir? Wir legen sie in die Hände von 193 Regierungen, die naturgemäß nationale Interessen und Kompetenzen vertreten. »Wir leben in politisch paradoxen Zeiten. Denn während jeder (oder fast jeder) weiß, dass die zentralen Krisen, die zu bewältigen sind, globaler Natur sind, gibt es darauf kaum angemessene Antworten. Ob es die globale Finanzkrise ist … ob es die oft verschleierte Krise von Armut und Hunger in weiten Teilen der Welt ist, ob es die ökologische Problematik oder die sogenannte Flüchtlingskrise ist, stets fallen Problemanalyse und politische Reaktion dramatisch auseinander«, diagnostiziert der Politikwissenschaftler Rainer Forst, Leiter des Exzellenzclusters »Normative Ordnungen« an der Goethe-Universität Frankfurt.5 Gleichermaßen paradox wirkt, dass wir zum Er-halt von Gemeinschaftsgütern oft auf Konzerne setzen, die naturgemäß den Profitzwang repräsentieren. Daneben agieren zahllose zivilgesellschaftliche Organisationen, die relativ zur Aufgabe winzig und völlig zerstreut sind, oft um Zuwendungen konkurrieren. Global versuchen Zehntausende von Civil Society Organizations (CSO) mitzureden6 – ebenso gut könnten wir auch eine Handvoll Sand auf eine Dartscheibe werfen. Kompetenz und Verantwortung all dieser Akteure liegen unterhalb der Aufgabenebene. Selbst mächtige Nationen agieren weit unterhalb der Aufgabenebene. Mit dieser Politik kommt die Welt kaum weiter, oft vermehren nationale Eingriffe das allgemeine Chaos und die Desorientierung.
Möglichkeit 2 | Die Menschen in der Wohnanlage schaffen eine Instanz, die sich im Auftrag aller um die Instandhaltung der Wohnanlage kümmert – sie engagieren eine Hausverwaltung. Sie legen eine Gemeinschaftskasse an, mit der die neue Hausverwaltung das Gemeinschaftsgut instand hält. Sie verfügen damit über eine rechenschaftspflichtige Instanz, die Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung so gut wie möglich vereint. Die Hausverwaltung repräsentiert einen vollständigen Managementkreislauf: Ist-Analyse → Ziel setzen → Plan erstellen → Realisieren → Soll-Ist-Analyse. Sie formt keine »Regierung«, sondern einen von uns als Zivilgesellschaft abhängigen Dienstleister für gemeinschaftliche Aufgaben.
Diese Abgrenzung wird enorm beeutsam werden. Denn jeder Schritt hin zu einer Weltregierung stößt auf diamantharten Widerstand. Kaum eine Regierung oder nationale Legislative lässt sich gerne in ihre Partikularinteressen hineinreden, ohne dafür einen klaren Nutzen zu erhalten. Um dies zu verdeutlichen, ließe sich das Verhalten vieler Länder heranziehen. Als Pars pro Toto mögen hier die USA dienen. Genauso gut und noch besser könnten es je nach Fall auch andere Staaten illustrieren. Der US-Kongress beispielsweise verweigert bei der Klärung der Gebietsrechte rund um den Nordpol den Beitritt zum UN-Seerechtsabkommen. Mit der schmelzenden Arktis werden dort neue Fischgründe, Schiffsrouten und Rohstoffe am Meeresboden zugänglich. Gemäß UN-Seerecht prüfen Geologen nun anhand der unterseeisch fortlaufenden Festlandssockel der jeweiligen Staaten, wem welche Gebiete zustehen. Doch der US-Kongress will diese sachlich-geologische Lösung mit den UN nicht, sondern lieber national mit den anderen Arktis-Anrainern über die Grenzziehung verhandeln. Anderes Beispiel: Im Jahr 2002 ermächtigte der Kongress den US-Präsidenten zu einer militärischen Befreiungsaktion, falls vor dem internationalen Strafgerichtshof in den Niederlanden ein US-Bürger angeklagt würde. Hier konkurrieren nationale Strategien mit der Weltrechtsstrategie.
Die Lösung ist eine Globale Hausverwaltung, die nationale Souveränität respektiert und dabei allseits Nutzen bringend und legitimiert genug ist, um gemeinschaftliche Aufgaben und Rechte auf freiwilliger Basis voranzubringen. Der Dreh- und Angelpunkt ist allerdings die praktische Kraft der Globalen Hausverwaltung. Da wir inzwischen als einzelne Menschen vielerorts vernetzt sind, lässt sich diese Kraft heute viel besser sammeln als früher. Der Aufklärer Hugo de Groot vertrat den Weltordnungsgedanken bereits 1625, mitten im Dreißigjährigen Krieg.7 Immanuel Kant8 konstatierte 1795 eine Völkergemeinschaft, in der »die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefühlt wird«. Die im 19. und 20. Jahrhundert wurzelnden Gremien der Interparlamentarischen Union und des Völkerbunds folgten diesem Ideal. Doch solch supranationale Institutionen erhielten seit je wenig Kompetenzen von den Nationalstaaten.
Der Völkerbund zerfiel vor dem Zweiten Weltkrieg, weil einige Siegermächte des Ersten Weltkrieges ihn nur so lange beachteten, wie er ihren eigenen Interessen diente. Schließlich überfiel Japan im Jahr 1931 die Mandschurei, und Italien warf sich 1935 auf Äthiopien. Beide kamen mit ihrer völkerrechtswidrigen Mordbrennerei praktisch ungestraft davon. Das verdeutlichte, wie wenig die Nationalstaatenwelt willens war, sich für internationales Recht einzusetzen. Albert Einstein schrieb:9 »Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das gegenwärtige System souveräner Nationen Barbarei, Krieg und Unmenschlichkeit nach sich ziehen muss und dass nur ein Weltrecht zu einer zivilisierten friedlichen Menschheit führen wird.«
Heutzutage bemühen sich die UN zweifellos viel erfolgreicher als der Völkerbund um das Weltrecht. Doch Regierungen umgehen oder nutzen sie oft je nach taktischem Bedarf und beschneiden so den Ruf und die Wirkkraft der UN. Manche Regierungen gehen dabei sehr weit. Beispielsweise zerstörten die Wirtschaftssanktionen des UN-Sicherheitsrates gegen den Irak in den 1990er-Jahren dessen Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialsystem. Experten schätzen, dass dadurch u.a. bis zu einer halben Million Kleinkinder starben.10 Im Irak gab es kaum mehr sauberes Trinkwasser – das Importverbot umfasste auch Mittel zur Wasseraufbereitung. UN-Mitarbeiter, im Irak tätige Hilfsorganisationen und zahlreiche Regierungen erkannten den Kollaps und protestierten gegen die Sanktionsbedingungen, zwei UN-Programmleiter legten ihr Amt aus Protest nieder, 20 Mitarbeiter der Menschenrechtsabteilung ebenso. Die im UN-Sicherheitsrat für die Sanktionen verantwortlichen Regierungen führten die Blockade mit unverminderter Härte weiter. Sie argumentierten, der irakische Diktator sei schuld. Er müsse einlenken und belegen, dass er keine Massenvernichtungswaffen besitze.11 Eine Katastrophe und moralische Selbstschwächung der Menschheit nahmen ihren Lauf: »Wir haben die Beweise für das Leiden der Zivilbevölkerung regelrecht geleugnet und jeden mundtot gemacht, der die Sanktionen infrage stellte«, sagt der zuständige britische Diplomat Carne Ross rückblickend. Von ihm wurden auch die Äußerungen des UN-Generalsekretärs überwacht. »Ich habe die Berichte seines Büros vor Erscheinen redigiert. Annan hat gesagt, was wir wollten.« Ross quittierte 2004 desillusioniert den Dienst. Nach 15 Jahren Diplomatie war in ihm die Überzeugung gereift, dass Regierungen der Grund für viele Instabilitäten in der Welt sind. Er sah zu oft geschützte Eliten politische Entscheidungen treffen, deren Konsequenzen Schutzlose zu tragen hatten.12
Eine klare Abwertung erfahren die UN auch durch den Trend, dass mächtige Regierungen ihre Beschlüsse lieber in von der UN unabhängigen Gremien abstimmen, in abgegrenzten Interessengemeinschaften wie den G8 oder in der OECD, sodass schwächere Staaten von den Entscheidungen zwar oft betroffen sind, aber kaum mitreden können. Bezeichnend ist auch, dass eine privatwirtschaftlich organisierte Veranstaltung wie das Weltwirtschaftsforum in Davos viel Zulauf erhält, während die UN an Präsenz und Status eingebüßt haben. Gleichwohl stellen die UN mit ihren Unterorganisationen die am häufigsten ausgezeichneten Friedensnobelpreisträger. Als globaler Zusammenschluss von zzt. 193 Staaten verfügen sie potenziell über eine hohe Legitimation. Sie kümmern sich gemäß ihrer Charta um die Sicherung des Weltfriedens, um den Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit auch im wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Bereich. So wurden im zivilen Sektor sehr erfolgreich souveräne Staaten in ein internationales Regelwerk eingebunden und zahlreiche Abkommen geschaffen, die z.B. die internationale Luftfahrt oder die weltweite Postversendung ermöglichen. Bei genauerem Hinsehen zeigen die UN zwei Gesichter. Das eine Gesicht bilden die Regierungsvertreter. Sie organisieren sich in bestimmten UN-Gremien: in der Generalversammlung, im Sicherheitsrat, im Wirtschafts- und Sozialrat usw. Sie definieren dort Ziele, vergeben Ressourcen und verfolgen dabei naturgemäß oft ein kurzfristiges Nationalinteresse. Entsprechend dem UN-Gründungsjahr 1945 spiegelt sich dabei die Nachkriegsordnung wider: Die fünf Siegermächte dominieren den UN-Sicherheitsrat und können per Vetorecht alle Mehrheitsentscheidungen bezüglich Sanktionen oder militärischen Eingreifens in Konflikte blockieren. Im Hauptorgan der UN-Generalversammlung sitzen weisungsgebundene Diplomaten aller 193 Regierungen. Hinter ihnen stehen verschiedenste Herrschaftsformen mit mehr oder weniger Bürgerbeteiligung. Dabei gilt: Ein Land – eine Stimme. Ein Kleinstaat wie Tuvalu besitzt das gleiche Stimmgewicht wie China, in dem über hunderttausendmal mehr Menschen leben.
»Mir wurde in diesen Jahren immer klarer, wie unglaublich hegemonial oft vorgegangen wurde, um die UNO so zurechtzuschneidern, dass sie den politischen Zielen der Großmächte … angepasst wurde«, sagt Hans-Christof Graf Sponeck nach rund drei Jahrzehnten in verantwortlichen UN-Positionen. Er fährt fort: »Die Auslegung der UN-Charta, vor allem die Auslegung von Art. 100 und Art. 101, muss sehr viel ernster genom-men werden. Art. 101 definiert, welche Mitarbeiter in der UN tätig sein sollen: Da geht es um Effizienz, um Kompetenz und um Integrität. Und Art. 100 sagt: Regierungen, lasst eure Finger aus der UNO-Arbeit heraus. Definiert die Politik, aber der UNO-Generalsekretär und seine Mitarbeiter sind verantwortlich für die Umsetzung. Solange die Regierungen immer wieder versuchen, auf der Führungsebene ihre eigenen Leute zu platzieren … solange kann die UNO nicht optimal arbeiten.«13
Das zweite Gesicht der UN ist also das ausführende Sekretariat mit seinem internationalen Dienst unter dem Generalsekretär. Die Aufgabe dieses zweiten Gesichts ist es, unabhängig von Einzelinteressen für die internationale Gemeinschaft zu wirken. Diese Pflicht lässt sich allerdings nur schwer erfüllen, solange der ausführende Dienst seine Ressourcen von Regierungsgremien erhält, die naturgemäß national gesinnt sind. »Viele der Defizite der UN sind strukturell bedingt – und verwurzelt im begrenzten Interesse der Mitgliedsstaaten, das UN-Sekretariat mit der notwendigen Autonomie und mit den Ressourcen auszustatten, um die Vielfalt der Aufgaben zu erfüllen«, resümiert Sebastian Graf von Einsiedel, Director am UNU Centre for Policy Research, Tokyo.14
Seit einigen Jahren läuft eine Kampagne für eine Parlamentarische Versammlung bei den UN.15 Ziel: National oder regional entsandte Parlamentarier sollen zumindest eine beratende Stimme bilden. Doch die Chancen dafür sind gering.
Davon abgesehen, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung gar nicht in Ländern lebt, in denen es »echte« Volksvertreter zu entsenden gibt: Auch ein nur verbal agierendes Weltparlament trifft noch auf betonharten Widerstand vieler Regierungen.
Bei jeder annähernd legitimen globalen Bürgervertretung würden sich klare Mehrheiten bilden. In einer Nationenwertung würden China (ca. 19 % der Weltbevölkerung) und Indien (ca. 18 %) dominieren. Insgesamt stellen die aufstrebenden Länder derzeit rund 85 % der Weltbevölkerung. Viele von ihnen wachsen kopfmäßig schneller als der Westen und sind dabei häufig politisch instabiler und unfreiheitlicher. Aus Sicht z.B. der USA mit 4,4 % der Weltbevölkerung und 31,8 % des Weltprivatvermögens sieht damit jegliche repräsentative Struktur wenig erstrebenswert aus.16 Ein direkterer Weg, die UN zu einer wirksam treibenden Kraft der Global Goals auszubauen, umfasst zwei Schritte: 1. Bei der Analyse der UN ist sauber zu trennen zwischen dem Regierungsgesicht und dem von Einzelinteressen unabhängigen Antlitz des UN-Sekretariats mit seinem internationalen Dienst. 2. Es gilt, das Sekretariat in seiner Autonomie entsprechend der UN-Charta zu stärken und mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten. Dies können wir als globale Zivilgesellschaft mithilfe eines UN-Weltkontos leisten. Wenn also im Zusammenhang mit dem Weltkonto von »Globaler Hausverwaltung« die Rede ist, ist das unabhängige UN-Sekretariat mit seinem internationalen Dienst gemeint.
Derzeit bildet sich ein planloses Vakuum, in dem sich repressive Regime ausbreiten. Sie ersetzen die ohne wirkliche globale Kooperation oft schwierigen sachlichen Aufgaben durch die scheinbar leichtere Aufgabe, eine Gesellschaft zu ordnen, die äußeren Feinden trotzt und innere Feinde eliminiert. Um diese Politik zu rechtfertigen, beruft man sich meist auf Angriffe auf die Gesellschaft. Besonders Attentate erhalten so immer wieder die Potenz, unübersehbare Folgeschäden zu legitimieren. Auch die Deutschen haben ihre Erfahrungen damit.