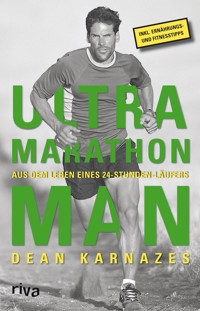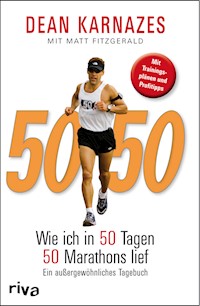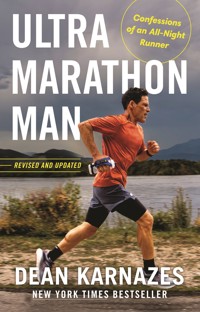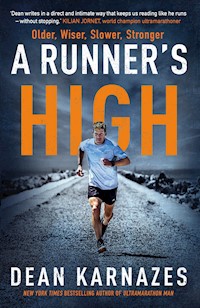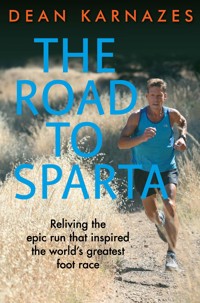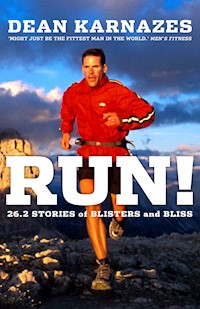Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Egoth Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
New York Times Bestsellerautor und Ultramarathon-Legende Dean Karnazes bringt seinen Körper und Geist an seine Grenzen. Vom Laufen in der schmelzenden Hitze des Death Valley bis hin zur eiskalten Lunge des Südpols. Er ist auf der ganzen Welt Marathons gelaufen, einmal sogar 50 Marathons in 50 Staaten an 50 aufeinanderfolgenden Tagen. In "Mein Leben in Bewegung - Runner's High" zeichnet Karnazes seine außergewöhnlichen Abenteuer auf, die zu seiner Rückkehr zum Western States 100-Mile Endurance Run mit Mitte fünfzig führten, nachdem er vor Jahrzehnten zum ersten Mal daran teilgenommen hat. Die Weststaaten sind berüchtigt für ihr raues Gelände und die extremen Temperaturen, dieser Wettkampf wird für Karnazes einer der anspruchsvollsten seines Lebens. Ein Kampf mit Körper und Emotionen und vor allem um seinem Ziel treu zu bleiben - wir erleben Karnazes wie nie zuvor! Dieses Buch ist gleichzeitig ein Endorphin getriebenes Abenteuer und ein Liebesbrief an den Sport von einem seiner bekanntesten Botschafter, der sowohl Gelegenheits- als auch ernsthafte Läufer zum Jubeln bringen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel der Originalausgabe
A Runner’s High – My Life in Motion
Published by arrangement with HarperOne, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC, 2021
© Dean Karnazes, 2021
Deutsche Erstausgabe
www.egoth.at
1. Auflage, 2019
© egoth Verlag GmbH
Untere Weißgerberstr. 63/12
1030 Wien
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Rechteinhabers.
ISBN: 978-3-903376-31-1
ISBN E-Book: 978-3-903376-32-8
Übersetzung: Dr. Karlheinz Dürr
Lektorat: Dr. Rosemarie Konrad
Coverbild: Dean Karnazes
Umschlag und grafische Gestaltung: DI (FH) Ing. Clemens Toscani
Printed in the EU
Gesamtherstellung:
egoth Verlag GmbH
Untere Weißgerberstr. 63/12
1030 Wien
Österreich
MEIN LEBEN IN BEWEGUNG
DEAN KARNAZES
New York Times Bestsellerautorvon „Ultramarathon Man“
Übersetzt vonDr. Karlheinz Dürr
Widmung
Dieses Buch widme ich meinen Eltern – für die Zeit, die wir zusammen verbrachten, für unsere gemeinsamen Erinnerungen und die Freude, die wir teilten. Es war eine fantastische Reise. Auf immer zusammen.
Inhalt
1:Die Ausdauer schläft nie
2:Zunehmende Schmerzen
3:Warum wir laufen
4:Folge dem Pfad
5:Ich kann und will nicht aufhören!
6:Nachwirkungen
7:Der Seidenstraßen-Ultra
8:Der lange Lauf
9:Vom Kampf gegen Windmühlen
10:Freundschaft und Vaterschaft
11:Verloren in einem weißen Haus
12:Ich habe es getan!
13:Vom Laufen und Wettlaufen
14:Wunden können heilen
15:Zurück an den Start
16:Die Party kann losgehen
17:Die Schrauben lockern sich
18:Der Narr und der Superstar
19:Die Kernschmelze
20:Blackout
21:Reiß dich zusammen!
22:Prophetische Worte
23:Das Licht
Schluss: Die Neue Weltunordnung
Dank
1
Die Ausdauer schläft nie
Einen Ultra zu laufen ist leicht: Du darfst nur einfach nie stehen bleiben.
Ich liege auf dem Rücken, quer über dem Trail, ein Bein schmerzhaft angewinkelt, und starre in den Nachmittagshimmel. Kleine Lichtpunkte flimmern vor meinen Augen wie winzige Glühwürmchen. Was zum Teufel ist gerade passiert? Ein schrilles Klingeln in den Ohren dringt durch die Stille. Ein leichter Staubschleier senkt sich träge auf meinen reglosen Körper herab. Die Gelenke schmerzen, und jeder Atemzug wird zur Qual. Schwindel, Benommenheit und Übelkeit überwältigen mich, als hätte ich einen harten Schlag in die Magengrube bekommen. Ja, was ist da gerade passiert?
Noch vor wenigen Augenblicken war ich harmonisch den Pfad entlanggelaufen, angenehm, kühl, mit voller Kontrolle, Schritt, Sprung, Schritt … und plötzlich war alles anders geworden. Ich erinnere mich dunkel an das schwerelose Aufsteigen, an den Flug, der Schwerkraft trotzig den Mittelfinger zeigend, als die Zeit kurz aussetzte, ich die Flügel ausbreitete – ich flog, war frei …
Dann der Aufschlag. Wumms! Alles explodierte, wie bei einem Fallschirmspringer, dessen Schirm sich nicht öffnete. Jetzt liege ich auf der Erde wie ein lebloser, abgestürzter Ikarus oder wie das vor sich hin rottende Exoskelett eines Käfers und frage mich, was da gerade geschehen sein mochte. Die Fragen laufen vor meinem geistigen Auge wie auf einem Nachrichtenticker vorbei: Habe ich mir etwas gebrochen? Wird mich hier jemand finden? Wo bin ich überhaupt?
Um diese letzte Frage zu beantworten, müssen wir die Zeit um einen Tag zurückdrehen – bis zu dem Augenblick gestern Morgen, als mich plötzlich eine düstere Vorahnung überwältigt hatte: Das sollte ich nicht tun. Das sollte ich WIRKLICH bleiben lassen. Das müsste ich doch längst besser wissen. Dann hatte ich die Haustür hinter mir zugezogen. Und es getan.
Aber wenigstens schien ich den Zeitpunkt meiner Abfahrt gut getimt zu haben. Der ansonsten erbarmungslose Verkehr in der San Francisco Bay Area zeigte sich von seiner freundlicheren Seite, sodass ich sogar auf den am stärksten befahrenen Fahrspuren kaum einmal auf das Bremspedal treten musste. Manchmal braucht man Stunden, um die Stadt zu durchqueren. Wenn es darum geht, einen Menschen schier in den Wahnsinn zu treiben, ist vielleicht keine menschliche Schöpfung besser geeignet als der Straßenverkehr einer Großstadt (mit Ausnahme der Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen in den Flughäfen).
Obwohl es keine Verkehrsstaus gab, brauchte ich fast acht Stunden, bis ich an meinem Zielort ankam, der scheinbar willkürlich in die Landschaft geworfenen Kleinstadt Bishop in Kalifornien. Der Ort liegt am Nordende des Owens Valley und schmiegt sich unter die hohen Gipfel der östlichen Sierra Nevada. Es ist eine Stadt voller Widersprüche: Sie liegt in einer sehr schönen Umgebung, aber es ist eine Landschaft, die nicht nur naturbegeisterte Wanderer anlockt, sondern seltsamerweise auch Biker – wobei die Bikes, auf denen sie durch den Ort knattern, nicht mit Muskelkraft betrieben werden. Die Main Street durchschneidet den Ort und wird von idyllischen Galerien und Geschäften gesäumt, darunter Bergsteiger- und Outdoorläden, ein Mountain Ranger-Besucherzentrum und sogar ein unabhängiger Buchladen. Es sind Geschäfte, die man in jedem touristischen Gebirgsort finden könnte. Und das gilt auch für eine Reihe von Fastfood-Restaurants, für die paar schäbigen Bars, für die Ansammlung von Billighotels und den Kmart-Markt, die zusammengenommen den Charme des Ortes ein wenig beeinträchtigen.
In einer dieser weniger reputierlichen Einrichtungen wollte ich meinen Vater treffen. Leider hatte es in dieser Hinsicht keine große Auswahl gegeben: Es war das einzige noch freie Hotelzimmer in der Stadt gewesen. Die Reservierung hatten wir in letzter Minute gemacht, und ich hatte nehmen müssen, was noch zu haben war. Und wie bei dieser kurzen Vorlaufzeit zu erwarten war, gab es auch nicht viele Optionen, eine Crew für mein Vorhaben zu finden. Trotzdem hatte ich mir den Besten sichern können: meinen guten alten Herrn. Wer sonst wäre wohl bereit gewesen, nach einem zweiminütigen Anruf alles stehen und liegen zu lassen und sechs Stunden aus Südkalifornien hierherzufahren, um mich hier zu treffen? In meinem Leben hat es keinen treueren Gefährten gegeben als meinen Vater.
Mein Dad war ein rüstiger 82-Jähriger, aber so agil wie ein nur locker gebundenes Elektron. Er sprühte praktisch vor Energie, eine ständige Spaltungsreaktion, die ohne Vorwarnung jederzeit explodieren konnte. Er war energiegeladen und charismatisch, aber auch völlig unberechenbar und daher manchmal auch nur schwer zu ertragen. Jedes Zusammensein war mehr oder weniger unvorhersehbar. Und je älter er wurde, desto lebhafter wurde er. Überlautes Gelächter, Angstausbrüche, Melancholie, Freude – die Gefühle konnten bei ihm innerhalb eines einzigen kurzen Zusammenseins von einem Extrem ins andere schwingen. Bei Dad wusste man nie, womit man rechnen musste.
»ULTRAMARATHON MAN!«, röhrte er, als er mich erblickte. (Ich hatte ihn schon tausendmal gebeten, mich nicht so zu nennen, aber es hatte nichts genutzt.) Ein Sportreporter hatte mir diesen Spitznamen verpasst, den ich aber nie besonders gemocht habe. Im Laufe der Jahre hatte der Name gewissermaßen ein Eigenleben angenommen, vor allem bei meinem Dad.1
»Hi, Pops«, sagte ich und umarmte ihn. »Wie war die Fahrt?«
»Kinderspiel.« Er mochte solche Floskeln.
»Dir geht’s also gut?«, fragte ich.
»Ging mir nie besser.«
Dann warte mal bis morgen, dachte ich listig.
Normalerweise machte auch meine Mutter diese abwegigen Eskapaden mit. Die beiden waren praktisch unzertrennlich. Ihre 60-jährige Ehe hatte sie noch enger zusammengeschweißt, zwei altmodische Romantiker, die gemeinsam sämtliche irren Turbulenzen des Lebens durchgestanden hatten. Auch nachdem sie in den Ruhestand getreten waren, taten sie das genaue Gegenteil: Sie befanden sich ständig in Bewegung. Im Laufe der Jahre waren sie praktisch durch ganz Nordamerika getourt, ferner durch Australien und einen großen Teil Europas. Manchmal folgten sie einer spontanen Laune und flogen für einen oder zwei Monate nach Griechenland, ohne Plan oder festgelegten Reiseweg, sogar ohne vorher eine Unterkunft gebucht zu haben. Nur den Mietwagen reservierten sie vorab (wobei Mietfahrzeuge in Griechenland nicht zu den zuverlässigsten zählten). »Es findet sich immer irgendeine Lösung«, sagt meine Mutter immer. Heute war sie nicht dabei, weil sie einen Fünf-Kilometer-Strandlauf mit ihren Kumpels laufen wollte, aber obwohl die meisten ein paar Jahrzehnte jünger waren als sie, konnten sie nicht mit ihr mithalten. Meine Mutter war keine schnelle, aber eine ausdauernde Läuferin. Sie stammt von der griechischen Insel Ikaria – eine der berühmten »Blauen Zonen«, in denen die Eingeborenen überdurchschnittlich häufig 100 Jahre alt werden – und ist praktisch unermüdlich, vor allem bei Outdoor-Aktivitäten. Mom wäre ganz sicher heute dabei gewesen, wenn sie es nicht dem »Jungvolk« zu Hause hätte zeigen müssen.
Die Luft in Bishop ist anders als in San Francisco. In der Bay Area braucht man das Meer gar nicht zu sehen, denn man kann es in der salzigen, dicken Luft ständig riechen. In Bishop dagegen ist die Luft heiß und trocken; ein rauchiger Geruch wie von schwelenden Lagerfeuern hängt ständig über der Stadt. Man spürt die Trockenheit nicht nur in den Augen, sondern bis in die Muskelfasern. Bishop liegt in der kalifornischen Hochwüste, im Windschatten der eindrucksvollen Gebirgskette der Sierra Nevada. Aufziehende Stürme verlieren ihre Feuchtigkeit, wenn sie über Kalifornien heranfegen, und die übrig gebliebenen Regenmengen werfen sie größtenteils an den Westhängen des Gebirges ab. Die Regenmengen, die es über die hoch aufragenden Granitgipfel der Sierra Nevada schaffen, sind extrem gering. Im Durchschnitt verzeichnet Bishop eine jährliche Niederschlagsmenge von ungefähr 127 Litern pro Quadratmeter, und die Luftfeuchtigkeit fällt im Sommer manchmal in den einstelligen Bereich. (Zum Vergleich: Selbst im regenarmen Jahr 2020 betrug die durchschnittliche Niederschlagsmenge in Deutschland 710 l/m2.) Es ist ungefähr so, als würde statt heranziehender Nebelbänke oder Regenwolken ständig ein riesiger Haarföhn blasen …
Obwohl es inzwischen mitten am Nachmittag war, brannte die Sonne erbarmungslos auf mich herab, als ich zur Rezeption ging, um unseren Zimmerschlüssel zu holen. Bis zum offiziellen Sommeranfang waren es noch ein paar Wochen hin, aber das machte hier keinen großen Unterschied: Schon jetzt strahlte der Straßenbelag so viel Hitze ab, dass sie durch die Schuhe drang, die Füße aufheizte und sie anschwellen ließ. Und morgen sollte es sogar noch heißer werden.
Die kleine Klimaanlage in einer Ecke brummte laut vor sich hin, als ich das Zimmer betrat, aber gegen die Hitze konnte sie nicht viel ausrichten. Im Raum war es erstickend heiß, obwohl die Jalousien heruntergelassen waren, so dass völlige Dunkelheit herrschte. Der Gastwirt tupfte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Im Zimmer stank es nach Desinfektionsmittel und Schweißsocken. Ich fragte den Mann, ob es hier eine Eismaschine gebe.
»Gibt es«, antwortete er lakonisch, »aber sie ist kaputt.«
Und kaputt war auch der Lift; wir mussten unser Gepäck zu unserer Bleibe im ersten Stock hinauftragen.
»Das mit dem Hotelzimmer tut mir leid.«
»Das ist okay«, sagte mein Dad tapfer, »völlig okay.«
Im benachbarten Zimmer wohnten zwei voll ausgewachsene Pitbulls. Man hatte mir zwar gesagt, das Hotel sei »haustierfreundlich«, aber zwei erwachsene Pitbulls kamen mir nicht gerade wie kuschelige Schoßhündchen vor. Auch ihre Besitzer machten keinen sonderlich umgänglichen Eindruck. Rauchend standen sie vor dem Gebäude und beäugten uns misstrauisch.
Wir wiederum hatten es eilig, in unser Zimmer zu kommen und die Tür hinter uns zu schließen. Im Raum war es düster und stickig.
»Wir müssen erst mal nach Bettwanzen fahnden«, meckerte ich und stellte unsere Taschen fürs Erste in den Schrank.
Aber als ich die Jalousien hochzog, um ein wenig Licht hereinzulassen, war es, als würde mich der Blick durch das staubbedeckte Fenster auf die Landschaft draußen an einen ganz anderen Ort versetzen, in eine weiträumige Landschaft, die mir zutiefst vertraut war. Die letzten Strahlen der Nachmittagssonne erhellten den Himmel, die zerklüftete Silhouette der Sierra Nevada ragte wie auf einem Ansel Adams-Foto in der Ferne empor, riesige marmorweiße Wolken türmten sich vor einem unglaublich tiefblauen Himmel. Mein ganzes Leben lang komme ich immer wieder hierher, seit Dad und ich zum ersten Mal den Mount Whitney bestiegen hatten – den höchsten Gipfel der zusammenhängenden Vereinigten Staaten. Damals war ich zwölf Jahre alt gewesen. Wir trugen schwere Metallrahmen-Rucksäcke und schliefen in Zelten aus dickem Zelttuch; die Wanderstiefel und Wollsocken ließen wir zum Auslüften vor dem Zelt liegen. Unser gefriergetrocknetes Essen kochten wir auf einem kleinen Campingkocher und rationierten das Wasser in unseren Wasserflaschen, bis wir auf einen Bach stießen, an dem wir sie wieder auffüllen konnten. Auf unseren Tagesmärschen ernährten wir uns von ledrigen Beef Jerkys, Energiesnacks und Studentenfutter. Meine Finger waren bunt von den weich gewordenen Hüllen der halb geschmolzenen M&Ms. Manchmal redeten wir auch miteinander, aber meistens marschierten wir schweigend und ließen uns von der großartigen, gewaltigen Landschaft, dieser wunderbaren Schöpfung der Mutter Natur, in den Bann ziehen. Als wir den Gipfel erreichten, trug ich mich bescheiden in das Gipfelbuch ein und dokumentierte damit, dass ich auf diesem ehrwürdigen Berggipfel gewesen war.
Ich war kein besonders guter Schüler, aber für meinen Aufsatz über diesen Hike mit Dad in der Eastern Sierra bekam ich eine glatte Eins. Es war meine erste Eins überhaupt, deshalb hatte meine Lehrerin meinen Aufsatz mit bunten Smileys verziert. Sie klebten überall am Rand wie kleine Farbtupfer, und ich freute mich unheimlich, als ich die vielen lächelnden Gesichter sah. Ich weiß noch, wie gut ich mich dabei gefühlt hatte.
Ich liebte die Wandertage, ich liebte die Abenteuer. Ich durfte frei herumlaufen, musste mein langes, welliges Haar nicht kämmen. Niemand schrieb mir vor, dies oder jenes zu tun oder zu lassen. Hier draußen war ich Herr über mein Leben, konnte gehen, wohin ich wollte, erkunden, wonach mir der Sinn stand. Wir hatten nicht viel, als ich ein Junge war, wir hatten alles. Wir hatten die östliche Sierra Nevada, die Nationalparks Yosemite und Sequoia waren nicht weit. Wir hatten die San Gabriel und die San Jacinto Mountains. Wir hatten den Joshua Tree National Park und das Death Valley, den Lake Tahoe und die Desolation Wilderness. Wir hatten den Küstenstreifen Big Sur und den Pinnacles National Park, den schönen Ort Mendocino, weiter im Norden die Redwoods, den über 4000 Meter hohen Vulkan Mount Shasta und die Vulkanlandschaft um den Lassen Peak. Wir hatten das wilde, ungezähmte Kalifornien, und in allen Schulferien, ob Frühling oder Sommer, an jedem verlängerten Wochenende packten wir unsere Ausrüstung in unseren mintgrünen Station Wagon, einen Ford Country Squire (den mit den Holzdekorelementen an den Seiten), und machten uns auf den Weg. Den Lebensstil, den das Outside-Magazin propagiert, verkörperten wir schon, bevor es das Magazin überhaupt gab.
Und morgen früh wollte ich mich erneut auf den Weg machen und die alten Erinnerungen wiederaufleben lassen – und neue Erfahrungen hinzufügen. Ich war hierher nach Bishop zurückgekommen, um den Bishop High Sierra Ultramarathon zu laufen, und mein Dad und ich waren wieder beisammen, ein wiedervereinigtes Team. Sicher, wir waren inzwischen ein wenig älter geworden, aber immer noch zusammen. Und machten immer noch weiter.
Die Bishop High Sierra-Läufe werden über fünf Distanzen ausgetragen: zwei »Fun«-Läufe über sechs und 20 Meilen sowie die eigentlichen Ultras über 53 Kilometer, 50 Meilen und 100 Kilometer. Als Ultramarathon gelten im Prinzip alle Läufe, die länger als die klassische Marathondistanz (42,195 Kilometer) sind. Der 100-Kilometer-Lauf auf befestigten Straßen ist die klassische Ultralaufdistanz, aber Landschafts- oder Trailläufe über die vorstehend genannten Distanzen werden immer beliebter. Manche Ultras werden auch als Zeitläufe (zum Beispiel 24 oder 48 Stunden) ausgetragen. Beim Ultramarathonlaufen gibt es nach oben keine Grenze; der Weltrekord im 24-Stunden-Lauf steht derzeit bei unvorstellbaren 303 Kilometern bei den Männern und knapp 260 Kilometern bei den Frauen.2
»Für die 100 Kilometer bin ich nicht fit genug«, erklärte ich Dad.
»Okay. Für welche Distanz hast du dich angemeldet?«
»Für die 100 Kilometer.«
Natürlich, was denn sonst?
»Eigentlich sollte ich das bleiben lassen«, sagte ich. »Ich sollte es besser wissen.«
»Das ist nicht dein erstes Rodeo, Cowboy.«
»Yeah, du hast recht. Ich habe auch früher schon den dümmsten Scheiß gemacht.«
»Komm schon, Ultramarathon Man, du weißt doch genau, worauf du dich einlässt«, sagte er und klopfte mir auf die Schulter.
»Klar weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und genau das macht mir Angst.«
Worauf ich mich einließ, waren 100 Kilometer auf einem schmalen, unbefestigten Pfad – auf und ab, in brütender Hitze über die Berge und durch die Wüste der Hochsierra. Ja, ich wusste ganz genau, womit ich es zu tun bekommen würde. Aber bevor ich auch nur an die Startlinie trat, wartete noch ein weiterer Kampf auf mich.
»Ich stelle den Wecker auf halb vier«, sagte Dad.
»Halb vier? Warum so früh? Der Lauf startet doch erst um halb sechs?«
»Du willst doch nicht zu spät kommen, oder?«
»Dad, es sind nur fünf Minuten mit dem Auto.«
»Du brauchst Zeit zum Aufwärmen.«
»Aufwärmen? Ich habe 100 Kilometer zum Aufwärmen.«
»Und wenn wir in einen Stau geraten?«
»Dad. Wir sind hier in Bishop, 3760 Einwohner. Staus gibt’s hier nur bei einem Erdbeben.«
»Und wenn es ein Erdbeben gibt?«
»Verdammt, Dad! Du kannst einen wirklich fertigmachen!«
Sich mit Dad zu streiten konnte anstrengender sein als ein Ultramarathon. Pünktlichkeit war eine seiner Eigenschaften, die er verbissen verteidigte. Meiner Meinung nach treibt er es dabei zu weit. Wenn er beispielsweise einen Termin hat – sagen wir mal, für die jährliche Hauptuntersuchung seines alten Fords –, bestand er darauf, mindestens eine Stunde zu früh dort zu sein, um ganz sicherzugehen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wenn ich mir eine Stunde Zeit vertreiben müsste, könnte ich mir interessantere Tätigkeiten vorstellen, als vor der Kfz-Prüfstation herumzuhängen. Aber es war sinnlos, mit diesem Mann darüber zu streiten.
»Okay, Dad, dann stelle halt den Wecker auf halb vier.«
»Gut. Wie wär’s mit einem Kaffee?«
Wir betrachteten die billige Kaffeemaschine, mit der das Zimmer ausgestattet war. Daneben standen zwei Styroporbecher, die üblichen Instantkaffee-Sticks und die winzigen rosa Päckchen Süßstoff. Köstlich.
»Siehst du hier irgendwo eine Steckdose?«, wollte Dad wissen.
Ich schaute hinter das Nachttischchen, das unsere beiden Betten trennte.
»Ja, hier hinten ist eine.«
»Steckst du das mal rein, bitte?« Er reichte mir das Verlängerungskabel seines CPAP-Schlaftherapiegeräts.
»Du willst doch nicht etwa mit diesem Ding schlafen?«
»Mein Arzt sagt, ich soll es jede Nacht benutzen.«
CPAP ist die Abkürzung für Continuous Positive Airway Pressure – das Gerät ist durch einen Schlauch mit einer Kopfmaske verbunden und soll für eine bessere, gleichmäßige nächtliche Atmung sorgen. Im Gerät befindet sich ein kleiner Wasserbehälter, um dem Luftstrom Feuchtigkeit beizufügen. Mit der Maske sieht Dad wie Hannibal Lecter aus und klingt wie ein Tiefseetaucher. Dieses gleichmäßige gurgelnde Geräusch wird mich sanft durch die Nacht begleiten, wie das Wellenplätschern der Gezeiten am Strand. Ich könnte genauso gut auf einem Bootssteg pennen.
Dass dann um halb vier morgens der Wecker klingelte, machte auch keinen großen Unterschied mehr. Ich hatte sowieso kaum schlafen können, dafür hatte das ständige Schnorcheln des Tiefseetauchers neben mir gesorgt. Aber das war okay – die Ausdauer schläft nie.
Im Bad spritzte ich mir ein wenig Wasser ins Gesicht und betrachtete im Licht der gelben Lampe mein Spiegelbild. Ich sollte das nicht machen, dachte ich. Ich bin nicht fit genug, habe nicht genug trainiert. Ich sollte es doch wirklich besser wissen. Dann fuhr ich mir mit den Fingern durch die Haare. Bringen wir’s hinter uns.
Es war noch nicht viel los, als wir in der Startzone ankamen – ein großer, offener Park mit einem See in der Mitte, auf dessen gekräuselter Oberfläche sich der Mond spiegelte. Der Morgen dämmerte herauf, und langsam versammelten sich die Läufer. Alle Läufe wurden gleichzeitig gestartet – 20 Meilen, 53 Kilometer, 50 Meilen, 100 Kilometer –, und immer mehr Läufer trafen ein. In der Menge entdeckte ich ein paar bekannte Gesichter, darunter auch Billy Yang.
»Karno! Wie läuft’s, Bruder?«
»Hey, Billy, schön, dich zu sehen.«
»Du bist der Grund, warum ich hier bin, Kumpel. Vergiss das bloß nie.«
»Bin froh, dass wir trotzdem Freunde geblieben sind.«
Er lachte. Billy rechnet mich zu den Leuten, die ihn zum Ultramarathon gebracht hatten. Er hatte eines meiner früheren Bücher gelesen und beschlossen, es selbst einmal zu versuchen. In der Menge war er eines der frischen neuen Gesichter, und ich freute mich, dass er dabei war.
»Läufst du die 100K?«, fragte ich.
»Auf keinen Fall, Kumpel. Nur die 50K. Ich hab kaum trainiert. Ich weiß, was ich mir zumuten darf.«
Puh! Dass jemand, der viel weniger Erfahrung besaß als ich, irgendwie schlauer sein könnte, ließ bei mir die stürmische innere Debatte erneut aufflammen. Immer größere Stücke abzuschneiden, als ich verdauen konnte, und mich kopfüber in viel zu gefährliche Gewässer zu stürzen, war für mich eine Art Leitmelodie und gehörte gewissermaßen zum Quellcode meiner Existenz. Durchaus denkbar, dass ich mich unbewusst von allem anlocken ließ, das gründlich schiefgehen konnte. Schauen Sie, mein Leben verläuft normalerweise so wenig aufregend wie das der meisten anderen Menschen. Die heutige Lebensweise ist so leicht vorhersehbar, so alltäglich, so, na ja, langweilig – aber das hier, das war etwas anderes. Bei einem Ultramarathon weiß man nie mit Sicherheit, was dabei herauskommt, und wenn etwas schiefläuft, fällt buchstäblich alles auseinander. Andererseits kann dir ein Ultramarathon nach einer schlecht gelaufenen Arbeitswoche im Büro einen noch nie erlebten Höhepunkt bescheren. Und das war das Gefühl, für das ich lebte.
Der Cheforganisator des Laufturniers trat vor die Läufergruppe und hielt eine kurze Ansprache. Er ermahnte uns, genug Flüssigkeit zu uns zu nehmen, da der heutige Tag heiß und trocken werden würde. Eindringlich wies er uns auf die Wegmarkierungen hin, damit wir uns nicht verliefen. Und zum Schluss ermahnte er uns noch einmal, genug zu trinken.
181 Läuferinnen und Läufer gingen an den Start. Die alten Hasen klagen oft, die heutige Ultralaufszene wachse ungehemmt immer weiter und werde allmählich zu nichts weiter als einem populären Mainstream-Event. Damit gerate der Sport außer Kontrolle, jammern sie. Für den New York City Marathon im vergangenen Jahr beispielsweise hatten sich mehr als 55.000 Läufer angemeldet. Dagegen ist meiner Meinung nach im Ultramarathonsport noch ein wenig Raum für weiteres Wachstum, aber damit will ich mich nicht auf die eine oder andere Seite des Streits stellen, denn ich kann beide Argumente nachvollziehen. Als ich mit diesem verrückten Sport anfing, galten 50 Teilnehmer als gut besetztes Feld bei einem Lauf. Heutzutage sind die Ultramarathon-Events oft ausgebucht; manchmal werden die Plätze sogar verlost. Für Puristen mag das an Ketzerei grenzen.
Ich ging noch einmal zum Rand des Startbereichs hinüber, wo Dad stand, um mich von ihm zu verabschieden.
»Halt dir immer die Nase frei, Junge«, riet er mir.
Diesen Ratschlag hatte er mir fast mein ganzes Leben lang erteilt. Bis heute habe ich keine Ahnung, was genau er damit meinte.
»Danke, Pops. Mach ich.«
Der Countdown begann. »… vier, drei …« Ich bekreuzigte mich. »Zwei, eins …« Dann krachte der Startschuss, und die Meute setzte sich in Bewegung. Die heilige Messe hatte begonnen.
Ich verschaffte mir eine gute Position in der Mitte der führenden Gruppe und fixierte den Blick auf ein Paar muskulöse Waden direkt vor mir, deren Besitzer in enger Formation mit einem Cluster anderer Läufer ziemlich nahe am Spitzenfeld lief. Das Gelände war zunächst relativ flach und gepflegt, so dass das Lauftempo anfangs ein bisschen zu hastig war; wahrscheinlich wirkte der Adrenalinschub vom Start bei mir wie auch bei den meisten anderen Läufern noch nach. Eine Staubwolke wirbelte in der stillen Morgenluft auf, als raste eine Gnu-Stampede in Panik über die Savanne.
Das blieb allerdings nur für die ersten fünf Meilen so. Danach stieg das Gelände viel steiler an, so dass es immer schwieriger und schließlich sogar unmöglich wurde, die hohe Schrittfrequenz beizubehalten. Meine Lungen arbeiteten jetzt mit voller Kapazität, konnten aber dennoch nicht mehr genug Sauerstoff liefern, um meine Beine weiter in diesem Tempo voranzutreiben. Daher wurde ich langsamer. Über die nächsten 15 Meilen (24 Kilometer) sollte die Strecke ungefähr 1500 Meter Höhe gewinnen. Um das in eine bessere Perspektive zu bringen: Der berüchtigte Heartbreak Hill beim Boston Marathon steigt gerade mal um 27 Meter an. Ein Ultramarathon ist also ein ganz anderes Monster.
Und Ultramarathonläufer sind eine ganz eigene Spezies. Statt nach flachen, schnellen Laufstrecken suchen wir nach den gebirgigsten und solchen, die uns die größte Herausforderung bieten. Auf die Geschwindigkeit kommt es an, aber auch die An- und Abstiege eines bestimmten Rennens sind für uns gleichermaßen wichtige Faktoren. Der legendäre Hardrock Hundred Mile Endurance Run beispielsweise weist auf seiner 161,7 Kilometer langen Strecke 10.300 Meter An- und Abstiege auf, die sich auf insgesamt 20.600 Höhenmeter summieren. Das entspricht einem Lauf von Meereshöhe auf den Gipfel des Mount Everest und wieder zurück, plus Aufwärmen und Abkühlen.
Ultraläufer pflegen auch ihren ganz eigenen Dresscode (oder halten sich an gar keinen). Es ist völlig normal, Laufklamotten zu tragen, deren Farben nicht zueinander passen; grellbunte Crew-Socken, neonfarbene Ärmel, flippige Truckermützen, Retro-Sonnenbrillen – nichts ist zu ausgefallen und spleenig. Das gilt auch für die Tätowierungen, Haarfarben, Piercings und Bärte, die man überall zu sehen bekommt. Wer den Mut und die Disziplin für einen Ultramarathonlauf aufbringt, kann meiner Meinung nach tragen, was ihm oder ihr gefällt.
Beim 15-Meilen-Marker fühlte ich mich leichtfüßig und gelenkig. Bei 20 Meilen verspürte ich leichten Schwindel und hörte ein leises Klingeln in den Ohren. Dieses Gefühl und seine Ursachen kannte ich. Bis vor 24 Stunden hatte ich noch an der Meeresküste gewohnt und in der dicksten Luft geschlafen, die es gibt. Jetzt lief ich auf einer Höhe von 2800 Metern in dünner Luft. Und diese Höhe begann nun zu wirken.
Als ich in der Overlook-Versorgungsstation stand, um mich wieder ein wenig zu erholen, kamen zwei weitere Läufer an, ein Mann und eine Frau. Wir nickten uns nur flüchtig zu, dann wühlten wir uns durch das Nahrungsangebot, das auf dem kleinen Campingtisch ausgebreitet war.
»Wie fühlst du dich?«, fragte mich der Mann.
Er sah noch sehr jugendlich aus und wirkte so solide wie eine Eiche. Die Frau sah genauso durchtrainiert aus wie er.
»Ein bisschen schwindelig, um ehrlich zu sein. Und ihr beide?«
Er grinste verlegen. »Wir wohnen am Lake Tahoe.«
Das war keine direkte Antwort auf meine Frage, aber mir war dennoch klar, was er damit sagen wollte: Der Lake Tahoe liegt knapp 1900 Meter über dem Meeresspiegel; die beiden Läufer lebten also auf großer Höhe und kamen daher hier sehr gut zurecht. Der bisherige Anstieg war für sie ungefähr so leicht, als würden sie zum Briefkasten am Ende ihrer Zufahrt gehen, um die Zeitung zu holen. Und schon liefen sie weiter. Ich schloss meine Wasserflasche und lief ihnen hinterher.
Die Laufstrecke war bisher größtenteils einer steinigen, unbefestigten Jeeppiste gefolgt, doch jetzt schlängelte sie sich mit einer Serie von breiten Spitzkehren und wellenartigen Anstiegen und Gefällen durch das Vegetationsgestrüpp der Hochwüste. Inzwischen hatten sich die 20-Meiler und die 50K-Läufer von den 50-Meilern und 100K-Läufern getrennt und befanden sich bereits wieder auf dem Rückweg, während wir anderen noch viele Meilen vor uns hatten. Nach der Trennung von den beiden anderen Gruppen war die Zahl der Läufer deutlich geringer geworden, und ich lief nun meistens völlig allein, ohne eine andere Menschenseele in Sichtweite.
Hatten bis zu einer bestimmten Höhe noch einzelne Kiefern gestanden, so gab es jetzt auf der Strecke absolut keinen Schatten mehr. Ich hatte mich entschieden, eine Wasserflasche in der Hand zu tragen, um nicht eine größere Trinkblase mitschleppen zu müssen. Das war eine strategische Entscheidung gewesen: In einem leicht ausgelaugten Zustand zu laufen gehörte zu meinem Masterplan, um besser mit meinem unzureichenden Training zurechtzukommen.
Denn eins war mir klar: dass ich meine Fitness stark verbessern musste. Das hatte mit den Neuigkeiten zu tun, die ich kürzlich erfahren hatte. Sicher, es waren gute Nachrichten, aber sie waren auch ein wenig besorgniserregend. Besorgniserregend insofern, als sie sofortiges Handeln erforderten. Das war der Grund meiner überstürzten Anmeldung für den harten Bishop 100K-Ultra, der schnellen Fahrt hierher und der Entscheidung, nur eine Handwasserflasche mitzunehmen (noch dazu eine nicht isolierte Flasche). Das sollte ich eigentlich nicht tun, aber ich tat es trotzdem.
Und ich machte damit auch weiter. Ich lief am 20-Meilen-Marker vorbei. 23 Meilen. 26 Meilen. Einen Ultra zu laufen ist einfach; man darf nur nicht stehen bleiben.
Am Bishop Creek traf ich zum ersten Mal seit dem Start wieder mit Dad zusammen. Das war Meile 29; die Sonne war längst aufgegangen und brannte vom Himmel. Die Tätigkeit als Crew eines Marathonläufers lässt sich am besten als ständiges Vorausfahren beschreiben – von einem Treffpunkt zum nächsten, wo man dann nur herumsitzt und wartet. Manche Leute kommen damit gut zurecht, andere weniger. Dad war darin extrem geschickt. Er freundete sich spontan mit allen an, wo auch immer er sich befand. Ich erinnere mich, wie einmal ein Telefonverkäufer bei uns zu Hause anrief und meinem Vater eine Lebensversicherung andrehen wollte. Dad kehrte das Verkaufsgespräch völlig um und schaffte es schließlich, dem Burschen unser altes Auto zu verkaufen. Der Mann schrieb Dad sogar einen Dankesbrief. Mein Vater war einfach ein einnehmender und sympathischer Mensch.
Habe ich schon das Wort »pünktlich« erwähnt? Ja, habe ich. Auch hier an der Bishop Creek-Station fand ich den Beweis dafür: Er hatte stundenlang gewartet, sich mit allen möglichen Leuten unterhalten und angefreundet und versucht, so gut wie möglich im Schatten zu bleiben. Aber selbst im Schatten herrschte eine Bruthitze. Trotzdem hatte er einen Campingstuhl aufgestellt und meine gesamte Ausrüstung auf einem großen Strandtuch ausgebreitet, damit ich sofort auf alles zugreifen konnte.
»Hey, Pops«, sagte ich, als ich an der Station ankam. »Verdammt heiß.«
»Könnte schlimmer sein. Was brauchst du?«
»Eine Klimaanlage wäre nicht schlecht.«
Er nahm den Hut ab und fächelte mir Luft zu.
Dad würde alles für seine Familie tun. Er beklagte sich nie und schreckte vor keiner Forderung zurück. Er war immer da, immer einsatzbereit. Als ich heranwuchs, kam er zu all meinen Spielen, obwohl ich nicht behaupten will, dass mir seine Anwesenheit immer angenehm war. Die Väter mancher meiner Freunde kamen nie, um ihre Söhne anzufeuern. Damals begriff ich nicht, wie groß Dads Loyalität war. Heute verstehe ich es. Die Familie ist wichtig; sie ist sogar wichtiger als alles andere.
»Sag mal, Pops, hast du auch den Ingwer mitgebracht?«
Ingwer ist das Wundermittel bei Darmproblemen, ein bei Langstreckenläufern häufig auftretendes Leiden, vor allem bei höheren Temperaturen. Viele Ultramarathonläufer kauen auf kandierten Ingwerstäbchen herum. Ich bevorzugte mein Tonikum pur.
Dad reichte mir eine Plastikbox mit frisch geschnittenem Ingwer. Ich schob mir eine Scheibe in den Mund und verspürte sogleich das vertraute scharfe Brennen. Ich rate Ihnen, es mal zu Hause auszuprobieren – aber über dem Waschbecken. Die wenigsten Menschen halten es aus. Kandierter Ingwer ist würzig und süß; natürlicher Ingwer wirkt so, als würde man sich Feuerwerkskracher in den Mund stecken.
Ich verzog stöhnend das Gesicht.
Pops schüttelte besorgt den Kopf. »Ich weiß nicht, wie du das Zeug aushältst.«
»Funktioniert doch, oder nicht?«
Er zuckte die Schultern und schaute mich zweifelnd an.
Wir füllten die Wasserflasche auf, und ich rieb mir noch ein wenig Sonnencreme auf den Nacken. Gerade als ich wieder loslaufen wollte, kam ein weiterer Läufer an. Er sah jung und athletisch aus. Als er mich entdeckte, zuckte er förmlich zusammen. War er auf einen Wettkampf aus? Würde er mich sozusagen zum Angriffsziel machen?
An diesem Punkt des Laufs wusste man nie genau, auf welcher Position man lief. Bei den wenigen Läufern, die ich unterwegs gelegentlich zu sehen bekam, war nie völlig klar, ob sie 50 Meilen oder 100K liefen; beide Läufe gingen über denselben Pfad. Inzwischen hatte sich das Feld stark gelichtet, und es gab nicht mehr viele Läuferinnen oder Läufer, die man überholte oder von denen man selbst überholt wurde. Alle hatten ihre Positionen mehr oder weniger etabliert und behielten sie bei. Und so hilfreich die freiwilligen Helfer auch waren, über den aktuellen Stand des Laufs konnten sie den Läufern nicht viel berichten.
Ich war nie in erster Linie ein Wettläufer gewesen. Zwar genieße ich den Thrill und das Drama, die ein Laufwettkampf mit sich bringt, aber ich lebe nicht nur dafür. Für mich ist das Laufen ein großartiges Abenteuer, äußerlich eine oftmals waghalsige Erkundung der Landschaft, innerlich eine Reise zu mir selbst. Diese beiden Erfahrungen sind es, die mich antreiben, die Lust am Erkunden und die Suche nach einem tieferen Verständnis, wer ich bin und aus welchem Holz ich geschnitzt bin. In meinem gesamten Leben als Langstreckenläufer gab es nur ein einziges Rennen, das ich von Anfang an gewinnen wollte: den Badwater Ultramarathon von 2004 (ich hatte das Glück, ihn dann tatsächlich zu gewinnen). Von diesem Lauf abgesehen, waren das Laufen und die Laufwettkämpfe für mich immer Erfahrungsreisen gewesen, ohne das drängende Verlangen, ein Rennen unbedingt auf dem Siegertreppchen beenden zu wollen.
Aber wenn man von einem anderen Läufer gejagt wird, will man sich dennoch nicht von ihm überholen lassen. Als ich nach der kurzen Zwischenpause weiterlief, steigerte ich deshalb mein Lauftempo ein wenig, um nicht eingeholt zu werden. Die nächsten paar Meilen bis zur Intake-Verpflegungsstation lief ich recht aggressiv, vielleicht zu aggressiv. Es war ohnehin nur eine kurze Distanz – jedenfalls war das die Begründung für meine Unbesonnenheit (aber natürlich auch der Wunsch, mich nicht überholen zu lassen). Doch als ich an der Intake-Station ankam – 32 Meilen beziehungsweise 51 Kilometer vom Start –, bekam ich sofort die Folgen zu spüren. Ich hatte gerade erst die Hälfte des 100K-Laufs hinter mich gebracht, fühlte mich aber fast am Ende. Das warme, halb gare Gefühl der Befriedigung, das ich normalerweise empfand, wenn ich die Hälfte hinter mir hatte, stellte sich nicht ein; vielmehr fühlte ich mich ausgedörrt und ausgelaugt. Nicht warm, sondern heiß. Unerträglich heiß. Glühend heiß. Ich war erledigt, obwohl ich noch einen langen Lauf vor mir hatte.
»Dad, wer hat diesen Brutofen noch mehr angeheizt?«
Er bedachte mich mit einem Blick, der nur eins sagte: Du glaubst, es sei heiß beim Laufen? Wenn du wüsstest, wie es ist, stundenlang an den Hilfsstationen abzuhängen … Sämtliche Helfer sahen geschafft aus. Es gab nur einen kleinen Sonnenschirm, der über dem Verpflegungstisch aufgespannt war, und alle drängelten sich in den winzigen Schattenfleck, den er bot.
Ursprünglich hatte ich geplant, mich an dieser Versorgungsstation ein wenig zu erholen und wieder zu Sinnen zu kommen, denn ich fühlte mich tatsächlich ein wenig irre. Aber mir wurde sofort klar, dass das hier nicht der richtige Ort dafür war. Deshalb änderte sich meine Mission: Hatte ich zuvor zu dieser Station kommen wollen, so konzentrierte ich mich jetzt darauf, so schnell wie möglich von ihr wegzukommen, sowohl im meinem eigenen Interesse als auch für meinen Vater. Wir füllten nur schnell meine Wasserflasche auf, ich griff mir noch einen Erdnussbutterriegel, dann lief ich auch schon wieder los … im selben Moment, als der jüngere Läufer an der Station ankam.
Der Abstand zwischen uns hatte sich verringert.
1Siehe Dean Karnazes: Ultramarathon Man, München 2018.
2https://www.leichtathletik.de/laufen/ultramarathon (4.11.2021). Die Internationale Ultramarathon Association IAU richtet Welt- und Kontinentalmeisterschaften in den Disziplinen 50- und 100-Kilometer-, 24 Stunden- und Ultratraillauf aus.
2
Zunehmende Schmerzen
Du kennst deine Grenzen erst, wenn du sie überschreitest.
So, wie sich meine »Karriere« als Ultramarathonläufer immer weiterentwickelte, breitete sich auch der Sport selbst immer weiter aus. Inzwischen ist der Ultramarathonlauf zu einem Mainstream-Sport geworden, und selbst in den Nachrichten hört oder sieht man heutzutage immer häufiger Berichte über den Sport im Allgemeinen oder kann in den Zeitungen etwas über diesen oder jenen Ultramarathonlauf lesen. Mit der zunehmenden Bekanntheit des Sports nahm auch die Zahl der Teilnehmenden zu. Als ich 1993 meinen ersten Ultra lief, war ich einer von nur 3754 Läufern in ganz Nordamerika, die jemals das Ziel erreicht hatten. Bis 2019 war die Zahl der Ultramarathon-Finisher auf 127.296 angeschwollen. Und in manchen anderen Ländern war das Wachstum sogar noch größer gewesen. Einem Bericht der International Association of Ultrarunners (IAU) zufolge hat die Zahl der Ultrarunner in den vergangenen 23 Jahren weltweit um 1676 Prozent zugenommen. Zu beachten ist, dass ihre absolute Zahl zwar immer noch relativ gering ist,3 aber wenn sich immer größere Teilnehmergruppen auf schmalen, unbefestigten Pfaden durch die Wildnis drängeln, sind Probleme unvermeidlich. Der Sport beginnt darunter zu leiden, und die etablierteren und legendären Ultramarathons führen inzwischen Lotteriesysteme durch, um den Zugang zu regeln. Die Chancen, zum Großvater all dieser Events, dem berühmten Western States 100-Mile Endurance Run, zugelassen zu werden, sind heute geringer, als einen Studienplatz in Harvard zu bekommen.
Der Western States war mein erster 100-Meiler und wird in meinem Herzen immer mein Lieblingslauf bleiben. Zum ersten Mal lief ich ihn 1994. Dass ich schon beim ersten Versuch zugelassen wurde, war keine große Überraschung, denn die Chancen bei der Auslosung standen damals noch 50:50. Seither bin ich den Western States mehr als zehn Mal in weniger als 24 Stunden gelaufen und erhielt dafür die begehrte Auszeichnung, den »1000 Miles, Ten Days Buckle«. Heutzutage ist diese Medaille (eigentlich handelt es sich um eine Gürtelschnalle) fast unschätzbar wertvoll, aber nicht, weil es nicht viele andere Läuferinnen und Läufer geschafft haben, sondern weil es inzwischen fast unmöglich ist, sich zehnmal einen Startplatz für den Western States zu sichern.
Ich habe seit Jahren nicht mehr am Western States teilgenommen. Nicht weil ich irgendwie ausgebrannt gewesen wäre, sondern weil der frühere Zauber nachgelassen hat. Die Rennstrecke war bekanntes Territorium – nicht fad, aber ausgetreten. Ich hatte mir inzwischen so viele Silver Buckles erlaufen – die Auszeichnung für Laufzeiten unter 24 Stunden –, dass es für mich nur noch wenig Neues zu entdecken gab. Außerdem hatte mein letzter Versuch, den Western States 100 zu laufen, leider mit einem DNF geendet.4 In Hunderten Läufen über mehrere Jahrzehnte hinweg war ich nur wenige Male aus einem Rennen ausgestiegen; der Western States 2009 war eines davon. Sicher, mein Körper war während dieses Laufs ausgebrannt, aber das war auch schon bei anderen Läufen der Fall gewesen und ich war trotzdem weitergelaufen. Tief im Herzen hatte etwas gefehlt; mein Kampfgeist war gebrochen.
Doch das Herz kann launisch sein. Alte, fast erstickte Flammen können auf mysteriöse Weise wieder auflodern. Und nachdem sie für den Western States-Lauf über ein Jahrzehnt verkümmert gewesen waren, entzündete sich jetzt plötzlich wieder ein inneres Feuer. Ich wollte den Western States Endurance Run noch einmal laufen.
Doch ich muss ehrlich zugeben: Der Gedanke an die Rückkehr machte mir Angst. Der Fehlschlag von 2009 hatte meinem Selbstvertrauen einen mächtigen Schlag versetzt; dieses DNF verfolgt mich bis zum heutigen Tag. Und doch wollte ich – nein: ich brauchte – eine Wiedergutmachung.
Ich bewarb mich für die Teilnahme am 2018er-Lauf. Jetzt musste ich nur noch das Losverfahren gewinnen. Das war nicht der Fall, aber das war nicht weiter erstaunlich. Schließlich sind die Chancen, wie schon erwähnt, inzwischen verschwindend gering. Allerdings schied ich nicht völlig aus dem Verfahren aus, sondern wurde auf die »Warteliste« gesetzt (das bedeutete, dass eine der 50 Personen auf der Liste zugelassen würde, sollte einer der Losgewinner auf die Teilnahme verzichten). Ich stand auf dem Listenplatz 23, was nicht sonderlich ermutigend war. Aber Rücktritte vom Western States waren durchaus denkbar. Zum Beispiel, wenn ein Teilnehmer von Aliens entführt wird. Oder wenn sich plötzlich ein riesiger Krater auftut und einen Teilnehmer verschlingt. Oder wenn bei einem Losgewinner eine spontane Selbstentzündung auftritt. Was ich mit diesen absurden Beispielen sagen will: Gott müsste schon höchstpersönlich eingreifen, um jemanden, der zu einem Western States 100 zugelassen war, zum Rücktritt zu bewegen. Mit Rang 23 auf der Warteliste hatte ich daher praktisch null Chance.
Allerdings muss man es den Western States-Organisatoren zugutehalten, dass sie sich größte Mühe geben, die Lotterie so fair wie möglich zu gestalten. Gewinnt eine Läuferin oder ein Läufer kein Startlos, verbessern sich ihre oder seine Chancen mit jedem weiteren Jahr. Das erreicht man, indem man ihnen ein Extralos zuteilt. Im Dezember, wenn die große Lotterie durchgeführt wird, werden alle Lose in einen »Hut« gelegt (tatsächlich handelt es sich um eine große Lostrommel) und die Siegerlose von willkürlich ausgewählten Personen aus dem Publikum gezogen. Für das Rennen von 2018 befanden sich 15.074 Tickets in der Trommel – für 369 verfügbare Startplätze. Die Chancen sind daher verschwindend gering. Auch die Zahl der Startplätze sieht doch reichlich willkürlich aus, nicht wahr? Warum ausgerechnet 369?
Die Erklärung macht zugleich die Schwierigkeiten deutlich, vor denen die Veranstalter eines Ultramarathons stehen. 1984 hatte der Kongress den California Wilderness Act verabschiedet, ein Gesetz, durch das die Granite Chief Wilderness Area als neues Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Der Western States Trail verläuft durch dieses Gebiet. Organisierte Sportereignisse dürfen seit dem Inkrafttreten des Gesetzes in der Granite Chief Wilderness Area nicht mehr durchgeführt werden – normalerweise. Aber den Western States gab es schon länger als den Wilderness Act, er hatte gewissermaßen Bestandsschutz und wurde daher explizit von der Neuregelung ausgenommen – allerdings mit der Maßgabe, dass in Zukunft nicht mehr Läufer daran teilnehmen dürften, als vor der Verabschiedung des Gesetzes zuletzt an den Start gegangen waren. 1984 waren das zufällig 369 Läuferinnen und Läufer gewesen. Und das gilt seither als magische Zahl für diesen Lauf.
Mit über 15.000 Losen in der Trommel gehörte daher schon unglaublich großes Glück dazu, auch nur auf die Warteliste gesetzt zu werden. Obwohl das eigentlich keine große Rolle spielte: Niemand würde vor dem Start des Rennens einen Rückzieher machen, nicht nach all der Mühe, die die Zulassung gekostet hatte. Deshalb gab ich meinen Versuch auf, beim Western States starten zu können, und tröstete mich damit, dass ich es gegen alle Wahrscheinlichkeit beinahe geschafft hätte. Beinahe.
Doch dann erhielt ich eine überraschende E-Mail. Man machte mich darauf aufmerksam, dass ich auf der Warteliste nach oben gerückt sei. Richtig – bis zur ersten Aprilwoche hatten fünf Leute ihre Teilnahme abgesagt, weshalb ich auf der Warteliste von Nr. 23 auf Nr. 18 vorgerückt war. Fünf Leute hatten sich in den fünf Monaten seit der Verlosung zurückgezogen, im Durchschnitt also eine Person pro Monat. Der Lauf sollte im Juni stattfinden; bis dahin waren es noch ungefähr zwei Monate. Wenn weitere zwei Leute ihre Teilnahme absagten, würde ich folglich auf Rang 16 vorrücken, aber immer noch weit von der Startlinie entfernt sein.
Doch irgendwo im Hinterkopf regte sich der Gedanke, dass ich vielleicht doch vorsichtshalber mit dem Training anfangen sollte. Meine innere Stimme der Vernunft argumentierte, dass das wahrscheinlich nichts nutzen würde. Schließlich gab es sinnvollere Möglichkeiten, mir die Zeit zu vertreiben.
Bei dieser Sache wurde mir jedoch eine wertvolle Lehre erteilt: Höre nie auf deine Vernunft. Als der Western States nur noch drei Wochen entfernt war, hatten insgesamt 16 Personen ihre Teilnahme abgesagt. Und ich war auf der Warteliste auf Platz sieben vorgerückt. Scheiße – vielleicht komme ich am Ende doch noch an den Start! Drei Wochen Training sind nicht sehr viel. Meine Lösung war: Melde dich für einen harten 100K an und fahre nach Bishop. Wir Läufer lassen uns eben doch immer von unseren Trieben leiten, nicht wahr? Na ja …
Und wir denken auch unlogisch (oder jedenfalls trifft das für diesen Läufer hier zu). Einen 100K mit nur einem Mindestmaß an Base Training laufen zu wollen, war ungefähr so, als würde man mit George Foreman in den Ring steigen und auf ein Wunder hoffen. Ja, sicher, Wunder können geschehen. Schließlich schien es inzwischen sogar vorstellbar, dass ich beim Western States an den Start gehen könnte.
Das war der Grund, warum ich jetzt in Bishop war und den Bishop High Sierra 100K lief. Sollte sich das Wunder tatsächlich ereignen und ich für den Western States zugelassen werden, brauchte ich dringend ein wenig mehr Laufleistung auf dem Tacho. Aber schon bald, nachdem ich die Intake-Versorgungsstation an Meile 32 hinter mir gelassen hatte, ging mir gewissermaßen der Sprit aus. Sowohl Geist als auch Körper begannen immer deutlicher unter der großen Anstrengung zu leiden, ein solches Rennen in einem derart untertrainierten Zustand zu laufen. Ich war angeschlagen, daran gab es nichts mehr zu deuteln. Und wurde außerdem von irgendeinem jungen Punker gejagt. Das durfte mir nicht passieren. Ich wollte es nicht hinnehmen, weil hier mehr auf dem Spiel stand als nur ein Laufergebnis. Etwas, das viel tiefer ging.
Die Strecke stieg mit einer Serie von Serpentinen über einen hohen Bergkamm und fiel danach in ein langes, schmales Tal ab. Es gab keinerlei Schutz vor der Sonne; der Trail war staubtrocken, so dass meine Schuhe einen feinen Puderstaub aufwirbelten, der träge ein paar Handbreit über dem Boden hing. Damit ließ ich eine Staubspur hinter mir zurück; jeder, der mir folgte, würde an dieser pudrigen Wolke, die sich nur langsam absenkte, ablesen können, dass ich erst vor Kurzem hier gelaufen war. Und ich wusste, dass jemand hinter mir lief, ich wusste nur nicht, wie weit hinter mir er sich befand.
Obwohl die Hitze zwischen den Talhängen noch drückender war, verlief der Abstieg durch die Schlucht größtenteils geradlinig und angenehm, und der kalkige Boden unter den Füßen war nachgiebig. Im Jargon der Ultramarathonläufer konnte man diesen Streckenabschnitt als »laufbar« bezeichnen (das Gegenteil ist »unlaufbar«), und ich konnte mich gut halten. Zwar würde ich nicht behaupten, dass ich den Abschnitt hinunterflog, aber ich behielt ein stetes Tempo bei und konnte ein paar leichtere Meilen abhaken. Allerdings darf man nicht vergessen, dass der Trail hier sehr gnädig war, weshalb mir dieser Abschnitt nicht sehr schwerfiel.
Leider durften wir das Tal nicht bis zum Ende durchlaufen. Vielmehr bog