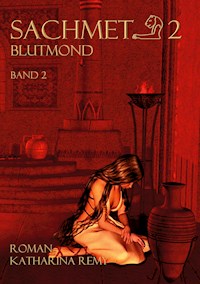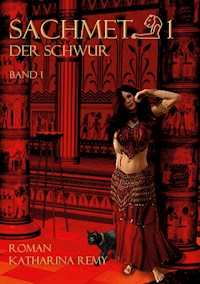
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sachmet
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, zwei Schicksale - über Jahrtausende hinweg verbunden durch mystische göttliche Kraft 1999 AD: Luxor, Ägypten Anna Berger, eine junge, selbstbewußte Archäologin, machen der Fund einer eigenartigen Statue, die Begegnung mit einem unheimlichen Bettler und rätselhafte Alpträume zu schaffen. Sie wird diese aufregende Grabungssaison im Jahr der Sonnenfinsternis niemals vergessen können. 1399 v. Chr.: Uaset, Kemet In Uaset, der aufstrebenden Stadt, die Pharao Amenhotep als neuen Regierungssitz auserkoren hat, schafft es Bent, ein einfaches Mädchen, Tochter einer armseligen Hure, sich eine sichere Zukunft aufzubauen. Ihr Streben, einen richtigen Namen zu erhalten, damit die Götter sie im Jenseits einst finden, führt sie in das freundliche Haus des Men. Doch hinter diesen Mauern wohnt das Grauen, denn dort begegnet ihr Amenophis Hapu. Diese schicksalhafte Begegnung verändert ihr Leben für immer! Tapfer wagt sie dennoch einen Neuanfang, findet im Tempel der Bastet die Liebe ihres Lebens. Auf ein zukünftiges Glück hoffend, wird sie bitter enttäuscht und schwört im Zorn der grausamen und tückischen Sachmet, der mächtigsten und gewaltigsten Göttin Ägyptens, einen blutigen Schwur. Ein zweites Mal begegnet Bent Amenophis Hapu, aber selbst Die Mächtige kann sie nicht vor ihm beschützen! Verletzt und gedemütigt, krank an Leib und Seele, bringt man sie in den Tempel der Isis, doch dort sollen Zauberinnen wohnen ... Bald kämpfen die mächtigsten Göttinnen Kemets um das Schicksal des Mädchens und um die Zukunft des Schwarzen Landes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Zwei Frauen, zwei Schicksale – über Jahrtausende hinweg verbunden durch mystische göttliche Kraft
1999 AD:
Luxor, Ägypten
Anna Berger, eine junge, selbstbewußte Archäologin, machen der Fund einer eigenartigen Statue, die Begegnung mit einem unheimlichen Bettler und rätselhafte Alpträume zu schaffen. Sie wird diese aufregende Grabungssaison im Jahr der Sonnenfinsternis niemals vergessen können.
1399 v. Chr.:
Uaset, Kemet
In Uaset, der aufstrebenden Stadt, die Pharao Amenhotep als neuen Regierungssitz auserkoren hat, schafft es Bent, ein einfaches Mädchen, Tochter einer armseligen Hure, sich eine sichere Zukunft aufzubauen. Ihr Streben, einen richtigen Namen zu erhalten, damit die Götter sie im Jenseits einst finden, führt sie in das vornehme Haus des Men. Doch hinter diesen Mauern wohnt das Grauen, denn dort begegnet ihr Amenophis Hapu. Diese schicksalhafte Begegnung verändert ihr Leben für immer! Tapfer wagt sie dennoch einen Neuanfang, findet im Tempel der Bastet die Liebe ihres Lebens. Auf ein zukünftiges Glück hoffend, wird sie bitter enttäuscht und schwört im Zorn der grausamen und tückischen Sachmet, der mächtigsten und gewaltigsten Göttin Ägyptens einen blutigen Schwur. Ein zweites Mal begegnet Bent Amenophis Hapu, aber selbst Die Mächtige kann sie nicht vor ihm beschützen! Verletzt, gedemütigt, krank an Leib und Seele bringt man sie in den Tempel der Isis, doch dort sollen Zauberinnen wohnen …
Bald kämpfen die mächtigsten Göttinnen Kemets um das Schicksal des Mädchens und um die Zukunft des Schwarzen Landes.
Die Autorin:
Ich bin im Saarland (Deutschland) geboren, lebe in der Nähe von Saarbrücken und bin verheiratet. Reisen – nicht nur nach Ägypten - sind unsere Passion. Seit ich Kind war fühle ich eine unerklärliche Liebe für Ägypten - das Land am Nil ist seit Jahrzehnten das Reich meiner Leidenschaften und Träume. Um diese versunkene Kultur, den Glanz der Pharaonen in all ihrer Pracht vor meinen Augen erstehen zu lassen, begann ich mit dem Schreiben. Die Lebens- und Denkweise der alten Ägypter, ihr unerschütterlicher Glaube an die Götter und an Maat, die alles im Gleichgewicht hält, ist das, was mich inspiriert und all meinen Geschichten Leben einhaucht.
FÜR JÜRGEN AUF DEN ICH MICH IMMER VERLASSEN KANN
Inhaltsverzeichnis
DEUTSCHLAND, SAARBRÜCKEN
DIE VERGANGENHEIT
DIE ZUKUNFT
LUXOR, WINTER PALACE
DIE GEGENWART
O ÄGYPTEN, ÄGYPTEN!
VON DEINER RELIGION WERDEN NUR
LEERE ERZÄHLUNGEN,
DIE DIE NACHWELT NICHT GLAUBEN WIRD,
UND IN STEIN GESCHLAGENE WORTE BLEIBEN,
DIE VON DEINER FRÖMMIGKEIT ERZÄHLEN.
DEUTSCHLAND, SAARBRÜCKEN
IM HAUS DER FAMILIE BERGER
MITTWOCH, 11. AUGUST 1999
Die Finsternis
Millennium!
Jahrtausendwende!
Pah!
Wie viele Jahrtausendwenden hatte diese Welt schon gesehen? Was war dagegen schon die Kommende? Lächerliche 2000 Jahre, abgezählt am Geburtstag eines Mannes, den man 33 Jahre später auf grausamste Weise folterte. Der starb, damit die anderen ihren Sündenbock bekamen.
Ich nehme die Brille ab, schaue vom Balkon hinunter in den Garten, hinaus in die Ferne. Weit unter mir liegt mein Geburtsort, fast vollkommen eingehüllt in die kommende Finsternis. Sanft schmiegen sich die Hypothekenhochburgen an die Hänge des kleinen Tales. Georg tritt hinter mich, küßt mich in den Nacken und stellt sein Champagnerglas auf den Tisch.
Ich kann es nicht mehr hören. Alle Schicki -Micki-Freunde reden von nichts anderem. Sie planen Partys an den ausgefallensten Stellen der Erde: am Eiffelturm, dem Empire State Building, in den Ruinen von Macchu-Piccu, in Rom, New York und Hongkong.
Nur ich werde nicht da sein, werde mich in meine geliebte Arbeit stürzen! Und mich gepflegt aus all dem Trubel raushalten, denn im September fliege ich zurück in meine Wahlheimat. Dorthin, wo meine Arbeit auf mich wartet, wo man nicht darauf achtet, ob meine Hose, meine Jacke, mein Kostüm oder mein Parfüm von Designern kreiert wurde. Ich werde keine Geschäftsessen geben müssen, keine repräsentative Gastgeberin sein. Dort trage ich keine italienischen Schuhe, kann in meine bequemen Stiefel schlüpfen. Ich habe mich gut erholt, seit ich im späten Frühjahr wieder hierher nach Hause gekommen war. Doch sehnsuchtsvoll warte ich auf die nächste Saison. Ich kann es nicht abwarten, bis der Herbst kommt, ich endlich wieder nach Ägypten gehen kann. Dann werde ich diese leidigen Partys und Empfänge abschütteln wie ein nasser Hund die Wassertropfen. Ich kann sie nicht mehr ertragen, diese aufgeblasenen, oberflächlichen Menschen, die entweder zu schön, zu dumm oder zu reich oder alles auf einmal sind.
„Ich werde nicht da sein!“, maulte ich, drehte ich mich in Georgs Armen um.
„Willst du allen Ernstes wieder graben gehen? Mit Eimerchen, Schaufel und Sieb? Ach, Anna, Süße, komm“, er küßte meinen Hals, aber ich drückte ihn weg, „dieses eine Mal wirst du doch nicht die Archäologin spielen wollen! Das kannst du doch nicht machen! Du bist die Einzige, mit der ich die Jahrtausendwende feiern möchte.“
„Ich will es nicht!“, giftete ich, Wut stachelte mich an, denn das war der einzige Ausweg mich nicht in seinen sanften, rehbraunen Augen mit den langen Wimpern zu verlieren, ihm nachzugeben, ihm Recht zu geben. Leichter Spott machte sich in seinem Grinsen breit. Das gab den Ausschlag, mich aus seinen Armen zu lösen, um zurück an das Balkongeländer zu treten.
Dieser Spott in seinen Augen entfremdete mich ihm, seine Herablassung für mich, das kleine kapriziöse Weibchen, welches er von der Stunde unserer Hochzeit an behüten, beschützen und gängeln wollte. Ich war seine glanzvollste Zugnummer, seine schönste Puppe. Acht Jahre lang meinte ich, glücklich zu sein. Glaubte, seine generöse Art mich zu verwöhnen, sei Liebe. Er staffierte mich mit den schicksten Klamotten der größten Designer aus, stellte mir schnittige Autos in die Garage, baute mein Elternhaus, in dem wir lebten, großzügig um. Ich lebte wie eine satte, zufriedene Katze in der bis zum hintersten Winkel durchgestylten Wohnung, glaubte, daß dies die Erfüllung meiner Träume sei.
Natürlich fühlte ich mich wohl, denn ich liebe Georg. Doch mein ständig aufgewühltes Innerstes fühlte sich so hohl und ausgeleert an wie ein Halloweenkürbis. Ich lebte in unendlich langweiligen Tagen, die mit nichtigen Oberflächlichkeiten, höflichen Floskeln, mit banalen Gesprächen angefüllt waren. Deshalb versuchte ich mich mit allen möglichen Dingen abzulenken. Wein tröstete mich über die Einsamkeit hinweg. Rauschende Partys unterdrückten mein leises Aufbegehren gegen meinen Mann. Mit Büchern entfloh ich der wirklichen Welt. Mit ihnen versenkte ich mich in Träumereien und Phantasien. Durch Englisch und Yogakurse füllte ich die leeren Abende, während Georg mal wieder auf Geschäftsreise war. Ich versuchte mich mit Seidenmalerei, Joggen, vegetarischer, chinesischer und japanischer Küche von meinem hausgemachten Elend abzulenken.
Ich hätte eine Arbeit annehmen können. Aber nein: Georg ist jemand, der sein Frauchen für sich alleine will. Ein Heimchen am Herd und eine Hure im Bett. Er braucht das heimelige Gefühl nach Feierabend, wenn die liebende Gattin die Pantoffeln bringt, das Essen aufträgt und Kerzen anzündet. Aber keine Frau, die müde von einem anstrengenden Arbeitstag, im Jogginganzug schnell den Göttern von Maggi und Knorr huldigt und ein Fertiggericht zaubert. Georgy wünscht, daß seine Frau ihn ausgeruht empfängt, gepflegt gekleidet ist, dazu dekorativ aussieht, während sie ihm die Leckereien auftischt, die sie stundenlang in der Küche gebrutzelt hat.
Im Großen und Ganzen entsprach dieser Lebensstil meinem Naturell. Ich bin von Natur aus etwas faul und gemächlich und ich lasse mir manchmal gerne sagen, was ich tun soll. Kurz um, meine äußere Erscheinung, mein Gebaren anderen Leuten gegenüber gibt ihnen den Anschein, daß sie das glauben können, was sie da sehen: ein Weibchen, eine typische Tochter der Eva, hilflos, weltfremd, schutzbedürftig. Wie eine träge Katze, die sich auf der sonnendurchfluteten Fensterbank räkelt.
Doch wehe das Raubtier erwacht! Ich habe viel Geduld, daher dauert es lange bis mein Blut kocht. Aber dann werde ich zur reißenden Bestie. Nichts verabscheue ich mehr als Ungerechtigkeiten oder Halbherzigkeiten. Doch meine wahre Natur halte ich meistens im Zaum, denn ich bin eine Meisterin der Verstellung. Kurze Röcke zeigen meine langen schlanken Beine, die einen ebenso schlanken, biegsamen Körper tragen. Meine Füße stecken die meiste Zeit in Schuhen, bei deren bloßen Anblick Männer glasige Augen bekommen und wie auf Kommando in Balzstimmung fallen. Die langen, naturbelassenen Haare, die in lockigen Kaskaden über meinen Rücken fallen, sind aber nicht blond, sondern dunkelbraun, wie meine Augen.
Um nicht total zu versauern, vertiefte ich mich vor zehn Jahren in ein altes Hobby von mir. Lange brannte meine Leidenschaft für das alte Ägypten auf Sparflamme. Meine Heirat, meine vergeblichen Versuche ein Kind zu bekommen, meine Hingabe an unser Haus und den Garten als Ersatz für etwas, was ich nie bekommen würde, Georgs beruflicher Aufstieg in der Firma meines Vaters und schließlich seine eigene Firmengründung - ein mittlerweile gutgehendes Maklerbüro - all das ließ mir keine Zeit für das entschwundene Ägypten der Pharaonen. Zudem betäubte ich mich mit den Dingen des schönen Scheins. Ich richtete die Wohnung neu ein. Früher nannte man es die ‚gute Stube’, heute nennt man es ‚Wohnlandschaft’. Doch auch dieses dumme Spiel wurde mit der Zeit langweilig. Nach und nach flüchtete ich mich in Zynismus, in beißenden Sarkasmus, schwor der Religion und dem Glauben ab, wurde mit der Zeit nach außen boshaft ehrlich. Ich bin allen Ernstes dazu in der Lage, jemanden mit schonungsloser Offenheit zum Teufel zu jagen.
Ich schaute mir von dieser Zeit an kaum Nachrichtensendungen im Fernsehen an, weil ich diesen Schwachsinn einfach nicht mehr hören wollte. Ich grenzte mich ab von der Welt. Versuchte nicht die Bigotterie zu verstehen, in welcher der Papst die Verhütung verbietet aber gleichzeitig Kinder, die an Aids krepieren segnet. Politik ist mir ebenso ein Dorn im Auge. Da geht es um die, ich weiß nicht wievielte Gesundheitsreform, die Steuerreform, um die Ökosteuer, die größer werdenden Arbeitslosenzahlen, um unsinnige Ladenschlußzeiten, bei denen die Verkäufer bis tief in die Nacht ihren Frust an den unschuldigen Käufern auslassen können und um ebenso unsinnige Tarifverhandlungen, bei denen am Ende doch nichts herauskommt.
Und nebenbei, so als ginge uns das Elend der anderen nichts an, sozusagen als Gruselbonus damit es beim Abendessen ein bißchen spannender wird, wird erwähnt, daß in einem anderen Teil der Welt ein Erdbeben Tausende Menschen tötet, eine Hungersnot oder Dürre ganze Landstriche heimsucht und die Bevölkerung dezimiert. Im Balkan tobt ein Krieg, fast vor unserer Haustür – ein unvorstellbarer Gedanke. Der Regenwald ist bald gänzlich dem Kommerz zum Opfer gefallen. Aber dafür wird das Ozonloch wenigstens größer!
Angesichts dieser Rücksichtslosigkeit der Menschheit wird mein Zorn auch immer größer. Ja sehen wir denn nicht, daß wir nur diese eine Welt haben? Müssen wir sie denn ständig mit Füßen treten? Müssen wir sie weiter ausbeuten und die letzten Ressourcen verschwenden? Hat die Menschheit denn nicht mehr den kleinsten Funken von Ehrfurcht für seine Mitmenschen, seine Mitgeschöpfe und diesen Planeten, der unsere einzige Heimat ist? Zählt wirklich nur noch der Profit und die Macht der Wirtschaft? Was tun wir mit unserem blauen Planeten, wenn er uns kein Geld mehr einbringt? Wenn nichts mehr zu holen ist, die Wüsten sich ausbreiten, das Wasser endgültig aufgebraucht und selbst die letzte Tierart ausgerottet ist …
Vielleicht wird er sozialverträglich abgebaut!
Georg ertrug meinen Sinneswandel mit stoischer Gelassenheit. Aber mir selbst blieb ein schlechtes Gewissen. Ich hatte das Gefühl, daß ich etwas an meinem Leben ändern müsse, wenn ich schon nicht dem Elend in dieser Welt abhelfen konnte. Und so begann ich meinen Müll zu sortieren, brachte Glas und Papier zum Container, richtete im Garten einen Komposthaufen ein, baute mein Gemüse biologisch an. Das wenige Fleisch, welches wir aßen, besorgte ich mir bei einem Bauern, bei dem ich mich überzeugen konnte, daß die Schweinchen fröhlich im Dreck suhlten, die Hühner auf dem Mist kratzten und bei dem die Kühe wirklich glücklich wirkten. Und ich übernahm die Patenschaft für ein Kind in Indien. Wenigstens diesem Kind konnte geholfen werden, mit der Hoffnung, daß die Welt für es selbst ein klein wenig besser ausschaut.
Georg überraschte mich damals zu unserem zehnten Hochzeitstag mit einer Reise in das Land am Nil. Die Faszination dieses Landes ließ mich von da an überhaupt nicht mehr los. Letztendlich ließ ich die Englischkurse sausen, belegte stattdessen Kurse für altägyptische Hieroglyphen. Bücher mußten her, damit ich mein neu erworbenes Wissen an den darin abgebildeten Objekten selbst studieren konnte, versenkte mich tief in die wunderbare, faszinierende und leider vergangene Welt der Pharaonen. Bald kannte ich die alten Königslisten auswendig, verfolgte mit katzenhafter Neugier Berichte über Ausgrabungen, fieberte im Geiste mit Howard Carter mit, stieß erleichtert die Luft aus, als er Lord Carnarvon von Wunderbaren Dingen berichten konnte. Ich begeisterte mich für Belzonis Abenteuer, fluchte wie ein altes Marktweib auf den englischen Konsul Henry Salt, der Belzonis Erfolge für sich selbst verbuchte. Ich entschlüsselte auf meine Weise den Stein von Rosette und empfand tiefstes Mitleid mit Jean-François Champollion. Zu guter Letzt brach ich aus meinem goldenen Käfig aus, brachte den Mut auf, mich mit meinen knapp dreißig Jahren an der Universität einzuschreiben um Altertumskunde zu studieren. Unbedarft und unvoreingenommen ging ich ans Werk, machte manchem stallblinden Ägyptologen bald was vor.
Ich hatte Glück, wie soll ich es sonst nennen? Vor vier Jahren stellten sie ein Grabungsteam zusammen. In Luxor, dem antiken Theben, welches damals Uaset genannt wurde, sollte ein neues Grabungsfeld erkundet werden. Und sie wollten mich dabei haben!
Wie sang der Meister? Wunder gibt es immer wieder!
Ja, Wunder. Sie geschehen wirklich immer wieder. Katja Ebstein versuchte sich zu diesem Thema schon in den Siebzigern, aber der Meister mit den orthopädischen Strümpfen und den Nußecken bringt es besser.
Zerknirscht und niedergeschlagen kam ich an jenem Abend zu Hause an. Wie sollte ich Georg nur klarmachen, daß ein neuer Stern am Archäologenhimmel geboren war?
Ich schloß die Haustür auf. Der beißende Gestank von angebranntem Essen stieg mir in die Nase, ich hörte ein herzhaftes Fluchen und das Scheppern des verchromten Müllkübels unter der Spüle. Dicke Rauchschwaden kamen mir aus der Küche entgegen. So gingen die schönen Lammfilets, die ich für den Abend geplant hatte, den Weg alles Irdischen. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für das heikle Thema, welches ich zur Sprache bringen wollte.
Nachdem ich Mantel, Schuhe, Handtasche und Hoffnung abgelegt hatte, betrat ich das Wohnzimmer.
Wie sollte ich ihm diese Neuigkeit beibringen? Seine Anna! Sein Püppchen, sein Mausi, Schätzchen … Fern von ihm! Mindestens für ein halbes Jahr über fünftausend Kilometer entfernt … Unabhängig …
Luxor!
Wie ich mich danach sehnte!
Weg! Weg von ihm!
Freiheit …
Oh, ich kannte ihn nur zu gut! Friedlich würde das nicht ausgehen, denn er konnte manchmal so was von unverschämt seinen Willen durchdrücken, daß ich mich manipuliert fühlte. Rechthaberisch auf seine Meinung und seinen Willen pochend, würde er mir mein Vorhaben schon ausreden. Vor meinem geistigen Auge betrachtete ich die notdürftig geflickten Scherben unserer Ehe. Alles war da, teilweise im Überfluß, vor allem Geld. Materielle Sorgen plagten uns nicht. Aber nichts war geblieben von den heroischen Träumen einer Generation die nichts zu fürchten hatte. Wir besaßen nicht die Kraft unserer Eltern, aus Schutt und Trümmern eine Wohlstandsgesellschaft aufzubauen. Nicht den Elan der mariuhanageschwängerten Träume der 68er Bewegung und erst recht nicht die rowdyhaften Beweggründe der siebziger Jahre.
Was blieb von unseren Träumen?
Unser Bewußtsein manifestierte sich in den frühen achtziger Jahren, war geprägt von Punkern, Poppern und von Modern Talking. Letztendlich blieb der kümmerliche Versuch einer degenerierten Generation mit einem Computer zu kommunizieren. Wenn ich mich umsehe erblicke ich nur vertrottelte Computergenies, die dem täglichen Lebenskampf Adieu gesagt haben. Jeder halbwegs talentierte Mensch entwickelt Computerprogramme, entwirft Software, spricht in Bites und Bytes und in Handys und investiert in e-commerce. Wo soll denn das hinführen? Wer entleert irgendwann unsere übervollen Mülltonnen? Oder bäckt das Brot? Gastarbeiter gibt’s schon lange keine mehr. Unsere Gesellschaft mutiert zu einer Dienstleistungsgesellschaft, bietet Service rund um die Uhr, organisiert selbst die Freizeit. Ich frage mich immer, was die Leute in ihrem Urlaub tun, wenn der ultimative GAU ihre sauer verdienten Urlaubstage trifft: Der Animateur ist erkrankt!
Apropos Animateur und apropos Träume. Ja, meine Ehe! Jetzt würde sie wohl endlich den Gnadenstoß bekommen. Ich lamentierte lauthals über die verkokelten Lammfilets und den Gestank in der vollgeräucherten Wohnung. Georg maulte daß ich nicht zeitig zu Hause war um zu kochen, er sei am Verhungern, hätte schließlich einen langen Arbeitstag hinter sich, wo ich gewesen wäre, ich hätte doch gefälligst anrufen können, und so weiter. Im Nu hatten wir den schönsten, dicksten Krach. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen knallte ich ihm trotzig hin, daß ich für ein halbes Jahr nach Ägypten gehen würde.
Ungläubig hielt er die Klappe, schaute mich entgeistert mit riesengroßen Augen an, während ich ihm mit sich überschlagender Stimme hastig von meinen Plänen erzählte. Ich konnte es in seinen Augen lesen. Sein offenstehender Mund wartete bloß auf eine Atempause von mir, um mich in Grund und Boden zu stampfen. Nichts würde mir bleiben, ich hatte alles aufs Spiel gesetzt und verloren. Es blieb nichts von meinen Gefühlen übrig, die ich üblicherweise für ihn hege. Wir standen uns gegenüber wie zwei lauernde Löwen. Kalt, berechnend, wartend auf den Fehler des anderen. Meine Ehe schien eine einzige Lüge gewesen zu sein. Ich vergeudete mein Leben mit einem intoleranten Dickkopf!
„Ich bin es satt! Dieses beknackte Leben! Ich bin doch nicht dein Dummchen! Dein Püppchen! Ich habe ein eigenes Leben, einen eigenen Willen! Eine eigene Meinung! Ich mache jetzt das, was mir paßt! Und du wirst mich nicht daran hindern!“
Er grinste schon fast gehässig, klopfte mir heftig auf die Schulter, meinte ironisch:
„Mein Mäuschen! Was bist du süß! Einfach umwerfend! Ich sehe dich jetzt schon: Mit drei Koffern, dem Beautycase, alles Ton in Ton abgestimmt, an den Füßen deine geliebten Manolo Blaniks, trippelnd wie ein aufgescheuchtes Reh am Flughafenschalter stehen, um einen Wagen mit Klimaanlage zu mieten, damit du auf schnellstem Weg in die Wüste brausen kannst! Herrlich diese Vorstellung! Meine süße Anna, so ein wildes Mädchen!“ Dabei kramte er im Zeitungsständer nach dem Telefonbuch.
„Wen willst du anrufen?“, giftete ich und rieb meine Schulter. „Die Klapsmühle? Du wirst mich nicht daran hindern zu fahren!“
„Und ob du fährst! Ich werde dich bestimmt nicht aufhalten. Geh nur, wirst schon sehen, was du davon hast!“
Jetzt war die Reihe an mir, mit offenem Mund dazustehen. Mein erster Gedanke: der wirft mich aus der Wohnung! Wie betäubt schaute ich ihm zu, während er eine Nummer wählte. Sicher die unserer Anwältin. Morgen schon würden wir die Scheidungspapiere auf Karens Schreibtisch unterschreiben, bald getrennte Wege gehen. Mit halbem Ohr hörte ich hin, wie er eine Pizza bestellte, packte in Gedanken meine Habseligkeiten zusammen und schlich im Geiste wie ein geprügelter Hund aus der Tür.
Georg inspizierte derweil den Kühlschrank, klapperte mit Besteck, kam zurück, entkorkte eine Flasche Champagner. Der Korken flog mit einem lauten Knall an die weiße Holzdecke und hinterließ dort eine Delle.
„Spinnst du!“
„Nicht schlimm!“
Überschäumend floß der Champagner in die Kristallkelche, tropfte auf den dicken Berber.
„Du bist ein Riesenferkel! Paß doch auf!“
„Frau Becker kriegt das morgen wieder hin. Zum Wohl, meine Süße! Auf deine Reise! Auf deinen Abschied! Und vor allem: Auf eine gute Wiederkehr! Diesen Erfolg, Anna, gönne ich dir von Herzen!“
„Du läßt mich gehen?“
„Aber warum denn nicht? Wolltest du das nicht? Hast du das vielleicht umsonst studiert? Du willst dein Wissen doch anwenden, vertiefen. Hasi, schau…“
„Wenn du doch nur aufhören würdest, mich als Nager zu titulieren…“
Mitten in dieser trauten Familienszene schellte der Pizzabote.
Unfähig mich zu rühren, saß ich kurz drauf da, schaute diesem Kerl zu, wie er die Schachtel öffnete und mit einem Messer aus der Pizza Stücke schnitt wie aus einem Kuchen.
Mein Georg! Dieser Snob, dieser Gourmet, dieses Leckermaul, der wie eine verwöhnte Katze nur das aß, was ich mühevoll zubereiten mußte! Der Essen bevorzugte, welches teilweise noch lebte; oh, all diese Hummern, Austern und Schnecken! Wie es mich bei dem bloßen Gedanken daran schüttelte. Es war nicht zu fassen! Dieser Mann saß vor mir auf dem Boden, balancierte die fettige Schachtel auf den Knien, drückte mir in die freie Hand ein fetttriefendes Pizzastück, von welchem lange Käsefäden herabhingen, kaute herzhaft auf zwei Backen und spülte mit dem Champagner nach. Fragte mich nach Zoll- und Impfbedingungen, Arbeitsgenehmigung, Visum und Sonnenschutzfaktor.
Sicher war er ein Dickkopf, die meiste Zeit unausstehlich. Manchmal habe ich das Gefühl, zwei verschiedenen Männern gegenüber zu stehen. Doch er konnte auch anders – wie jetzt. Das war der Mann, den ich liebte. So stellte ich mir die Ehe mit ihm vor. Obwohl ich oft einsam war wenn er auf Geschäftsreise war, ließ er mir meine Spielereien, verwöhnte und verhätschelte mich, ließ mir großzügig meinen Platz in dieser Welt. Ließ mir freie Hand. In diesem Augenblick, nach zwölf Jahren Ehe, erkannte ich Georg überhaupt nicht mehr. Er war nicht nur mein Mann! Er war auch ein wahrer Freund!
Und diesen Freund mußte ich heute, nach sechzehnjähriger Ehe, schwer enttäuschen, weil ich auch diese Kampagne in Ägypten verbringen wollte.
„Die anderen brauchen mich. Ich kann nicht absagen!“ Ich blickte wieder auf die kleine, dunkle Stadt vor mir. Würde sie nachher noch da sein?
„Ich habe eine Woche im Hilton in Paris gebucht, zwei Plätze im Restaurant reservieren lassen! Was soll ich jetzt damit anfangen?“
„Ich hatte nicht vor, über die Feiertage nach Hause zu kommen. Kannst du mich nicht mal fragen, was ich für Pläne habe? Willst du darauf wirklich eine ehrliche Antwort? Was kümmert es mich, was in vier Monaten sein wird? Ich kann doch kein Abendessen für Monate im Voraus planen! Ich bin in Luxor! Ich werde keinen Flug bekommen. Du kannst nicht von mir verlangen, daß ich meine Kollegen im Stich lasse. Wir werden an dieser Fundstelle Tag und Nacht arbeiten. In ganz Ägypten wird zu Silvester kein Taxi zu finden sein. Die halbe Welt feiert dort. Kairo ist jetzt schon übervölkert, aber an Silvester werden sie erst wissen, was das wirklich bedeutet. In Gizeh soll noch nicht einmal mehr ein Stehplatz zu bekommen sein. Wie soll ich aus einem solchen Hexenkessel herauskommen?“
„Dann komm eine Woche früher!“
„Nein!“
„Was habt ihr denn schon groß gefunden? Einen goldenen Pharao? Ein unbekanntes Grab? Einen unbekannten König? Gold? Schätze? Nein! Anna findet Scherben, Anna findet eine zusammengebrochene Rumpelkammer! Hast du noch von dem Krabbencocktail? Der ist lecker!“
„Halt doch die Klappe!“ Ich schenkte mir Champagner nach, setzte nochmals diese spaßige Brille auf die Nase, schaute in den dunklen Himmel.
„Ich dachte, das wäre eine Marotte. Glaubte, das gäbe sich. Konnte ich ahnen, daß du Jahr für Jahr ein halbes Jahr verschwindest, mich alleine läßt? Anna! Süße!“
„Hör auf zu schmeicheln! Laß mich gucken. Da, nimm deine Brille!“
Heute, am 11. August 1999, 12:25 Uhr war es draußen fast dunkle Nacht. Eine eigentümliche Finsternis senkte sich auf die Welt die ich kannte hinab; unheimlich war es da draußen, wie kurz vor einem schweren Gewittersturm. Da ist man ein aufgeklärter Mensch, weiß um vieles, erkennt die Zusammenhänge, aber diese Sonnenfinsternis direkt über mir machte mich nervös. Ich betrachtete den kleinen Teil der Sonne, der übriggeblieben war, schob die Brille auf die Stirn und schaute drin zu dem laufenden Fernseher im Schlafzimmer hin, betrachtete kopfschüttelnd die Menschen auf der Straße, wie sie sich umarmten, laut grölten und Bier aus Flaschen tranken. Was gibt es da zu feiern? Sie benahmen sich, als wäre dieses erhabene Himmelsschauspiel auf ihrem eigenen Mist gewachsen!
Ich trank mein Glas fast leer, beobachtete gespannt den endgültig dunklen Himmel. Die Sonne verschwand, für den Bruchteil einer Sekunde erschien ein strahlender Diamant am Himmel.
Grandios! Nie im Leben fühlte ich eine solche Gänsehaut wie in diesem Moment.
Nie mehr in meinem Leben werde ich ein solch beeindruckendes Erlebnis hautnah miterleben. Die Sonne verschwand endgültig, nahm die Wärme des Tages mit sich, die Welt um mich wurde finster und still. Fern am Horizont schimmerte ein goldenes Glühen unter leichten Wolken. Venus und Merkur zeigten sich am Himmel.
„Wunderbar! Ergreifend! Überwältigend!“ hörte ich die Leute aus dem Fernseher rufen. Ich hörte Applaus, Grölen, Lachen.
Doch nichts von meinen eigenen Gefühlen konnte ich in Worte fassen. Ich stand da, wortlos, reglos, schaute gerührt in diese schwarze Sonne, schaute atemlos diesem wunderbaren Naturschauspiel zu. Und verstohlen wischte ich mir eine Träne aus den Augenwinkeln.
Würde sie je wieder erscheinen? Uns in ihrer Wärme baden? Ich betrachtete staunend die unheimlich gewordene, stille Welt. Doch diese zwei Minuten völliger Finsternis gaben mir auf einmal das Gefühl, daß ich so etwas schon einmal erlebt hätte. Ich schaute in diese schwarze Sonne, die wie ein gnadenlos grausames Loch im Universum wirkte, als könnte ich geradewegs hindurchschauen. Alle Muskeln in meinem Körper spannten sich an. Ich spürte heftige, unerklärliche Wut, ja beinahe Raserei, und mir war, als hätte ich mich an einen flüchtigen Traum der vergangenen Nacht erinnert. Es schien, als blickte ich durch einen langen, dunklen, kalten Korridor. Vor meinem geistigen Auge erblickte ich ein junges Mädchen. Ein völlig aufgelöstes, verstörtes Mädchen, welches einen Mann ermordete!
Ich schüttelte den Kopf, kniff die Augen zusammen, schwankte und griff hastig nach dem Glas. Ein Cognac wäre mir lieber gewesen! Ich rieb mir die Augen, verwischte meine Schminke, blinzelte in diese unwirkliche Welt da draußen und abermals sah ich Bilder. Flüchtig, bestialisch, schwindend und gaukelnd wie ein Traumbild:
Mein Sohn wurde umgebracht, auf sadistische Weise!
Feuer!
Tote, erschlagene Frauen!
Mit einem Schrei ließ ich das Glas fallen, griff mir ans Herz, krümmte mich wie ein Regenwurm. Dieser Schmerz! Diese Trauer! Niemals in meinem Leben war mir eine solche Pein widerfahren! Als hätte ich all das Elend dieser Welt gefühlt. Nach Luft schnappend klammerte ich mich an Georg und ich schrie und weinte, während draußen die Sonne an diesem Tag zum zweiten Male aufging.
„Aber wenn ich es dir doch sage!“ Ich knöpfte meine Bluse zu und schlüpfte wieder in die Schuhe. Helmut, ein alter Freund aus Kindertagen und mein Hausarzt, wickelte das Stethoskop zusammen um es in die Brusttasche seines blütenweißen Kittels zu stecken.
„Da ist nichts, Anna! Du hast nichts am Herzen. Vielleicht war es die Aufregung und Anspannung während der Sonnenfinsternis. Du bist kerngesund.“
„Es hat so wehgetan! Ich konnte mich hinterher kaum beruhigen. Ich mußte mich ins Bett legen. Ich habe wie Espenlaub gezittert. Diese Bilder verfolgen mich wie ein Horrorfilm. Was war das? Ich habe doch keine Halluzinationen! Ist es Malaria? Eine Tropenkrankheit? Hepatitis? Nun rede doch!“
„Wahrscheinlich etwas zuviel Champagner!“, scherzte er.
„Och Mann!“
„Anna! Ich untersuche dich zweimal im Jahr gründlicher als jeden anderen Patienten. Deine Impfungen machst du bei mir. Ich kenne dich besser als du selbst, jedenfalls von innen, und ich kann dir mit Sicherheit sagen, daß du gesund bist. Morgen kann ich dir das Ergebnis der Blutuntersuchung mitteilen, dann werden auch die Ampullen für die Impfung da sein. Reg dich nicht mehr darüber auf. Wann fährst du?“
„Am dreiundzwanzigsten September.“
„Tetanus müssen wir auffrischen.“
„Sollte ich nicht zur Polizei gehen?“
„Und dann?“
Hilflos zuckte ich mit den Schultern. „Es schien so echt, als wäre ich dabeigewesen. Wie nennt man so was noch gleich?“ Ich schnippte mit den Fingern. „Wenn man glaubt, man war schon einmal in einer solchen Situation?“
„Ein Déjà-vu!“
„Ja, genau!“
Helmut legte meine Patientenkarte in die Ablage auf seinem Schreibtisch, wusch sich die Hände, drehte sich wieder zu mir um.
„Ein Déjà-vu ist eine Fehlinformation des Gehirns, Anna. Irgendwo in unserer großen Gehirnbibliothek wurde etwas falsch abgelegt, wurde eine banale Erinnerung sozusagen ins verkehrte Fach eingeordnet. Du darfst nicht zur Polizei gehen, wenn du dich nicht lächerlich machen willst.“
„Ich hoffe, du hast recht!“
Helmut küßte mich links und rechts auf die Wangen. Wenig beruhigt schulterte ich meine Umhängetasche.
„Bis morgen!“
ÄGYPTEN, ÜBER DEN WOLKEN DONNERSTAG, 23. SEPTEMBER 1999
Der Fund
Ich zog den Kopfhörer meines Discman von den Ohren – Lou Begas Mambo Nr. 5 war mein Sommerhit des Jahres – klappte das Buch zu, setzte mich aufrecht und schaute aus dem Fenster. Das Mittelmeer lag hinter mir, vor mir die ersten Ausläufer des Nildeltas. Der Pilot flog eine Schleife, die Welt unter mir neigte sich und dann sah ich sie:
Eines der Sieben Weltwunder, erhaben, majestätisch. Seit fast viertausend Jahren beeindrucken sie die Menschen dieser Welt, ziehen Scharen von Touristen an, bringen Regisseure dazu, Gruselfilme über sie zu drehen und Autoren lassen vertrocknete Mumien aus ihren nicht vorhandenen Labyrinthen kriechen, um die Menschheit zu erschrecken. Archäologen verzweifeln an ihnen, Techniker vermessen sie und erforschen ihre kleinen Schächte mit Robotern, die nicht größer als ein Fotoapparat sind. Eine besondere Spezies Mensch vermutet, sie wären das Werk von Außerirdischen, Touristen erklettern sie, Spiritisten sagen ihnen magische Kräfte nach. Doch bis heute ist niemand ihrem Geheimnis auf die Spur gekommen. Sie stehen da und schweigen. Seit ewigen Zeiten trotzen sie dem Wüstenwind, dem Kanonendonner, der Wärme des Tages und der Kälte der Nacht, den Touristen, der Luftverschmutzung und der Altertümerverwaltung.
Die Pyramiden!
Sie stehen da, beeindrucken uns kleine, armselige Menschen mit ihrer imponierenden Größe, ihrem unvorstellbaren Alter. Sie scheinen offensichtlich auf etwas zu warten.
Vielleicht auf die Rückkehr der Pharaonen?
Das Flugzeug senkte seine Nase, die Leuchtschilder und die Stewardeß sagten mir, daß ich mich anschnallen soll. Unter mir lag Afrika, geheimnisvoller Kontinent, Wiege der Menschheit. In wenigen Minuten würde ich diesen Boden betreten. Wir überflogen die riesige, monströse Stadt, und wie jedesmal bleibt sie mir ein Rätsel.
Al Qahira, die Siegreiche!
Sie ist das wirtschaftliche, politische und kulturelle Zentrum Ägyptens und der arabischen Welt. Hauptstadt Ägyptens, Weltstadt, Stadt der Superlative, gelegen am längsten Fluß der Erde. Wahrlich, Kairo ist die unumstrittene Siegerin in einem unglaublichen Wettbewerb. Als größte afrikanische Stadt beherbergt sie unter ihrem Smog mehr als 16 Millionen Einwohner. Wie sie das schafft, bleibt ihr Geheimnis. Kairo ist die Stadt, die niemals zur Ruhe kommt. Unentwegt pulsiert das Leben in ihren Straßen und Basaren und auf ihren Plätzen, ja selbst auf den Friedhöfen leben die Menschen. Autos, Lastwagen, Motorradfahrer, Taxis, Eselsgespanne, Ochsenkarren, Fahrradfahrer und Fußgänger blockieren die Straßen. Hupverbote wurden ausgesprochen, aber ganz Ägypten lacht darüber. Ein ständiges Brausen ist zu hören, wie aus dem größten Bienenstock der Welt.
Masr, wie die Stadt und das Land stolz von den Ägyptern genannt wird, hat Slums wie keine andere Stadt der Welt, Kairo sieht menschliches Elend, wie es kaum vorstellbar ist. Aber die Siegreiche gibt Hoffnung, gibt Tausenden Landarbeitern, die versuchen, in der Millionenstadt der Arbeitslosigkeit zu entfliehen, Trost. Ihre Häuser und Plätze quellen über vor Menschen, ihre Altstadt gehört seit 1979 zum UNESCO Weltkulturerbe, ihre Moscheen sind weltberühmt, ihre Museen beherbergen unglaublich wertvolle Schätze.
Al Qahira!
Moloch!
Hexenkessel!
Endstation oder Neubeginn, alles ist hier möglich.
Doch für mich ist Kairo heute bloß eine Umsteigestation. In einer Stunde geht mein Flug nach Luxor und ich freue mich schon, bald wieder vertrauten Boden unter den Füßen zu haben.
Luxor!
Endlich! Die gelb leuchtende Fassade des alten Hotels mit seinen kleinen Balkonen, den Stuckverzierungen, der geschwungenen Doppeltreppe und den weißen Fensterläden schien mich anzulächeln. Hier verändert sich nichts. Sogar der alte Bettler saß da. Wie jeden Tag, seit all den Jahren, in denen ich hierher komme, sitzt er dem Hotel gegenüber auf dem Bürgersteig, dort, an der Stelle, wo die meisten Touristen vorbeikommen, die von und zu den Anlegern der Kreuzfahrtschiffe oder zum Winter Palace pilgern. Er muß uralt sein, er ist schmutzig, verlaust und in Lumpen gehüllt. Vor sich hat er eine kleine Schale stehen, in die ab und zu klingend eine Münze fällt. Und wie jedes Jahr erspähe ich den alten Mann, er nickt mir zu wie zur Begrüßung, als würde er mich aus der Vielzahl der Touristen heraus erkennen, aber in seinem Gesicht sehe ich außer alten Narben keine Wiedersehensfreude.
Ich betrat durch die Drehtür das kühle Foyer. Der Chefportier des Winter Palace erkennt mich sofort, faltet hastig seine Zeitung zusammen, steckt sie eilig in die Jackentasche. Vor Aufregung und Wiedersehensfreude aus dem Häuschen, verläßt ihn sein souveränes Auftreten, er ist geneigt, seine schützende Balustrade – die Rezeption – sein Bollwerk gegen die allgegenwärtigen Touristen, zu verlassen um mich zu umarmen. Er breitet die Arme aus und ruft mit seiner liebenswert übertriebenen Art durch die Halle:
„Madame! Madame Anna! Bonjour! Welche Freude!“ Und über seine Schultern hinweg: „Page!“
Die Jungs zucken zusammen, eifrig scharen sie sich um mich, neugierig warum ihr Chef so schreit. Die ersten Wünsche nach Bakschisch werden leise geflüstert, aber Ibrahim entgeht nichts. Dieser schlanke, beinahe zierlich wirkende, eitle, hübsche Mann konnte unglaublich aufbrausen. Mit der Zeitung klopft er auf die Theke: „Nix Bakschisch! Ihr Hosenscheißer! Wagt es auch nur, sie zu belästigen! Madame Anna ist eine Königin! Eine Heilige! Schön wie unsere Nofretete und klug wie die Hatschepsut! Bakschisch!“ Als hätten die jungen Männer ein Sakrileg begangen, aber nicht nach einer Selbstverständlichkeit gefragt. Dramatisch wirft er die Arme in die Höhe und schüttelt den Kopf.
„Verzeiht meine Ausdrucksweise, Madame, aber das Personal heutzutage!“
„Sie haben doch nichts gemacht, Ibrahim!“ Ich lachte ihn an, froh darum ihn zu sehen.
„Die Koffer von der Madame auf ihr Zimmer, Yalla! Und wehe, sie haben hinterher einen Kratzer! Verschwindet! Yalla! Yalla!“
Ibrahim Ibn Abdalla, würdiger Empfangschef, zärtlicher Gatte, wahrscheinlich auch strenger Familienvater, straffte sich, machte eine formvollendete Verbeugung, griff meine Hand und hauchte, ohne sie zu berühren, einen Kuß darüber.
„Einen Kaffee, Madame?“
„Wie immer, Ibrahim!“
Er bedeutet seinem Kollegen, die Rezeption alleine zu führen, reicht mir seinen Arm und entführt mich über den roten Teppich auf die Terrasse. Bald darauf dampft vor mir eine kleine Tasse starken Moccas und Ibrahim hält mir sein Zigarettenetui mit orientalischen Zigaretten hin, süß und duftend. Jetzt endlich habe ich das Gefühl, ich sei nach Hause gekommen. Wie immer beruhigt mich der Anblick dieser Terrasse. Dieser anheimelnde Platz mit den weißen Balustraden, mit seinen gemütlichen schmiedeeisernen, dick gepolsterten Sesseln, dem atemberaubenden Blick über den Nil, auf dessen blauem Wasser die weißen Kreuzfahrtschiffe auf ihre Gäste warten. Weiter hinten auf dem glitzernden Wasser kreuzten wie seit Urzeiten die Feluken im Wind, deren knatternde Segel die frische Brise begrüßen. Vom gegenüberliegenden Ufer leuchtete das Westgebirge zu dieser Stunde in einem zarten dunklen Rosa, davor die bunten Häuser, fast ans Ufer des Nils gebaut, zwischen schattenspendenden Palmen und sattgrünen Wiesen. Wie ich diesen Anblick liebe!
Es war eine Freude, die Kollegen wiederzusehen. Alle trafen an diesem Nachmittag nach und nach ein. Zuerst kamen Thomas Blake, unser Ingenieur, und seine Frau Sarah. Ms. Blake erledigt für unser Team sämtliche schriftliche Arbeiten, ist zuständig für die Verwaltung, unsere Versorgung und die Buchführung. Danach betrat Kai Wagner, unser Chef, der mit seinem Charisma unserer Bande zusammenhält, den kleinen Konferenzraum, den Ibrahim uns reserviert hatte. Andrea Meinfeld folgte unmittelbar danach. Marc Blum, genannt Blümchen, seines Zeichens Computerspezialist, Laborant, Fotograf, Chemiker und Konservierer in einer Person, kam als letzter an. Ja, da waren wir alle wieder beisammen: Ein chaotischer Haufen zusammengewürfelter Existenzen, die nur eine Leidenschaft kannten – die Archäologie. Wir fielen uns um den Hals, feierten die ganze Nacht zusammen. Denn wie jedes Jahr fiel mein Geburtstag mit meiner Ankunft zusammen und wie jedes Jahr machten wir die Nacht zum Tag. Das würde dann die letzte Feier für das nächste halbe Jahr sein. Arbeit lag vor uns, knochenharte Arbeit, Sand, Hitze und Reibereien.
Das Wochenende blieb uns zur Erholung und Eingewöhnung, aber der Montag begann gleich mit Ärger. Das Deutsche Institut für Altertümer in Ägypten wollte uns das Budget kürzen. Sarah Blake teilte es uns morgens bei unserer ersten Besprechung mit. Hoffnungsfroh begannen die Arbeiten im letzten Frühjahr im Gräberfeld hoch über der alten Arbeitersiedlung Deir el-Medine, im Gebirge über dem alten Qurna, auf der Westseite des Nils. Wir waren uns alle einig in dem Felsen, hinter der gemauerten Wand auf ein intaktes Beamtengrab zu stoßen. Doch die zerstörte Vorkammer – nicht mehr als eine Höhle unter einem Felsvorsprung – mit der zusammengebrochenen Decke und den rauhen Felswänden erschwerte uns die Arbeit. Nun kann man nicht wie ein Berserker mit schwerem Gerät den Schutt beiseite räumen, sondern muß alles vorsichtig in Eimer, Kübel und Körbe füllen um es anschließend sorgfältig durchzusieben. Die Scherben, die wir fanden, ließen uns hoffen. Doch wir schafften es nicht. Kurz bevor wir die hintere Wand erreichten, ging die Saison schon zu Ende. Einzig die Hoffnung auf unversehrte Räume dahinter ließ uns auch dieses Jahr wieder zusammenkommen. Und nun die drohende Kürzung des Etats. Wenn wir nicht bald einen Erfolg verzeichnen konnten, würde dies unsere letzte Saison in Luxor sein.
„Wenn wir wenigstens einen Beweis hätten!“ Blümchen schenkte Kaffee nach. Die anderen seufzten. Nichts hatten wir gefunden, keine einzige Hieroglyphe, nicht ein Stückchen Wandfarbe, bloß Scherben von unglasierten oder unbemalten Tongefäßen.
„Es sieht aus, wie ein anonymes Grab.“
„Aber das gab es zu dieser Zeit nicht!“
„Das weiß ich, Anna!“
Müde und vollkommen erschöpft ließ ich mich an diesem Montagabend auf mein Bett fallen und den ersten Arbeitstag vor meinem inneren Auge Revue passieren. Nicht nur, daß mich in der Nacht Alpträume heimsuchten und ich deswegen vollkommen unausgeruht meinen Tag hinter mich brachte, nein. Auf dem Rückweg ins Winter Palace wurde mir plötzlich ganz flau. Vorsichtshalber hielt ich den Wagen an, blickte über das Land während ich über mich nachgrübelte und mich fragte, was mit mir los sei. Da vorn wurde der Tempel von Sethos I. restauriert. Sein Millionen-Jahr-Haus, Das Haus des Geistes von Men Maat Re Sethos im Haus des Amun im Westen von Uaset.
Die Archäologen hatten sich Großes vorgenommen: Nicht nur die alten Mauern sollten in ehemaliger Pracht erstrahlen – nein, sie wollten den gesamten Tempel in seinen Ursprungszustand zurückversetzen. Auf einer weiten Fläche lagen die Nilschlammziegel, mit denen dieses gewaltige Unterfangen verwirklicht werden sollte, zum Trocknen in der Sonne. Wie in alter Zeit wurden sie, aus Schlamm, gemischt mit gehäckseltem Stroh, in großen Holzrahmen geformt.
Ich tuckerte weiter, nicht weit von mir entfernt tauchten die großen, geborstenen Sitzfiguren von Pharao Amenophis III. auf, dem sichtbaren übriggebliebenen Zeugnis seines gewaltigen Totentempels. Erhaben und majestätisch blickten sie gen Osten. Mir war immer noch schlecht, deshalb rollte ich im Schrittempo auf den Parkplatz vor den sogenannten Memnonkolossen. Das Brummen und Dröhnen des alten Defender pochte unnatürlich laut in meinen Ohren, deshalb machte ich den Motor aus. Augenblicklich überkam mich das unheimliche Gefühl, jemand beobachte mich. Die Abscheulichkeit die dieses Gefühl ausstrahlte, ließ mich frösteln, Panik befiel mich, denn ich glaubte, dieser mutwilligen Bosheit würde ich mein Leben lang nicht mehr ausweichen können. Es fühlte sich schmerzhaft an, so echt, wie der Tagtraum im August, am Tag der Sonnenfinsternis.
Mit eiskalten Fingern drehte ich den Zündschlüssel um. Weg von hier, bloß weg, war mein einziger Gedanke. Zu laut für meine Ohren sprang der Motor des Wagens an. Krachend knallte ich den Rückwärtsgang rein, wendete, jagte Richtung Süden, zur Brücke.
Was war mit mir los?
So kannte ich mich nicht! Panikattacken und Alpträume! Was war das? Wem sollte ich dieses gruselige Erlebnis an den Kolossen anvertrauen? Da war doch niemand! Die Archäologen und ihre Arbeiter längst in den Feierabend entschwunden, die Kioske hatten die Läden heruntergeklappt, die Touris waren längst zum Abendessen in den Hotels oder Schiffen verschwunden. Ich war vollkommen alleine gewesen. Niemand hätte mich beobachten können!
Nein!
Das konnte ich doch niemandem erzählen! Sollte ich mich auslachen lassen? Mir spöttische Bemerkungen über den unsinnigen Fluch der Pharaonen anhören? Anna und der Fluch der Pharaonen! Paß auf, daß die Mumie dich nicht holt! Pah!
Ich bin Anna! Ich stehe das durch!
Im Winter Palace ließ ich mir ein Essen und eine Flasche Champagner aufs Zimmer bringen, pickte ohne Appetit lustlos auf dem Teller herum, schob ihn weg, ließ mich aufs Bett fallen. Krampfhaft versuchte ich den unerfreulichen Tag aus meinem Gedächtnis zu streichen, ließ meinen Blick schweifen, versuchte an nichts zu denken, horchte auf das leise Summen der Klimaanlage, betrachtete die Suite als hätte ich sie noch nie im Leben gesehen. Dabei buchte ich seit vier Jahren regelmäßig für mehrere Monate diese Räume. Die zartgelbe Tapete, die im Abendlicht leuchtete, tauchte das gemütliche Zimmer in ein warmes Licht. Das breite Polsterbett mit seinen vielen kuschligen Kissen, dessen Bezug genau zu den bis zum Boden reichenden Vorhängen und den beiden Sesseln paßte, war mir heute mehr als nur ein Ruheplatz. Es war wie eine Zufluchtsstätte.
Ich erhob mich, ging zum Kühlschrank und schenkte mir Mineralwasser ein, trank durstig, packte meine Koffer um, verstaute das nötigste in der großen Reisetasche, damit ich die Woche über drüben in dem Haus, das unser Team gemietet hatte, alles bei mir hatte, ließ mir ein Bad ein. Mit der kalten Flasche Champagner und einem Glas bewaffnet verzog ich mich ins Badzimmer, zog mich aus, betrachtete mich müde von allen Seiten in dem hohen Spiegel.
Siebenunddreißig!
Schlank, groß, langes dunkles Haar, voller Busen, knackiger Hintern. Na ja, kein Model aber voll ok. Eigentlich recht hübsch. Doch was war das? Ich entdeckte ein paar graue Haare! Du liebe Güte! Und ein paar klitzekleine Fältchen um die Augen. Auch das noch! Frustriert ließ ich mich in das Schaumbad gleiten, rutschte bis zum Hals in die Wanne, tauchte unter und blieb so lange ich Luft hatte unter Wasser. Prustend tauchte ich auf, griff nach der Flasche, entkorkte sie, schenkte mir schwungvoll ein Glas aus.
„Wechseljahre, Anna! Das ist der Anfang vom Ende!“ Ich trank einen Schluck.
„Hormonschübe! Prost! Und bald kommen Hitzewallungen! Schließlich bin ich fast vierzig! Zum Wohl! Ich bin vierzig, bitte helfen Sie mir über die Straße!“
Das zweite Glas Champagner brachte meine Gedanken erst richtig in Fahrt:
„Oder Arterienverkalkung!“, sagte ich zu dem Badeschwamm. „Jetzt geht’s rund! Mit Juchhe hinein in die Senilität! Ich werde tattrig, vergeßlich und schrumpelig und man steckt mich in ein Altersheim!“
Ich tauchte nochmal unter. Unweigerlich würde ich mein Leben in einer solchen oder ähnlichen Anstalt aushauchen. Ich stand allein in dieser Welt. Bis auf eine ältere Schwester, die seit zwanzig Jahren in Amerika wohnte, lebte niemand mehr von meiner Familie. Ich habe keine Kinder und werde nie welche bekommen. Die Panik, die sich meiner nun bemächtigte, als mir klar wurde, was vielleicht eines Tages auf mich und Georg zukommen könnte, ließ sich nur mit einem weiteren Glas Champagner betäuben.
Draußen tschilpten die Spatzen ihr Abendlied, der Verkehr von der Straße drang gedämpft zu mir hoch. Das ständige Hupen der Autos, das Klappern der Hufe und das Wiehern der Pferde, welche die Kaleschen zogen, mit denen sich die Touristen auf die romantische Art durch Luxor fahren lassen, all das war eine süße, einschläfernde wohlbekannte Melodie. Nach einem weiteren Glas drängte ich Altersheim, Wechseljahre und Hormonschübe, dieses komische Schaukeln und den ulkigen Schwindel mit Erfolg in die hintersten Schubladen meines Gehirns. Ziemlich angeschickert krabbelte ich ins Bett, zog die Decke bis zur Nase.
„Ich bin völlig überarbeitet! Das wird es sein! Ich brauch mal Urlaub!“
Als ich am nächsten Morgen mit meinem kleinen Gepäck und einem ausgewachsenen Kater im Foyer aufschlug, trat Ibrahim auf mich zu. An seiner Hand ein etwa zwölfjähriger Junge. Ich konnte mich nicht erinnern, ob das sein eigenes Kind war. Bevor ich ihn fragen konnte, begann Ibrahim eine umständliche Erklärung:
„Madame!“ Er zog das Kind näher, legte ihm von hinten beide Hände auf die Schultern. Große, schwarze Augen schauten mich vertrauensvoll an, schwarzes, gelocktes, nasses Haar umrahmte das rundliche Gesicht eines kleinen Engels. Ein bildhübsches Kind mit Stupsnase und vollen Lippen. Er müßte etwas mehr Gewicht haben, für sein Alter war zu er dünn.
„Das ist Ahmed!“ bemerkte Ibrahim. „Ein Straßenjunge, lebt wie ein Hund, schnorrt von den Touristen, klaut Brieftaschen, Obst und Brot! Ein Unwürdiger, könnte man sagen. Aber er hat ein gutes Herz. Ich habe ihn eingefangen; wie eine tolle Katze hat er sich gewehrt als ich ihn erst mal in die Badewanne gesteckt und geschrubbt habe. Er war so schmutzig, Madame Anna, das können Sie sich nicht vorstellen. Und siehe da – ich wußte gar nicht, daß er so hübsch ist, als all der Dreck herunter war.“ Er schwieg, als hätte er alles gesagt was nötig sei. Verständnislos schaute ich die beiden an. Hoffte weiterhin, daß die Kopfschmerztablette endlich ihre Aufgabe erfüllte. Oh, warum hatte ich die ganze Flasche leeren müssen?
„Ich habe mir gedacht“, fuhr Ibrahim fort, „daß Sie etwas auf ihn aufpassen könnten, ihn mitnehmen zum Camp, sein Englisch verbessern. Nehmen Sie ihn als Botenjunge, zeigen sie ihm, was richtige Arbeit ist, damit ich mich nicht mehr mit ihm herumschlagen muß, wenn er vor dem Eingang herumlungert.“
„Was soll ich mit ihm? Ibrahim, beim besten Willen! Ich habe keine Zeit für Kinder… Was soll das…“
„Er wäre gerne Page hier bei mir, Anna, aber er hat keine Umgangsformen, kennt nichts, kann nichts. Kann nichts mit ihm anfangen. Er soll meinetwegen ihre Schuhe putzen, Kaffee kochen, Frühstück machen, die Zelte und Zimmer aufräumen. Madame, tun sie es mir zu liebe, nehmen Sie ihn mit! Bringen Sie ihm bei, wie man sich benimmt. Er ist vollkommen verwildert, aber noch nicht gänzlich verdorben.“
Ich blickte zwischen den beiden überrumpelt hin und her. Ibrahims Gesicht drückte wilde Entschlossenheit aus. Ahmeds Gesicht dagegen bestand aus diesen großen, nach Liebe heischenden Augen.
„Die Zeiten des willigen Dienens, Ibrahim, sind lange vorbei! Ich mache doch so ein Kind nicht zu meinem Leibsklaven! Was denken Sie sich! Er gehört in eine Schule, in eine Familie. Er braucht anständiges Essen, eine angemessene Erziehung! Nehmen Sie ihn doch mit nach Hause! Sie haben doch gewiß Kinder. Da kann er spielen, zanken, was auch immer so ein Zwerg macht!“
„Es gibt Menschen, Madame Anna, denen verwehrt Allah dieses großmütige, wunderbare Geschenk …“ Einen Augenblick lang erkannte ich in Ibrahims Gesicht einen Hauch Schwermut, schon warf er temperamentvoll die Hände in die Luft: „Wer kümmert sich schon um ein solches Subjekt? Hä! Wer würde so einen Taugenichts in sein Haus lassen!“ Er schüttelte den Jungen ordentlich durch, der diese Behandlung klaglos über sich ergehen ließ.
„Lassen Sie ihn doch los!“, schimpfte ich empört und beugte mich zu dem Kleinen hin. Ibrahim ließ den Jungen los, der legte vertrauensvoll seine dünnen Ärmchen um meinen Hals und drückte sein Gesicht an meine Wange. Du lieber Gott! Hör auf damit! Was bist du ein goldiger Fratz!
Mit brummendem Schädel erhob ich mich wieder.