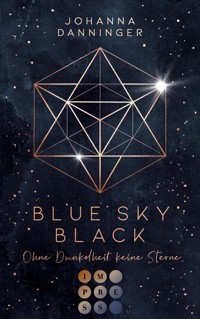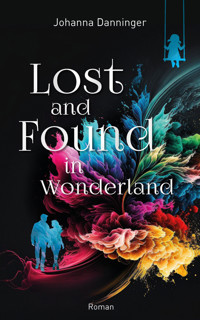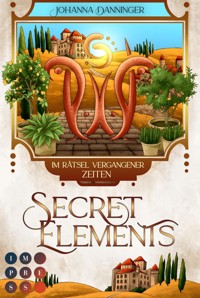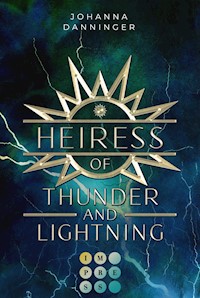12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Das Licht besiegt die Dunkelheit, wenn vereint, was einst entzweit.« Lucia hätte sich nicht träumen lassen, dass ihr Leben einmal von einer magischen Prophezeiung bestimmt werden würde. Doch seit sie einen schweren Unfall wie durch ein Wunder überlebt hat, muss sie sich einer Welt voller Magie und Dämonen stellen. Denn die Lichtbringerin in ihr ist erwacht und nun ist sie Teil eines uralten Kriegs zwischen Gut und Böse. Während Lucia sich gegen ihr neues Schicksal sträubt, versuchen gleich zwei Männer sie für sich zu gewinnen. Ihr Mentor Rakesh bringt ihr Herz immer wieder zum Rasen und als wäre das nicht genug, taucht ein fremder Lichtkrieger in der Stadt auf, der auf mysteriöse Weise mit Lucia verbunden zu sein scheint … Magisch-romantische Urban Fantasy zum Niederknien! Nach dem großen Erfolg der »Secret Elements«-Reihe entführt die Bestseller-Autorin Johanna Danninger ihre Leser*innen nun in die grandiose Welt der Lichtbringer. Eine Fantasy-Liebesgeschichte in drei Bänden voll einzigartiger Figuren und magischer Wesen, die dich sofort in ihren Bann ziehen. Leser*innen über die Fantasy-Buchreihe »Die Lichtbringerin«: »Überraschend anders.« »Klare Leseempfehlung.« »Gerne mehr davon.« »Mir haben die kleinen Details sehr gefallen.« »Das Buch war von Anfang an spannend und die Autorin hat es verstanden, die Spannung bis zum Ende zu halten.« »Richtig nervenraubend und gut gemacht.« //Dies ist ein Sammelband der magischen Fantasy-Buchserie »Die Lichtbringerin«. Er enthält alle drei Bände der Trilogie: -- Die Lichtbringerin 1 -- Die Lichtbringerin 2 -- Die Lichtbringerin 3// Diese Reihe ist abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
www.impressbooks.de Die Macht der Gefühle
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Impress Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2020 Text © Johanna Danninger, 2019, 2020 Lektorat: Ulrike Schuldes Coverbild: shutterstock.com / © YuriyZhuravov / © Cienpies Design / © Bokeh Blur Background / © Timchig Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-60586-0www.carlsen.de
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Johanna Danninger
Die Lichtbringerin 1
**Wirke Magie und werde zur Lichtbringerin**Eigentlich hätte Lucia heute Nacht sterben müssen. Doch zu ihrer Überraschung trägt sie von dem schweren Autounfall nur ein paar blaue Flecken davon. Von jetzt auf gleich stellt sich ihr ein junger Mann namens Rakesh als ihr »neuer Mentor« vor. Sie soll über besondere Fähigkeiten verfügen, die ihr erlauben übernatürliche Wesen wahrzunehmen und selbst Magie anzuwenden. Für Lucia steht fest: Rakesh spinnt! Auf gar keinen Fall will sie sich auf diesen charismatischen, gut aussehenden Kerl … Unsinn einlassen. Aber dem eigenen Schicksal kann sie nicht entkommen. Unversehens befindet sich Lucia in einem Kampf zwischen schwarzen Magiern, Dämonen und Lichtkriegern.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© Johanna Danninger
Johanna Danninger, geboren 1985, lebt als Krankenschwester mit ihrem Mann, einem Hund und zwei Katzen umringt von Wiesen und Feldern im schönen Niederbayern. Schon als Kind dachte sie sich in ihre eigenen Geschichten hinein. Seit sie 2013 den Schritt in das Autorenleben wagte, kann sie sich ein Leben ohne Tastatur und Textprogramm gar nicht mehr vorstellen. Und in ihrem Kopf schwirren noch zahlreiche weitere Ideen, die nur darauf warten endlich aufgeschrieben zu werden!
Menschen fürchten sich vor Wundern,
weil sie ihnen aufzeigen,
dass sie doch nicht so viel von dieser Welt verstehen,
wie sie es gern hätten.
Kapitel 1
Im Stockwerk unter mir donnerte der Bass in einem hektischen Rhythmus. Ich konnte die Vibration deutlich durch die Bodenfliesen des Badezimmers spüren.
Gott, ist mir schlecht …
Der letzte Wodka war eindeutig zu viel gewesen. Ich griff nach der Klospülung und stemmte mich ächzend auf die Füße. Um den bitteren Geschmack schnellstmöglich loszuwerden, wankte ich zum Waschbecken. Mein Spiegelbild sah genauso aus, wie ich mich gerade fühlte: elend und im wahrsten Sinne ausgekotzt.
Mein Mascara war verlaufen und formte dunkle Ringe um meine blauen Augen. Außerdem hatte sich der Klebestreifen meiner künstlichen Wimpern auf einer Seite gelöst und stand sichtbar vom Lid ab. Meine Hochsteckfrisur war vollkommen zerzaust. Das alles und meine kreidebleiche Gesichtsfarbe verlieh mir das Aussehen eines Zombies. Schade, dass heute nicht Halloween war, sonst wäre ich damit vermutlich noch Kostümkönigin geworden.
Ich drehte den Wasserhahn auf und spülte mir kräftig den Mund aus. Zum Glück flaute die Übelkeit nun deutlich ab, nachdem ich meinen Mageninhalt unfreiwillig losgeworden war.
Scheiß Alkohol. Das sollte mir eine Lehre sein.
Während ich mir mit einem Handtuch das Gesicht abwischte, erklang lautes Gegröle draußen auf dem Flur. Irgendwas schepperte, gefolgt von mehrstimmigem Gelächter. Ich glaubte, die empörten Rufe des Geburtstagskindes zu hören. Tja, wenn man seinen achtzehnten Geburtstag zu Hause feierte, durfte man sich nicht wundern, wenn etwas zu Bruch ging. Ob Martins Eltern damit gerechnet hatten, als sie ihrem Sohn wohlwollend das Haus überließen, während sie übers Wochenende in die Berge fuhren? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte auch niemand gedacht, dass sich zu den geladenen Gästen noch dreimal so viele Leute dazugesellen würden, die Martin gar nicht kannte. Aber das hatte er sich wohl selbst zuzuschreiben, wenn er via Social Network zum Feiern aufrief und auch noch seine Adresse nannte. Inzwischen war ja bekannt, wie so was enden konnte.
Ich fischte nach meiner Handtasche, die ich vorher in meiner Eile in eine Ecke gepfeffert hatte. Sorgfältig tupfte ich einen winzigen Klecks Wimpernkleber auf ein Wattestäbchen und fixierte das gelöste Ende wieder an meinem Augenwinkel. Ich zog einen neuen Lidstrich und tuschte meine verlängerten Wimpern. Dann verdeckte ich meine Leichenblässe unter einer großzügigen Schicht Make-up. Noch ein wenig Rouge, und schon sah ich wieder aus wie eine Lebende.
Als ich gerade anfing, die Haarnadeln aus meiner Vogelnestfrisur zu ziehen, klopfte jemand fest gegen die Badezimmertür. Ich reagierte nicht darauf. Erst, als heftig an der Türklinke gerüttelt wurde, knurrte ich: »Besetzt, verdammt!«
»Lucia?«, hörte ich eine gedämpfte Stimme. »Lucy, Babe, ich bin’s.«
Simon? Na, toll.
»Moment!«, rief ich und schüttelte hastig meine Haare aus.
Simon sollte mich keinesfalls derart ungepflegt sehen. Wir waren erst seit drei Wochen ein Paar, und ich hatte schon in der Schule heftig für ihn geschwärmt. Er war im Jahrgang über mir gewesen und nach seinem Abschluss hatte ich ihn aus den Augen verloren. Bis wir uns vor knapp einem Monat auf einer Party wiederbegegnet waren. Ich hatte mich schwer ins Zeug legen müssen, um an diesem Abend die Konkurrenz auszubooten. Simon war begehrt. Die Mädchen hatten ihm schon immer scharenweise zu Füßen gelegen. Der blonde Sunnyboy war mit Abstand der heißeste Junge der ganzen Schule gewesen und hatte während seiner Ausbildung nicht an Attraktivität verloren. Im Gegenteil. Er lernte Bankkaufmann und sah in seinem schwarzen Anzug einfach scharf aus.
Eilig bürstete ich mein wasserstoffblondes Haar, das mir mit Extensions beinahe bis zur Taille reichte. Leider waren meine echten Haare vom vielen Blondieren so strapaziert, dass die Spitzen es immer nur knapp über meine Schulter schafften, bevor sie abbrachen.
Ich überprüfte noch einmal mein Spiegelbild, mit dem ich nun weitgehend zufrieden war, und zog die Badezimmertür auf. Simon lehnte im Türrahmen. Er legte den Kopf schräg und ließ seinen Blick über mich gleiten.
»Na, hast du mich vermisst?«, fragte er neckisch. Er stieß sich vom Rahmen ab und trat auf mich zu. In seinen hellen Augen war der Alkoholkonsum des Abends deutlich abzulesen. Trotzdem sah er immer noch göttlich aus.
An meiner Zunge haftete nach wie vor der bittere Geschmack von Galle, darum wandte ich mein Gesicht ab, als Simon mich an sich zog, um mich zu küssen. Er senkte seine Lippen auf meine Halsbeuge und entfachte damit ein angenehmes Kribbeln auf meiner Haut. Leider meldete sich gleichzeitig mein gereizter Magen zurück und eine neue Welle der Übelkeit überkam mich. Gequält wollte ich Simon von mir drücken, doch er presste sich nur noch enger an mich.
»Warte«, bat ich und wand mich unwohl in seinem Griff. »Mir ist schlecht.«
»Das wird gleich wieder«, murmelte er nur.
Dann suchte er abermals nach meinen Lippen, doch ich drehte mich vehement von ihm weg. »Simon, nicht. Ich hab grad …«
»Ist doch egal«, raunte er. Seine Hand wanderte in meinen Nacken und zwang mich schließlich stillzuhalten. Obwohl ich mich immer noch wehrte, gab er mir einen harten Kuss und packte mich fordernd am Hintern.
Seine Alkoholfahne machte das Ganze nicht besser. Angewidert stemmte ich mich gegen Simon, der einfach nicht aufhören wollte, und zwickte ihn kurzerhand in die empfindliche Haut hinter dem Ohr.
»Au!«, rief er und wich endlich ein Stück zurück. Gleich darauf erschien ein laszives Grinsen auf seinem Gesicht. »Ich wusste gar nicht, dass du auf so was stehst.«
War das etwa sein Ernst?
Ich rollte mit den Augen und befreite mich aus seiner Umarmung. »Momentan steh ich auf gar nichts, Simon. Mir ist einfach schlecht.«
»Okay, verstehe.« Er nickte. Dann trat er hinter mich und schlang seine Arme locker um mich. »Ich hol dir eine Cola, wenn du magst.«
»Klingt gut«, antwortete ich matt.
»Gegenüber ist ein Schlafzimmer. Da kannst du dich hinsetzen und auf mich warten.«
Was zum …?
»Sag mal, geht’s noch?« Wütend schüttelte ich seine Arme ab und schnappte meine Handtasche vom Waschtisch. Ohne mich zu Simon umzudrehen, stapfte ich aus dem Bad. »Du spinnst doch!«
Ich zog heftig die Tür hinter mir zu. Mir war schwindelig, darum stützte ich mich mit einer Hand an der Wand ab, bevor ich mir umständlich einen Weg zur Treppe bahnte. Überall standen Leute herum, die sich in das Obergeschoss zurückgezogen hatten, um in ruhigerer Umgebung zu plaudern oder herumzuknutschen.
Simon machte sich nicht die Mühe, mir zu folgen. Ich war stinksauer, dass sich mein Freund nicht im Geringsten darum scherte, wie es mir ging. Hauptsache, er bekam seinen Spaß! Kerle waren doch echt alle gleich.
Vorsichtig stieg ich die Treppe hinunter. Eigentlich hätte ich gar nicht so aufpassen müssen, denn auch hier standen so viele Leute herum, dass ich nicht tief fallen konnte. Zwei ehemalige Klassenkameraden versperrten mir auf halber Höhe den Weg und wollten mich zu einem Schnaps überreden. Allein der Gedanke daran ließ mich erneut würgen. Ich ertrug ihr spöttisches Lachen über mein entsetztes Kopfschütteln und ging weiter.
Die Musik im Erdgeschoss war abartig laut. Mich wunderte es, dass noch keiner der Nachbarn die Polizei geholt hatte. Immerhin war es inzwischen weit nach Mitternacht. So viel Toleranz hätte ich in dieser gediegenen Bamberger Vorstadtsiedlung nicht erwartet.
Wo versteckte sich eigentlich Alina? Ich hatte sie zuletzt bei einem heftigen Flirt mit einem Typen gesehen, den ich nicht kannte. Vermutlich hatten sich die beiden in eine ruhigere Ecke zurückgezogen. Es war fraglich, ob ich meine beste Freundin heute überhaupt noch einmal zu Gesicht bekommen würde.
Das tosende Zentrum der Geburtstagsparty befand sich im Wohnzimmer. Ich quetschte mich an einer Gruppe vorbei, die gerade einen der Jungs beim Trichtersaufen anfeuerte, und gelangte in die Küche. Jeder Zentimeter der Arbeitsflächen war mit Pappbechern und Flaschen in sämtlichen Formen und Farben vollgestellt. Trotzdem hielten sich nur überraschend wenige Leute hier auf. Es dauerte eine Weile, bis ich in dem Chaos einen frischen Becher fand. Ich füllte Cola hinein und lehnte mich dann an einen hohen Schrank der Küchenzeile. Die süße Brühe tat gut. Ich hoffte, dass der Zucker meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen würde, denn meine Knie fühlten sich immer noch zittrig an. Die Euphorie meines Alkoholrauschs hatte sich in eine deprimierende Müdigkeit verwandelt, aber wenigstens drehte sich mein Magen nicht mehr um die eigene Achse.
Während ich an der Cola nippte, ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. In ordentlichem Zustand war diese Küche bestimmt sehr schön. Weiße Fronten im Landhausstil, dunkle Arbeitsplatten aus Stein und ein großer frei stehender Küchenblock mit einer Dunstabzugshaube darüber. Auch das restliche Haus gefiel mir sehr gut mit seiner großzügigen Raumaufteilung und den geschmackvollen Möbeln.
Plötzlich kam Martin hereingestolpert. Sein dunkelblondes Haar stand ihm wirr vom Kopf ab und seine Brille hing schief auf der Nase. Er trug einen Eimer mit sich, dessen Inhalt er in einen riesigen Müllsack schüttete. Es klang verdächtig nach Porzellanscherben. Martin sah sich stirnrunzelnd das Chaos in der Küche an. Seufzend rückte er seine Brille zurecht und begann mit zusammengepressten Lippen die benutzten Pappbecher übereinanderzustapeln.
Ich beobachtete ihn eine Weile lang. Dann leerte ich meine Cola und fing ebenfalls an, die Becher einzusammeln. Viele waren noch nicht ganz leer, und ich musste zuerst die Spüle freiräumen, um die Getränkereste hineinschütten zu können. Martin sah mich überrascht an.
»Danke, das ist nett von dir«, sagte er.
»Kein Problem«, erwiderte ich und lächelte freundlich. »Aber dir ist hoffentlich klar, dass es in zehn Minuten wieder genauso ausschaut?«
Er nickte und seufzte schwer. »Tja, ich hab mir das heute echt anders vorgestellt.«
Wir grinsten uns an und widmeten uns wieder der Becherstapelei. Martin war nett. Das war er schon immer gewesen, aber obwohl wir in dieselbe Klasse gegangen waren, hatten wir eigentlich nie viel miteinander zu tun gehabt. Er war immer der stille Typ gewesen, der kaum auffiel, während ich an vorderster Front in der Klasse mitgemischt hatte. Wir bewegten uns zwar im gleichen Freundeskreis, aber ich konnte mich nicht erinnern, je ein vernünftiges Gespräch mit ihm geführt zu haben. Eigentlich seltsam.
»Ihr habt ein sehr schönes Haus«, sagte ich unvermittelt. »Wirklich toll.«
Martin zuckte mit den Schultern. »Findest du? Verglichen mit unseren Nachbarn ist unser Haus eher normal.«
»Und verglichen mit unserem Plattenbau ist es ein Palast«, erwiderte ich.
Die Worte waren mir einfach rausgerutscht. Ich biss mir verlegen auf die Unterlippe. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Martin mich betroffen musterte. Hastig wechselte ich das Thema.
»Und wie fühlst du dich so mit achtzehn?«, fragte ich ihn.
»Genau wie mit siebzehn«, sagte er. »Zumindest hab ich noch keinen Unterschied bemerkt. Bis auf die Sache mit dem Führerschein natürlich. Das erste Mal ganz allein Auto fahren war schon was Besonderes.«
Ich nickte versonnen. »Das kann ich mir gut vorstellen.«
»Hast du deinen Schein noch nicht gemacht?« Martin stellte die angebrochenen Schnapsflaschen in einer Reihe auf den Küchenblock. »Dein achtzehnter war doch schon im Januar.«
Ich blickte nicht von meiner Arbeit auf und versuchte möglichst unbesorgt zu klingen. »Mit meinem Azubi-Gehalt war der Führerschein nicht drin, aber im Sommer bin ich fertig. Dann geht’s mit den Fahrstunden los.«
Obwohl ich mich dezent abwandte, wusste ich, dass Martin mich wieder betreten anschaute. Ich hasste solche mitleidsvollen Blicke wie die Pest. Was sollte das? Ich war schließlich kein verwahrlostes Straßenkind. Ich wohnte zwar nicht in einem schicken Haus wie diesem, aber es gab schlimmere Lebensumstände als meine.
»Du machst eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, oder?«, fragte Martin schließlich.
»Meine Güte, das klingt immer so offiziell«, sagte ich schmunzelnd, froh über den Themenwechsel. »Ich lerne Verkäuferin. In einem Schuhladen. Nicht mehr und nicht weniger. Und der Job ist in Ordnung. Vor allem wegen der tollen Mitarbeiterrabatte.«
Martin lachte, aber ich spürte seinen Blick nachdenklich auf mir ruhen, während ich die leeren Plastikflaschen einsammelte.
»Darf ich dich was fragen, Lucia?«
»Klar.«
Er räusperte sich. »Warum bist du eigentlich mit Simon zusammen?«
»Warum?« Ich drehte mich überrascht zu ihm. »Wie meinst du das?«
»Genauso, wie ich gefragt habe.«
Martin wirkte ehrlich interessiert, aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie angegriffen.
»Na, er ist witzig und sieht umwerfend aus«, zählte ich auf, »er lernt einen Beruf mit Zukunft, er fährt einen Audi und ich bin schon lange verknallt in …«
Ich stoppte, weil ich merkte, wie bescheuert meine Argumente klangen. Tatsache war, dass es mir selbst nicht ganz klar war, warum ich mit Simon zusammen war. Die ernüchternde Wahrheit war nämlich, dass wir absolut keine Gemeinsamkeiten hatten.
Peinlich berührt wich ich Martins Blick aus. »Mann, jetzt denkst du bestimmt, dass ich eine oberflächliche Tussi bin.«
Martin stemmte sich auf den Küchenblock und setzte sich mir gegenüber auf die steinerne Arbeitsplatte. »Ich weiß, dass du das nicht bist. Aber ich habe mich schon immer gefragt, warum du so tust, als wärst du es.«
Überrumpelt sah ich ihn an. Er lächelte freundlich. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und hob kritisch eine Braue.
»Was wird das hier?«, fragte ich. »Ein psychologisches Gespräch?«
»Nein, es ist nur persönliche Neugier«, antwortete er schmunzelnd.
Eigentlich hatte ich immer geglaubt, Martin wäre ein schüchterner Kerl. Dass er mich jetzt so offen auf meine Beziehung ansprach, überforderte mich. Was ging ihn das alles an?
»Du musst mir nicht antworten, Lucia«, sagte er, als hätte er meine Gedanken erraten. »Tut mir leid, wenn ich eine Grenze überschritten habe.«
Ich kaute unschlüssig auf der Innenseite meiner Wange, während ich Martin nachdenklich betrachtete.
»Lucia!«, erschallte es plötzlich. »Du bist ja noch da!«
Ich sah an Martin vorbei zu dem Mädchen, das eben die Küche betreten hatte. Ich kannte sie nur vom Sehen, darum überraschte es mich, dass sie mich direkt angesprochen hatte. Sie starrte mich völlig entgeistert an, während ihre Hand über der Wodkaflasche schwebte. Bevor ich nachhaken konnte, sagte sie: »Äh, viel Spaß noch!«, machte auf dem Absatz kehrt und huschte aus der Küche, ohne ihren Becher gefüllt zu haben. Das war nicht nur merkwürdig, sondern äußerst verdächtig.
Was ist da los?
Unwillkürlich setzte ich mich in Bewegung und eilte ihr hinterher. Ich hörte, dass Martin mir noch etwas nachrief, aber ich heftete meinen Blick stur auf den wippenden Pferdeschwanz des Mädchens, um es in dem Gedränge nicht aus den Augen zu verlieren. Sie merkte nicht, dass ich ihr folgte, während sie sich hastig durch den Flur quetschte und die Treppe hinaufrannte.
Im Flur des Obergeschosses holte ich das Mädchen schließlich ein und sah sofort, warum sie sich so beeilt hatte: Sie wollte offenbar Simon warnen, der neben der Badezimmertür stand und hemmungslos und in aller Öffentlichkeit mit einem anderen Mädchen knutschte. Es war offensichtlich die Freundin der Pferdeschwanz-Tussi.
Meine Schockstarre hielt nicht lange an. Mit einem zornigen Knurren schubste ich das Mädchen beiseite und hatte die beiden nach wenigen Schritten erreicht. Ich fackelte nicht lange, packte die dumme Kuh an den Haaren und zerrte sie heftig von Simon weg. Sie beschwerte sich mit einem spitzen Aufschrei, verstummte aber sofort, als sie mich erkannte. Simon riss die Augen auf und hob ergeben die Hände.
»Babe! Es ist nicht so, wie es …«
Weiter kam er nicht, denn da traf auch schon meine Faust auf seine Nase. Er heulte auf und taumelte zurück, die Hände schmerzerfüllt auf sein Gesicht gepresst.
»Hast du sie noch alle?«, stieß er hervor.
Das wagte er mich zu fragen?
Meine Faust war bereits zu einer Antwort erhoben, als jemand von hinten mein Handgelenk packte und mich aufhielt. Ich fuhr heftig herum.
»Nicht«, sagte Martin mit beschwichtigendem Tonfall. »Das ist er doch gar nicht wert.«
Ich war nicht fähig, irgendwas zu antworten, sondern schüttelte nur Martins Hand ab und stapfte davon. Um mich herum brach Jubel aus. Ein paar Jungs klopften mir auf die Schulter und gratulierten mir zu meiner sauberen Rechten. Ich kämpfte verbissen gegen die Tränen der Wut und stolperte blindlings die Treppe hinunter. Rücksichtlos drängte ich mich durch die Menge und ignorierte die empörten Bemerkungen der angerempelten Gäste.
Ich wollte nur noch weg hier. Weg von diesem miesen Kerl, dem ich hoffentlich die Nase gebrochen hatte.
Als ich endlich durch die Haustür ins Freie stürzte, atmete ich tief durch und die kühle Nachtluft füllte wohltuend meine Lungen. Jemand rief nach mir, doch ich verlangsamte meine Schritte nicht, sondern rannte durch den Vorgarten hinaus auf den Gehweg.
Verbittert schritt ich die schwach beleuchtete Straße entlang und schlang fröstelnd meine Arme um mich. Obwohl es bereits Ende April war, kamen mir die nächtlichen Temperaturen noch eisig kalt vor. Meine Jacke lag irgendwo im Haus, doch ich würde lieber erfrieren, als noch einmal umzudrehen.
Scheiße.
Ich war gründlich enttäuscht. Wieder einmal hatte sich bestätigt, dass ich von meinen Mitmenschen nichts Besseres erwarten konnte. Ich hatte vor langer Zeit damit aufgehört, jemand anderem als mir selbst zu vertrauen. Warum war ich bloß auf Simon hereingefallen?
Ich war wütend. Wütend auf mich selbst, dass ich diesen Idioten tatsächlich als meinen festen Freund bezeichnet hatte. Wirklich interessant, dass ich zehn Minuten vor dem Eklat noch über diese Tatsache nachgedacht hatte. Hatte Martin mich vielleicht danach gefragt, weil er zu diesem Zeitpunkt längst wusste, dass Simon mit einer anderen zugange war?
Egal. Eigentlich sollte ich froh sein. Wenn das heute Abend nicht passiert wäre, hätte ich nur noch mehr Zeit mit diesem Kerl verbracht, bis mir die Augen geöffnet worden wären. Im schlimmsten Fall hätte ich sogar noch tiefere Gefühle für ihn entwickelt und wäre ernsthaft verletzt worden.
Genau. Besser so als anders.
Die Straße führte leicht bergab. Die Wohnsiedlung lag ruhig und friedlich vor mir. Hinter mir konnte ich immer noch die dröhnenden Bässe der Party hören, doch mit jedem Schritt wurden sie leiser.
Wie sollte ich jetzt eigentlich nach Hause kommen?
Ich überlegte kurz, mir ein Taxi zu rufen, überprüfte dann aber doch lieber mit meinem Smartphone den Busfahrplan. Die nächste Haltestelle war knapp anderthalb Kilometer entfernt und laut Fahrplan sollte dort in einer Stunde ein Nachtbus abfahren. Das klang nach einer vernünftigen und kostengünstigen Alternative zum Taxi.
Ich prägte mir den Weg zur Haltestelle ein und steckte mein Smartphone in meine Tasche. Der Spaziergang würde mir bestimmt guttun.
Eigentlich konnte ich solche Besäufnisse nicht ausstehen, weshalb die meisten meiner Freunde auch schon gar nicht mehr versuchten, mich zum Trinken zu animieren. Heute hatte ich mich von Simon mitreißen lassen – und was hatte ich davon?
Simon …
Mir war völlig unklar, was in seinem Hirn eigentlich vorging. Offenbar nicht besonders viel. Die größere Aktivität fand wohl in tieferen Regionen seines Körpers statt. Wie lange hatte ich in der Küche gestanden? Vielleicht zwanzig Minuten? Er musste hinter mir aus dem Bad gegangen sein und sich die nächstbeste Tusse geschnappt haben, um ihr die Zunge in den Hals zu stecken.
Wahnsinn.
Ich kickte einen Kieselstein vom Gehweg. Na wenigstens hatte ich mich heute für flache Schuhe entschieden.
Inzwischen umgab mich nächtliche Stille. Die Geräusche der Party waren gänzlich verklungen. Nur das Licht der Straßenlaternen begleitete mich auf meinem Weg. Obwohl ich mich in dieser Gegend relativ sicher fühlte, beobachtete ich wachsam die Umgebung. So wütend, wie ich im Augenblick war, sollte sich jemand, der mir hier draußen begegnete, aber eher vor mir in Acht nehmen. Ich könnte glatt noch einem Zweiten die Nase brechen. Es sollte bloß niemand glauben, ich wäre ein leichtes Opfer!
Ich spitzte die Ohren, weil ich hinter mir das Aufheulen eines Motors vernahm. Schon von Weitem war zu hören, dass der Wagen viel zu schnell fuhr. Laute Musik dröhnte durch die Scheiben. Als das Auto ungefähr auf meiner Höhe war, kreischten die Reifen ohrenbetäubend über den Asphalt. Erschrocken wandte ich mich um und sah, dass der Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das Auto schleuderte und drehte sich mitten auf der Kreuzung vor mir um die eigene Achse. Dann waren die Scheinwerfer schlagartig direkt auf mich gerichtet.
Auf einmal schien alles um mich herum nur noch in Zeitlupe abzulaufen.
Ich starrte geblendet in das grelle Licht, während der Wagen in hoher Geschwindigkeit auf mich zuraste. Die Reifen blockierten. Aber warum wurde das Auto nicht langsamer?
Viel zu spät setzte ich mich in Bewegung. Mein Verstand war immer noch dabei, die Situation zu erfassen, während ich instinktiv meine Beinmuskeln anspannte und sprang. So entging ich zwar der Motorhaube, aber da sich der Wagen nach wie vor um die eigene Achse drehte, traf mich wohl der hintere Kotflügel. Ich spürte einen heftigen Schlag gegen meine Hüfte, der mich zur Seite katapultierte.
Es war merkwürdig, aber während ich in hohem Bogen durch die Luft flog, schien die Zeit sogar noch langsamer zu vergehen als zuvor. Ich konnte alle Einzelheiten der asphaltierten Straße erfassen, die unaufhaltsam auf mich zukam. Kleine Steinchen lagen dort. Und ein einzelnes Blatt von irgendeinem Baum. Ich sah sogar die feinen Äderchen dieses Blattes.
Dann wurde es stockdunkel.
Stille.
Wohltuende, friedliche Stille in vollkommener Dunkelheit. Es war angenehm. Ich fühlte mich leicht und unbeschwert.
Wie lange war ich schon hier?
Ich verwarf die Frage gleich wieder, denn ich wusste plötzlich, dass hier keine Zeit existierte. Zumindest nicht in der Form, wie ich sie kannte. Da, wo ich jetzt war, spielte Zeit keine Rolle.
Ich war tot.
Daran bestand überhaupt kein Zweifel. Ich wusste es einfach, tief in meinem Innersten.
Und es fühlte sich gut an.
Komisch, eigentlich. Ich war doch noch so jung. Da sollte ich doch zumindest traurig sein, wenn ich gestorben war? Dennoch war es in Ordnung. Vielleicht, weil es ohnehin nicht zu ändern war.
Ein leuchtender Punkt flammte vor mir auf. Er war wunderschön. Schöner als alles, was ich je gesehen hatte. Voller Freude schwebte ich auf dieses herrliche Licht zu. Ich wusste, dass etwas Unvergleichliches dort auf mich wartete, auch wenn ich nicht benennen konnte, was es war.
Mein Herz drohte vor reinster Wonne zu zerspringen, als das durchdringende Licht mich schließlich vollständig umhüllte.
Ich wollte noch tiefer eintauchen, wollte komplett mit diesem Gefühl der absoluten Geborgenheit verschmelzen, als ich plötzlich einen Widerstand spürte. Irgendetwas hielt mich fest. Als würde ich an einem Seil hängen, das ich nicht lösen konnte.
»Es ist Zeit, Seraya.«
»Was? Wofür ist es Zeit?«
»Zeit, aufzuwachen.«
Das unsichtbare Seil zog mich fort. Fort von dem Licht und dem wundervollen Gefühl der Glückseligkeit.
»Nein, nein, nein!«
Ich stemmte mich dagegen, warf mich gegen die Kraft, die mich unablässig zurück in die Dunkelheit zog.
»Bitte, nicht! Bitte, schick mich nicht fort!«
»Hab keine Angst, Seraya. Wir sind immer bei dir.«
Schmerz.
Ich bestand nur noch aus einem einzigen tiefen Schmerz.
Entsetzt riss ich die Augen auf, doch ich konnte fast nichts sehen. Dämmriges Licht fiel auf mich herab. Dazwischen verschwommene Schemen. Zwei Menschen, die sich über mich beugten.
»Willkommen zurück!«, sagte eine junge Frau. Sie klang fröhlich, richtig erfreut, während ich vor Schmerzen kaum atmen konnte.
»Ganz ruhig«, sagte eine sanfte Männerstimme. »Wir sind hier, um dir zu helfen.«
Statt einer Antwort drang nur ein gurgelnder Laut aus meiner Kehle. Ich konnte immer noch nicht klar sehen. Nur verzerrte Umrisse zwischen Licht und Schatten. Trotzdem registrierte ich, dass ich auf kaltem Asphaltboden lag.
»Ich lass sie wohl besser schlafen, bis das Schlimmste vorbei ist«, sagte der Mann.
»Ja, das scheint mir am vernünftigsten zu sein«, bestätigte die Frau.
Etwas berührte mich an der Stirn. Der anfangs kaum wahrnehmbare Druck wurde plötzlich zu einem unerträglichen Feuer, das direkt in meinem Kopf zu wüten schien.
Ich wollte schreien. Wollte dieser unerträglichen Pein entfliehen. Doch mein Körper reagierte nicht auf meine Befehle.
Ein goldenes Licht flammte auf. Gleichzeitig löste sich jeglicher Schmerz im Nichts auf und meine Wahrnehmung tauchte in die Tiefen einer erlösenden Bewusstlosigkeit.
Kapitel 2
Die Melodie meines Handyweckers holte mich gnadenlos aus dem Schlaf. Ohne den Kopf aus dem weichen Kissen zu heben, tastete ich über den Nachttisch und drückte die Snooze-Taste. Anschließend ließ ich meine Hand kraftlos auf dem Handy liegen.
Warum klingelte mein Wecker überhaupt? Heute war doch Sonntag. Hatte ich versehentlich die Einstellungen verändert?
Ich brummte und drehte meinen Kopf zur Seite, der sich umgehend mit einem unangenehmen Pochen bedankte. Klasse. Da machte sich wohl ein mächtiger Kater bemerkbar.
Gott, was für eine beschissene Party …
Aber was war gestern überhaupt passiert? Ich blinzelte müde zur Decke meines Zimmers hinauf und versuchte mir den vergangenen Abend ins Gedächtnis zu rufen.
Die Feier hatte eigentlich ganz nett angefangen, bis mein persönlicher Alkoholkonsum leider eskaliert war. Ich erinnerte mich noch ganz genau an diesen einen Schluck Wodka, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Zum Glück hatte ich es noch rechtzeitig ins Bad geschafft.
Tja, und danach?
Simon! Dieser Mistkerl hatte mich eiskalt betrogen, obwohl ich nur ein paar Meter entfernt von ihm in der Küche stand. Das war doch echt nicht zu fassen!
Mein Handywecker meldete sich wieder. Diesmal stellte ich den Alarm ganz ab. Ich hatte eine ganze Menge Nachrichten auf dem Startbildschirm. Die meisten waren von Alina.
10:25 Uhr: »Hab das von Simon gehört. Tut mir leid, Süße. Ruf mich an, wenn du wach bist.«
13:52 Uhr: »Huuuhuuu! Schläfst du immer noch?«
15:29 Uhr: »Alter, das kann doch nicht sein. Geh endlich an dein Telefon!«
16:12 Uhr: »Muss ich mir Sorgen machen?«
18:41 Uhr: »Roland sagt, du bist daheim. Also melde dich verdammt noch mal bei mir!!!«
Ratlos betrachtete ich den Chatverlauf, bis ich an einem kleinen, aber bedeutsamen Wort hängen blieb, das über den Nachrichten stand.
Gestern.
Das ergab überhaupt keinen Sinn. Warum war ich …? Oh mein Gott.
Ich tippte auf den Home-Button meines Handys und stierte fassungslos auf den Startbildschirm. Da stand es, weiß auf dunkelblauem Hintergrund: Heute war Montag. Sieben Uhr und sechs Minuten.
Mit einem Ruck fuhr ich in die Höhe und schnappte sofort nach Luft. Die stechenden Schmerzen in meinem Brustkorb trafen mich völlig unvorbereitet. Ebenso das Brennen an meinen Knien und Unterarmen. Das Handy glitt aus meiner Hand und fiel neben mir aufs Bett, während ich in gekrümmter Position verharrte, bis die Schmerzen einigermaßen abgeflaut waren.
Was um alles in der Welt war hier los?
Verwirrt blickte ich an mir herab und sah, dass ich nur Unterwäsche anhatte. Die von Samstag, wohlgemerkt. Vorsichtig zog ich die Decke beiseite und starrte meine aufgeschürften Knie an. Ein schmaler Streifen Schorf zog sich über mein rechtes Schienbein und endete in einem geschwollenen Knöchel, der blaugrün verfärbt war.
Vorsichtig setzte ich mich auf den Bettrand und betrachtete schockiert mein Spiegelbild im Kleiderschrank gegenüber. Mein rechter Brustkorb war ein einziger Bluterguss in allen möglichen Farben. Meine Ellbogen und die Unterarme sahen ähnlich mitgenommen aus wie meine Knie. An meiner Hüfte entdeckte ich eine weitere große Schürfwunde.
Um Himmels willen! Was war mit mir geschehen?
Ich wusste noch, wie ich wutentbrannt Martins Haus verlassen hatte. Dann war ich allein die Straße entlanggelaufen. Und dann …?
Nichts. Absolut gar nichts. Völliger Blackout, bis zu dem Moment, als mein Handywecker mich aus dem Schlaf riss.
Meine Gedanken rasten wild durcheinander, während ich mich Hilfe suchend in meinem Zimmer umschaute. Durch das geschlossene Fenster fiel vages Morgenlicht herein. Ich konnte gedämpftes Vogelgezwitscher und Motorgeräusche hören. Der Raum wirkte auf den ersten Blick genau so, wie ich ihn am Samstagabend verlassen hatte. Es war ein sauberes und ordentliches Jugendzimmer, wo alles seinen zugewiesenen Platz hatte. Daher blieb mein Blick sofort an meiner Handtasche hängen, die auf dem Schreibtisch stand, wo sie ganz sicher nicht hingehörte. Ebensowenig wie die Klamotten, die über dem Bürostuhl hingen.
Behutsam stand ich auf und stöhnte leise, als ein stechender Schmerz durch meinen rechten Knöchel fuhr. Außerdem war mir schwindelig, darum wartete ich einen Moment lang, bis ich es wagte, zum Schreibtisch hinüber zu hinken.
Meine Handtasche war völlig hinüber, so viel war klar. Das Kunstleder war zerkratzt und der Riemen gerissen. Außerdem entdeckte ich dunkle Flecken in dem hellen Braun, die aussahen wie … War das etwa Blut?
Mit spitzen Fingern hob ich die Bluse an, die über dem Schreibtischstuhl hing. Entsetzt betrachtete ich die dunkelrote Verfärbung an der rechten Schulter, die definitiv von einem beachtlichen Schwall Blut stammte. Die Jeans darunter war zerrissen und blutbesudelt. Es war die Kleidung, die ich am Samstag getragen hatte.
Mein Herz klopfte mir bis zum Hals. Wo kam nur das viele Blut her? Es konnte unmöglich von meinen Schürfwunden stammen.
Entsetzt ließ ich die Bluse fallen und fuhr mit zittriger Hand durch mein Haar. Ich zuckte schmerzerfüllt zusammen, als ich eine gewaltige Beule über meiner rechten Schläfe berührte. Vorsichtig tastete ich darüber und trat vor den Kleiderspiegel. Nachdem ich einen Scheitel gezogen hatte, erkannte ich eine gezackte Linie auf der bläulichen Schwellung. Es sah aus wie ein Kratzer, bot also auch keine Erklärung für das ganze Blut auf meiner Kleidung. Merkwürdig war außerdem, dass ich weder Blut auf meiner Haut noch in meinen Haaren hatte. Ich musste mich also geduscht haben, bevor ich zu Bett gegangen war. Um erst über vierundzwanzig Stunden später wieder aufzuwachen …
Was zum Teufel war geschehen?
Verstört kramte ich mein Handy unter der Bettdecke hervor und wählte Alinas Nummer.
»Mach schon«, murmelte ich ungeduldig. »Geh ran!«
Mein Flehen schien erhört zu werden, denn im gleichen Moment erklang Alinas krächzende Stimme. »Hallo?«
»Alina! Ich bin’s.«
»Lucia?« Es raschelte leise. »Scheiße, warum weckst du mich? Ich hab doch heute frei.«
Von der Sorge in ihren gestrigen Nachrichten war nicht mehr viel zu merken.
»Alina, hör zu«, bat ich nervös. »Ich hab keine Ahnung, was Samstagnacht passiert ist. Ich hab einen totalen Blackout und bin gerade erst aufgewacht. Ich hab wohl den ganzen Sonntag gepennt.«
Einen Moment lang war es still am anderen Ende der Leitung. Dann vernahm ich ein leises Räuspern. »Verarschst du mich?«
»Nein!«, rief ich verzweifelt und stellte mich wieder vor den Spiegel. »Ich bin kurz vor einem Nervenzusammenbruch! Was ist passiert? Wann bin ich nach Hause gekommen und vor allem – wie bin ich nach Hause gekommen?«
Endlich schien Alina den Ernst meiner Lage zu erkennen, denn sie klang auf einen Schlag hellwach.
»Okay, okay. Kein Grund zur Panik. Du hast einen Filmriss. Das kann schon mal passieren, wenn man zu viel Wodka erwischt.«
»Hast du nicht zugehört? Ich bin gerade eben erst aufgewacht! Und …« Ich blickte von meinem geschundenen Körper hinüber zu den blutverschmierten Klamotten. »Na ja, offensichtlich hatte ich einen Unfall.«
»Was für einen Unfall?«, hakte sie nach.
»Ich sehe aus, als hätte mich ein Lastwagen überfahren«, jammerte ich.
»Tja, dann siehst du so aus, wie ich mich gestern gefühlt habe«, sagte Alina ungerührt. Sie hatte den Ernst der Lage wohl doch nicht ganz erfasst.
Ungeduldig wechselte ich das Handy ans andere Ohr. »Das ist nicht witzig! Meine Klamotten sind voller Blut und ich hab überall blaue Flecken und Schürfwunden.«
Abermals schwieg Alina für einen kurzen Moment. Dann klang ihre Stimme ernsthaft besorgt, als sie fragte: »Könnte dir jemand was untergemischt haben?«
Daran hatte ich überhaupt noch nicht gedacht. Erschrocken ließ ich mich auf den Bettrand sinken und zog die Decke an mich heran. Meine Kehle war wie zugeschnürt.
»Was ist das Letzte, woran du dich erinnerst?«, fragte Alina weiter.
Ich schluckte schwer und atmete tief durch. »Ich bin stinkwütend aus Martins Haus gerannt, nachdem ich Simon eine verpasst hatte.«
»Davon hab ich gehört«, kommentierte meine Freundin. »Aber was war danach? Wo bist du hingegangen?«
»Die Straße entlang, Richtung Innenstadt«, antwortete ich gedankenverloren. »Ich hab den Busfahrplan studiert und wollte …«
Ich stockte, während merkwürdige Erinnerungsfetzen durch meine Gedanken wehten.
Licht. Wunderbares, warmes Licht … Dann Schmerz und Dunkelheit. Stimmen.
»Das ergibt alles keinen Sinn«, flüsterte ich nachdenklich.
»Was sagt eigentlich dein Vater dazu?«, unterbrach Alina meine verworrenen Gedanken. »Hat er dich gesehen, als du nach Hause gekommen bist? Als ich gestern bei dir anrief, wusste er zumindest, dass du in deinem Bett liegst und pennst.«
»Kaum zu glauben«, sagte ich düster. »Aber dass er sich gar nicht gefragt hat, warum ich einen ganzen Tag lang kein Lebenszeichen von mir gebe, ist typisch.«
»Hm, und was jetzt? Soll ich bei dir vorbeikommen?«
»Danke, aber ich muss zur Arbeit.« Ich sah zur Wanduhr über der Tür. »Shit, und ich bin spät dran. Ich muss auflegen.«
Alina sog hörbar die Luft ein. »Willst du denn nicht zur Polizei gehen? Oder ins Krankenhaus?«
Ich überlegte kurz. Irgendetwas in mir war überzeugt davon, dass ein Gang zur Polizei mir nicht weiterhelfen würde. Anzeige einer unbekannten Straftat gegen Unbekannt?
»Ich geh jetzt erst mal zur Arbeit«, sagte ich schließlich zu Alina.
Sie seufzte missbilligend, akzeptierte jedoch meine Entscheidung. »Okay, wie du meinst.«
Nachdem ich ihr versprochen hatte, mich mittags auf jeden Fall bei ihr zu melden, verabschiedeten wir uns voneinander. Ich blieb noch einen Moment sitzen und versuchte mich einigermaßen zu sammeln. Irgendwie schaffte ich es schließlich, in eine Art Automatikmodus umzuschalten, der mich wie von selbst in Bewegung setzte und mich routiniert nach meiner Arbeitskleidung greifen ließ.
Da es schon recht spät war, musste ich auf eine Dusche verzichten und machte mich in Windeseile fertig. Während ich mich schminkte, fragte ich mich, wo eigentlich meine falschen Wimpern abgeblieben waren. Doch es blieb keine Zeit, länger darüber nachzudenken, denn ich musste dringend den Bus erwischen.
Ich kramte eine alte Handtasche aus dem Schrank und stopfte den kompletten Inhalt der zerstörten Tasche hinein, ohne lange auszusortieren. Bei meinem Geldbeutel hielt ich kurz inne. Ich spähte hinein und fand die dreißig Euro in Scheinen, die ich zur Party mitgenommen hatte. Ein Raubüberfall hatte also nicht stattgefunden. Im Kleingeldfach entdeckte ich außerdem die beiden falschen Wimpern, was mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete.
Und mir fiel noch etwas auf – mein Ausweis steckte nicht da, wo er hingehörte. Zerstreut schob ich ihn an seinen richtigen Platz, warf das Portemonnaie in die Tasche und verließ mein Zimmer.
Im Wohnungsflur war es still und düster. Das einzige Licht fiel durch die offene Küchentür herein. Die Tür zum Wohnzimmer, das auch zum Schlafzimmer meines Vaters führte, war geschlossen. Der Gestank nach kaltem Zigarettenrauch lag trotzdem schwer in dem schmucklosen Flur. Keine Ahnung, wann da drin zum letzten Mal ein Fenster geöffnet worden war. Ich betrat diesen Teil der Wohnung schon lange nicht mehr. Mir war es egal, wie mein werter Erzeuger hauste. Ich kümmerte mich nur darum, dass Bad, Küche und Flur sauber waren. Wir hatten vereinbart, dass die Tür zum versifften Wohnbereich meines Vaters stets geschlossen bleiben musste. Er hielt sich daran. Hauptsache, er konnte in Ruhe vor sich hin vegetieren.
Anders konnte man sein Leben wirklich nicht bezeichnen. Die offizielle Begründung seiner Arbeitsunfähigkeit lautete »chronische Rückenbeschwerden«. In Wahrheit hatte er sich selbst aufgegeben. Sein Alltag bestand darin, sich mit seinen Leidensgenossen in der Kneipe um die Ecke zu treffen und gemeinsam mit ihnen das Unrecht dieser Welt zu beklagen. Schließlich war die Welt schuld an ihrem Elend. Die Politik ganz besonders. Und natürlich die Ausländer, die ihnen die Arbeitsplätze wegnahmen, während sie gleichzeitig jegliche Jobangebote vom Arbeitsamt niederschmetterten, weil die selbstverständlich eine Frechheit waren. Und dafür hatten sie jahrelang Arbeitslosengeld bezahlt?
Meine Güte, wie ich dieses Gelaber hasste!
Ich holte meine Turnschuhe aus dem Schuhkästchen neben der Garderobe und schlüpfte umständlich hinein. Mein rechter Rippenbogen brannte höllisch, sobald ich mich vorbeugte. Ich brauchte danach eine kleine Verschnaufpause, bis sich der Schmerz wieder beruhigt hatte und ich die Wohnung verlassen konnte.
Der Flur im dritten Stock war sogar noch trostloser als unser Appartement. Wir wohnten in einem typischen Sozialbau, mit möglichst vielen Wohneinheiten auf kleiner Grundfläche, einst mit guten Absichten erbaut, doch inzwischen der Verwahrlosung überlassen. Der Besitzer scherte sich nicht darum, die längst überfälligen Renovierungsarbeiten durchzuführen. Wohnten ja sowieso nur Asoziale hier und die Miete erhielt er vom Amt, auch ohne funktionierenden Fahrstuhl und intakten Fliesenboden.
Meine Schritte hallten laut im Treppenhaus wider, obwohl ich aufgrund meiner Verletzungen viel langsamer hinunterging als gewöhnlich. Hinter den vielen Wohnungstüren herrschte Stille, was kaum verwunderlich schien, denn ich war in diesem Gebäude sicher die Einzige, die regelmäßig zur Arbeit ging.
Ich erreichte das Erdgeschoss und schritt leicht hinkend an den Briefkästen vorbei. Nicht mehr lange, und ich würde diesem Elend hier endlich entfliehen können. Es war schon alles genau geplant. Sobald ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, würde ich genug Geld verdienen, um mir bis zum Herbst den Rest für eine eigene Mietwohnung zusammenzusparen. Fahrstunden und Führerscheinprüfung waren bereits einkalkuliert. Ein eigenes Auto würde zwar noch eine Weile warten müssen, aber in der Stadt kam ich auch ohne eines gut klar. Hauptsache raus aus diesem Loch und weg von dem peinlichen Jammerlappen, der sich mein Vater nannte. Die schriftliche Prüfung lag bereits hinter mir, in wenigen Wochen würde die praktische stattfinden und eine mündliche Zusicherung meiner Chefin hatte ich auch schon.
Dann konnte mein Leben endlich beginnen.
Ich trat durch die Eingangstür und wollte mich gerade noch einmal umdrehen, um dem Gebäude den Mittelfinger zu zeigen, als ich zwei Gestalten am Rande meines Sichtfeldes bemerkte. Überrascht, um diese Uhrzeit hier jemandem zu begegnen, hielt ich inne. Es handelte sich um eine junge Frau, ungefähr in meinem Alter, mit knallrotem Bob und auffallend blauen Augen, und einen Mann, ein paar Jahre älter als sie, dessen dunkles Haar und gebräunter Teint eine orientalische Abstammung vermuten ließen.
Die beiden lehnten an dem Fahrradständer neben den Mülltonnen und schienen dort auf jemanden zu warten. Das hätte mich eigentlich nicht weiter interessieren sollen, aber ihrem Gesichtsausdruck nach war merkwürdigerweise ich diejenige, auf die sie warteten.
»Guten Morgen, Lucia!«, sagte die junge Frau. »Schön, dich zu sehen. So aufrecht, auf beiden Beinen.«
Verwirrt schob ich den Riemen meiner Handtasche höher. »Äh … sorry, aber … Kennen wir uns?«
»Ja!« Sie kam grinsend auf mich zu. »Na ja, nicht direkt. Mein Name ist Parla. Wie Karla, nur mit P. Oder wie Paula, nur mit R statt U.«
Ich nickte leicht überfordert, doch Parla erwartete offenbar ohnehin keine Antwort von mir.
»Das ist Rakesh«, sprach sie weiter und deutete mit dem Daumen hinter sich auf den Typen, der ebenfalls näher trat. »Wir sind hier, um dir zu helfen. Eine Erweckung kann sehr anstrengend und vor allem verwirrend sein. Wir werden dich aber so gut es geht bei dem Wandel unterstützen.«
Bitte was?
Rakesh rieb sich seufzend über den sorgfältig getrimmten Dreitagebart.
»Fall doch nicht immer gleich mit der Tür ins Haus«, murmelte er mit einem missbilligenden Seitenblick auf Parla. Dann sah er zu mir und lächelte freundlich. »Vielleicht fangen wir einfach noch mal …«
»Nein, danke«, sagte ich bestimmt. »Ich hab kein Interesse an religiösen Erlösern oder so was.«
Energisch marschierte ich an den beiden vorbei. Diese Sektenanhänger wurden immer raffinierter. Allerdings war es heutzutage auch nicht mehr allzu schwer, einen Vornamen herauszufinden. Das war der Preis, den man für die Social Media zahlte.
Leider schien ich es mit einer besonders hartnäckigen Sorte zu tun zu haben, denn bereits nach wenigen Metern schlossen die beiden eilig zu mir auf.
»Hört ihr schlecht?«, fragte ich, ohne stehen zu bleiben. »Kein. Interesse.«
Genervt beschleunigte ich meine Schritte, soweit mein Knöchel es mir erlaubte. Sie folgten mir trotz der resoluten Ansage und stritten dabei flüsternd miteinander. Als ich auf die Hauptstraße abbog, zischte Rakesh: »Schluss jetzt, Parla! Ich rede mit ihr.«
Im nächsten Moment war er auch schon neben mir. Auf der Straße herrschte reger Verkehr und weiter vorn konnte ich bereits die Bushaltestelle sehen, an der einige Leute warteten. Trotzdem bekam ich es allmählich mit der Angst zu tun. Bei religiösen Fanatikern konnte man schließlich nie wissen, was sie vorhatten.
»Lasst mich in Ruhe«, forderte ich harsch und rückte so weit von dem Typen ab, wie es auf dem Gehweg möglich war. Aber Rakesh machte keinerlei Anstalten, meiner Forderung nachzukommen.
»Wir wollen dich nicht für eine Sekte anwerben«, behauptete er.
»Ah ja?«, entgegnete ich pampig. »Was dann?«
Nur noch wenige Meter, dann hatte ich die Bushaltestelle erreicht. Angesichts der Menschen dort würden diese Verrückten hoffentlich von mir ablassen.
Rakesh räusperte sich leise. »Vielleicht beginnen wir besser mit der Frage, was in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit dir geschehen ist.«
Ich blieb wie angewurzelt stehen und wirbelte zu Rakesh herum, was mir einen fiesen Stich im Brustkorb bescherte. Ich stöhnte leise, versuchte aber die Schmerzen zu ignorieren.
»Was weißt du darüber?«, fragte ich aufgeregt. »Was ist passiert?«
Er reagierte nicht sofort, sondern starrte stattdessen genau auf die Stelle meines Oberkörpers, wo meine Rippen brennend pulsierten. Seine rechte Hand zuckte kurz, als wollte er sie zu mir ausstrecken, doch dann ließ er seinen Arm wieder locker hängen. Mir blieb keine Zeit, mich darüber zu wundern, denn da hob er auch schon den Blick zu mir an.
»Du hattest einen Unfall«, erklärte er. »Genauer gesagt wurdest du von einem Auto erfasst, das bei überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten ist.«
Quietschende Reifen. Scheinwerfer, die mich blendeten. Dann nur noch Licht, wunderbares Licht …
Mein Puls beschleunigte sich, als diese Erinnerung durch meinen Kopf ging.
»Ein Unfall«, murmelte ich und wusste sofort, dass das die Wahrheit war.
»Wir sind hier, um dir zu helfen.«
Mir klappte der Mund auf. Ich starrte Rakesh entgeistert an. »Du warst dort!«
Er nickte.
»Ich auch!«, meldete Parla sich zu Wort, was ihr sofort einen strafenden Blick von Rakesh einbrachte.
»Willkommen zurück …«
»Ja«, sagte ich gedehnt und sah sie zerstreut an. »Du warst auch da.«
Licht. Wundervolles, reines Licht. Wärme und Geborgenheit …
»Ich war tot«, flüsterte ich. Das war keine Vermutung, sondern absolute Gewissheit. Mit einem Mal wurde mir übel. »Tot.«
Parla winkte unbekümmert ab. »Jaaa. Aber nur ganz kurz. Dann wurdest du zurückgeschickt. Oder erweckt. Kann man auch dazu sagen. Jedenfalls wirst du dich in den nächsten Tagen drastisch verändern. Du wirst eine Bewusstseinsentfaltung erfahren. Toll, oder?«
Ich blinzelte sie verständnislos an.
»Herrgott, Parla!«, schnaufte Rakesh und schob sie unsanft ein Stück zur Seite. Er atmete tief durch, bevor er sich wieder an mich wandte. »Hör zu, das klingt für dich sicher verrückt. Aber es ist wahr.«
Mir war immer noch ganz flau im Magen. Außerdem musste ich Rakesh recht geben – das alles klang definitiv verrückt.
»Ich war also tot und wurde dann erweckt«, fasste ich in neutralem Tonfall zusammen. »Dann würde mich jetzt mal brennend interessieren, wie ich nach dieser Erweckung nach Hause gekommen und warum ich erst heute Morgen wieder aufgewacht bin.«
»Wir haben dich in einen Heilschlaf versetzt und dann nach Hause gebracht«, antwortete Parla, bevor Rakesh den Mund aufmachen konnte. »Deine Adresse stand auf deinem Ausweis. Ach, und keine Sorge, er hat dich nicht nackt gesehen. Da waren wir Mädels ganz unter uns.«
Sie zwinkerte mir fröhlich zu, während Rakesh sich entnervt die Hand vor die Stirn schlug. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Die ganze Geschichte war nicht nur verwirrend, sondern regelrecht furchterregend.
»Ähm, ja«, begann ich schließlich zögernd. »Ich weiß nicht, was ich …«
Parla unterbrach mich wohlwollend. »Du musst dich wirklich nicht bedanken. Das haben wir doch gern gemacht.«
Da bemerkte ich im Hintergrund den herannahenden Stadtbus, der mir zum ersten Mal wie mein persönlicher Ritter auf dem weißen Pferd vorkam.
»Ich muss los!«, rief ich. »Ich, äh, keine Ahnung. Danke? Wie auch immer.«
Dann machte ich auf dem Absatz kehrt und rannte auf die Haltestelle zu, wo der Bus bereits stehen geblieben war.
»Eins noch«, sagte Rakesh, der plötzlich dicht neben mir her joggte. »Was auch immer du siehst, hörst oder spürst – du wirst nicht verrückt, verstanden?«
Ich nickte verwirrt und steuerte auf die vordere Tür des Busses zu. Die anderen Fahrgäste waren bereits eingestiegen. Mit einem beherzten Satz hechtete ich hinein.
»Bis später!«, hörte ich Rakesh noch rufen.
Ich klammerte mich an eine Haltestange und drehte mich zu den Türen um, die sich zischend schlossen. Rakesh war ein Stück vor dem Bus stehen geblieben und winkte mir freundlich zu. Ich hob träge eine Hand zum Gruß. Der Bus setzte sich holpernd in Bewegung. Wir fuhren an Parla vorbei, die so wild winkte, dass ihr Bob heftig wackelte und die anderen Fahrgäste sie verwundert durch die Scheibe anglotzten.
Völlig durcheinander ließ ich mich auf den nächstbesten freien Sitz fallen, umklammerte die Handtasche auf meinem Schoß und holte einige Male tief Luft. Während ich mich noch fragte, was das alles zu bedeuten hatte, bemerkte ich auf einmal eine interessante Tatsache: Ich hatte keinerlei Schmerzen mehr. Kein Pochen, Stechen oder Brennen machte sich bemerkbar. Weder in den Beinen noch im Brustkorb. Von der spürbaren Überforderung meiner Gehirnwindungen einmal abgesehen, ging es mir hervorragend.
Kapitel 3
Das herrliche Wetter lockte mich in der Mittagspause hinaus aus dem Schuhgeschäft, das sich am Anfang der großen Fußgängerzone befand. Die Bamberger Innenstadt war wunderschön. Vor allem die Altstadt, die man über das berühmte Alte Rathaus erreichte, das mitten in der Regnitz erbaut worden war. Dort thronte der Dom auf einem Hügel über den verwinkelten Gässchen und schiefen Fachwerkhäusern. Wenn man dazwischen hindurchschlenderte, konnte man die Vergangenheit dieser Stadt fast flüstern hören.
In der nicht ganz so mittelalterlichen, aber schmucken Fußgängerzone herrschte wieder einmal reges Treiben. Während ich an den verschiedenen Läden vorbei über das buckelige Kopfsteinpflaster ging, tippte ich eilig die versprochene Nachricht an Alina ein.
»Es ist alles in Ordnung. Ich ruf dich heute Abend an.«
Nachdem ich den Text abgeschickt hatte, steckte ich mein Handy zurück in die Tasche und dachte, dass rein gar nichts in Ordnung war. Ich fühlte mich unwohl. Zwar blieb ich weiterhin von Schmerzen verschont, doch stattdessen hatte sich eine merkwürdige Unruhe in mir breitgemacht. Ich war nervös und gleichzeitig zutiefst erschöpft. Außerdem drückte mein Kopf, als hätte ich ein zu enges Stirnband um. Das war extrem unangenehm.
Ich steuerte den Brunnen auf dem großen Platz vor dem Rathaus an und ließ mich auf die steinerne Stufe vor dem Becken nieder. Seufzend lehnte ich mich gegen den kalten Sandstein. Mir war fürchterlich heiß, obwohl es gar nicht so warm war. Die Sonne wurde immer wieder von Wolken verdeckt, die der Wind über den Himmel jagte. Eine kühle Brise strich mir über die Wangen. Das fühlte sich irgendwie tröstlich an, darum schloss ich genießerisch die Augen.
Scheinwerfer, kreischende Reifen … plötzliche Stille, wohliges Licht …
Die Erinnerungen wurden immer deutlicher. Ich wusste auf einmal ganz genau, wie es sich angefühlt hatte, tot zu sein. Es war schön gewesen, und dieser Umstand kam mir gelinde gesagt verstörend vor. Ich hatte nie Todessehnsucht in mir gespürt, ganz im Gegenteil. Auch jetzt erschreckte es mich zutiefst, dass ich fast gestorben wäre. Wie konnte es sein, dass es mir im Augenblick des Todes völlig egal gewesen war?
Vor einiger Zeit hatte ich einmal eine Reportage über Nahtoderfahrungen gesehen. Da war von einer speziellen Hormonausschüttung die Rede gewesen, die man in solchen Fällen nachweisen konnte. Im Moment des Todes war der Mensch also auf einer inneren Superdroge.
»Es ist Zeit, Seraya …«
Diese Stimme. Fremd und doch derart vertraut, als würde ich sie bereits mein Leben lang kennen. Außerdem verursachte der Name Seraya ein merkwürdiges Kribbeln in meiner Magengegend, das ich nicht einordnen konnte. Je länger ich darüber nachdachte, umso intensiver wurde das Gefühl. Gleichzeitig merkte ich, wie sich das unsichtbare Band um meinen Kopf enger schnürte.
Ich hielt die Augen geschlossen und rieb mit den Handballen über meine Schläfen, in der Hoffnung, den Druck so ein wenig mindern zu können. Das Kribbeln in meiner Magengegend war inzwischen zu einem äußerst unangenehmen Pochen geworden, das schlagartig Übelkeit in mir auslöste. Verkrampft beugte ich mich vornüber und stützte die Hände auf meine angewinkelten Knie.
»Du musst atmen«, sagte da plötzlich jemand neben mir.
Erschrocken richtete ich mich auf und erkannte Rakesh, der es sich völlig unbemerkt neben mir auf der Brunnenstufe bequem gemacht hatte. Er betrachtete mich aufmerksam, während ich ihn verstört anblinzelte. War es Zufall, dass er hier aufgetaucht war, oder hatte er mich verfolgt?
»Atme«, forderte er mich erneut auf. »So tief wie möglich durch den Mund ein und lang und ruhig durch die Nase wieder aus.«
Eine weitere Welle der Übelkeit brachte mich schließlich dazu, seine Anweisung widerstandslos auszuführen. Ich kam mir zwar extrem dämlich vor, wie ich da neben einem fremden Typen hockte und schnaufte wie im Geburtsvorbereitungskurs, doch schon beim zweiten Atemzug merkte ich, dass sich tatsächlich etwas in mir veränderte. Mein Magen beruhigte sich und das undefinierbare Zittern meiner Glieder hörte auf. Ich spürte, wie sich meine Muskeln allmählich lockerten, und lehnte mich erleichtert wieder an den kühlen Stein.
»Interessant«, sagte ich matt, weil mir beim besten Willen nichts Besseres einfallen wollte.
Rakesh lächelte. »Ja, nicht wahr? Es ist erstaunlich, wie sich unbewusste Dinge plötzlich verändern, wenn man sie bewusst wahrnimmt.«
Ich antwortete nicht, weil ich aus seinen Worten nicht wirklich schlau wurde. Im Augenblick war ich nur froh, dass ich mich einigermaßen normal fühlte.
Eine Weile saßen wir beide schweigend nebeneinander und betrachteten das bunte Geschehen auf dem Platz vor uns. Die Menschen eilten an uns vorbei, während Tausende von Fragen durch meinen Kopf geisterten. Ich wusste kaum, mit welcher ich anfangen sollte.
Schließlich war es Rakesh, der das Wort erhob: »So etwas wie gerade eben wird dir in nächster Zeit öfter passieren. Dabei werden die Schübe manchmal noch heftiger ausfallen. Deshalb wäre es ratsam, wenn du dich für zwei, drei Wochen krankschreiben lassen würdest, bis die Intensivphase abgeschlossen ist. Dann würden auch deine ganzen Knochenbrüche von dem Unfall schneller verheilen.«
Ich hatte ihm durchaus zugehört, doch erst bei der Erwähnung des Unfalls wurde ich hellhörig.
»Knochenbrüche?«, wiederholte ich erstaunt. »Welche Knochenbrüche denn?«
»Die Rippenserienfraktur, die Sprunggelenksfissur«, zählte Rakesh mit neutraler Stimme auf, »die Schädelfraktur … ach, und den Milzriss darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Momentan besteht zwar keine Gefahr einer erneuten Blutung, aber das Gewebe braucht noch ein paar Tage, bis es sich vollständig regeneriert hat. Wie auch immer – du solltest deinem Körper wirklich dringend Ruhe gönnen.«
Entgeistert stierte ich Rakesh an, der meinem Blick mit ernstem Gesichtsausdruck standhielt. Mit den genannten Fachbegriffen konnte ich zwar nur wenig anfangen, aber was er da gerade aufgezählt hatte, klang eher nach der Krankenakte eines Patienten auf der Intensivstation als nach einer Erklärung für meine blauen Flecken.
»Äh …« Ich hüstelte verhalten. »Was?«
Rakesh grinste und reckte sein Gesicht genießerisch der Sonne entgegen, die gerade hinter einem Wolkenfetzen aufgetaucht war.
»Du hast schon richtig gehört«, sagte er mit geschlossenen Augen. Er schmunzelte immer noch. »Meine Heilkunst ist beachtlich, darum konnte ich dich zumindest vor einem längeren Schlaf bewahren. Trotzdem braucht es Zeit, bis dein Körper vollständig wiederhergestellt ist. Noch dazu wenn er gleichzeitig dem Stress der Umstrukturierung ausgesetzt ist.«
Mir schwirrte der Kopf, während ich ihn immer noch sprachlos beobachtete. Dass er vollkommen entspannt die Sonnenstrahlen genoss, während er mir Informationen lieferte, die mich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs brachten, machte mich irgendwie wütend. Ich richtete mich kerzengerade auf und starrte Rakesh mit geballten Fäusten an.
»Wer zum Teufel bist du?«, entfuhr es mir.
»Mit dem Teufel habe ich nichts zu tun«, antwortete er, unbeeindruckt von meinem barschen Ton. Er öffnete nicht einmal seine Augen. »Ich wurde dir zugeteilt, um dich bei deinem Wandel zu unterstützen. Man könnte also sagen, dass ich ab sofort dein Mentor bin.«
Ich schnaubte. »Ein Mentor? Der sollte doch eigentlich Fragen beantworten und nicht mit jedem Satz neue aufwerfen, oder?«
Nun hob er doch seine Lider und schaute zu mir herüber. Allerdings wirkte er eher amüsiert als angegriffen. »Tja, an diesen Umstand musst du dich vorerst gewöhnen, denn es wird eine Weile dauern, bis du alles verstehst, was sich dir in nächster Zeit zeigen wird. Sorry, aber es geht nicht anders. Allerdings wärst du nicht erweckt worden, wenn du nicht stark genug dafür wärst. Also, keine Sorge, lass es einfach geschehen.«
Trotz der mysteriösen Situation versank ich unversehens in den Anblick seiner Augen. Sie waren von einem derart dunklen Braun, wie ich es wohl noch nie bei einem Menschen gesehen hatte. Trotzdem strahlten sie eine solche Warmherzigkeit aus, dass ich für einen kurzen Moment meine Wut und meine Verwirrung vergaß.
»Meldest du dich krank?«, fragte Rakesh.
Ich riss mich blinzelnd von seinen dunklen Augen los und sog hörbar die Luft ein. »Natürlich nicht! Warum auch? Weil ein fremder Kerl behauptet, ich wäre wiederbelebt worden und müsste jetzt einen obskuren Wandel durchmachen, für den ich Ruhe brauche?«
»Die Unfallverletzungen bitte nicht vergessen«, bemerkte er trocken.
Meine Fäuste krampften sich so fest zusammen, dass sich meine Fingernägel schmerzhaft in meine Handflächen gruben. Es kostete mich einiges an Selbstbeherrschung, diesen unverschämten Kerl nicht bei den Schultern zu packen und anzuschreien. Stattdessen atmete ich geräuschvoll durch und zwang mich zu einem gemäßigten, aber energischen Tonfall.
»Alles klar«, sagte ich. »Was auch immer Samstagnacht geschehen ist und welche Rolle du dabei gespielt haben magst – ich will, dass du mich ab sofort in Ruhe lässt. Verstanden?«
Augenblicklich wurde seine Miene todernst. Er musterte mich einen Moment lang schweigend. Dann erhob er sich in einer geschmeidigen Bewegung und wich einen Schritt zurück.
»Tut mir leid, aber das geht nicht«, sagte er ruhig. »Ich werde in deiner Nähe bleiben, falls du mich brauchst. Und du wirst mich brauchen, glaub mir. Aber jetzt solltest du erst mal zurück zu deiner Arbeit.«
Damit ließ er mich sitzen und ging lockeren Schrittes davon. Sprachlos schaute ich ihm nach, bis er um die Ecke gebogen war. Schließlich lockerte ich meine verkrampften Hände und warf einen Blick auf meine Armbanduhr.
Meine Mittagspause war zu Ende.
***
Der restliche Tag verging ohne nennenswerte Vorkommnisse. Gleich nach Ladenschluss machte ich mich zu Fuß auf den Weg zu meinem Lieblingscafé in der Austraße, wo ich mit Alina verabredet war. Die Abenddämmerung hatte gerade eingesetzt und der Himmel über der Innenstadt färbte sich in ein hübsches Rosarot.
Mein Körper schien sich beruhigt zu haben und ich blieb von jeglichen Zitter- und Übelkeitsattacken verschont. Dafür meldeten sich die Schmerzen meiner Verletzungen zurück, aber sie waren nicht schlimmer, als bei schlichten Prellungen und Abschürfungen zu erwarten war, wie sie wohl jeder schon mal am eigenen Leib erfahren hatte. Von Knochenbrüchen und Milzrissen war also nichts zu spüren.
Was ich von dem Typen namens Rakesh halten sollte, wusste ich bis zum Feierabend immer noch nicht genau. Er kam mir wie ein dahergelaufener Spinner vor, doch die Sache mit meinem Unfall ließ sich trotzdem nicht ganz beiseiteschieben. Rakesh und diese schräge Parla waren eindeutig dort gewesen. Aber hatten die beiden mich tatsächlich in meine Wohnung gebracht? Oder war vielleicht etwas ganz anderes geschehen, woran ich mich nur nicht erinnern konnte?
Ich bog von der Fußgängerzone in eine kurze Gasse ein, deren hohe Gebäude das meiste Licht der Abenddämmerung verschluckten. Meine Schritte hallten von den Häuserwänden zu beiden Seiten wider. Ich war schon oft durch diese Gasse gelaufen, zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit, doch urplötzlich machte mich die düstere Umgebung nervös. Ein kalter Schauer rieselte meinen Rücken hinab.
Beunruhigt hielt ich kurz inne, um mich umzusehen, doch außer mir war niemand in der Gasse unterwegs. An den Gebäuden gab es keine Eingänge oder Nischen, in denen sich jemand verstecken könnte, und die wenigen Fenster waren mit Gardinen verhängt, hinter denen ich keine Gestalt ausmachen konnte.
Und dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass mich jemand beobachtete. Es kam mir sogar vor, als würde ich heimlich verfolgt werden.
In meinem Nacken kribbelte es unangenehm und ich setzte hastig meinen Weg fort. Dabei beschleunigte ich meinen Schritt, sodass ich schon beinahe rannte, als ich endlich die belebte Austraße erreichte. Ohne stehen zu bleiben drehte ich mich nochmals nach meinem vermeintlichen Verfolger um, von dem weiterhin nichts zu sehen war. Doch plötzlich packte mich jemand von hinten an den Schultern. Mein Herz machte einen Satz und ich wirbelte mit einem spitzen Schrei herum.
»Immer langsam mit den jungen Pferden!«, sagte ein älterer Mann, der mich wohl aufgehalten hatte, weil ich sonst in eine ältere Frau hineingerannt wäre. Ich hatte sie in der Eile nicht wahrgenommen. Das gutmütige Lächeln des Mannes stockte, als er meinen Gesichtsausdruck bemerkte. Offenbar war mir die Panik anzusehen.
Seine Begleiterin musterte mich besorgt. »Ist alles in Ordnung?«
Ich sah noch einmal zurück zur Gasse. Es war nach wie vor nichts Auffälliges zu entdecken. Außerdem war das merkwürdige Gefühl in mir schlagartig verschwunden. Mein Herz klopfte zwar immer noch schneller als gewohnt, aber das lag vermutlich daran, dass mir plötzlich bewusst wurde, wie bescheuert ich mich gerade verhalten hatte.
Verlegen strich ich mir eine Haarsträhne hinters Ohr und wandte mich mit gequältem Lächeln an das freundliche Paar. »Ja, tut mir leid. Ich hab mich nur ein bisschen erschrocken. Wahrscheinlich eine Taube, die aufgeflogen ist. Vielen Dank.«
Hastig eilte ich die neben ein paar kleinen Läden von zahlreichen Cafés und Bistros gesäumte Austraße entlang. Dabei fragte ich mich, ob mein plötzlicher Verfolgungswahn vielleicht etwas mit der Begegnung mit Rakesh heute Mittag zu tun haben könnte.
Ich schob meine verworrenen Gedanken beiseite, als ich Alina vor mir sah. Sie hatte einen der wenigen Außentische für uns ergattert, an denen es sich dank Heizstrahlern und bereitliegenden Decken auch in dieser kühlen Aprilnacht gut aushalten ließ.
Alina war der Inbegriff der Size-Zero-Generation. An ihrem Körper befand sich kein Gramm Fett zu viel, und dennoch beschwerte sie sich regelmäßig über ihre angeblichen Rettungsringe, die meiner Meinung nach nur aus Haut bestanden. Dass sie damit ausgerechnet mir die Ohren volljammerte, wo ich mich nur mit Mühe in eine 38 quetschen konnte, war eine echte Farce. Ich hatte nämlich definitiv einen Rettungsring, der trotz unzähliger Hungerkuren einfach nicht verschwinden wollte. Jeglicher Diätversuch schlug ausschließlich bei meinem Busen an, der ohnehin schon viel zu klein war.
Als ich an ihrem Tisch ankam, war meine Freundin in ihr Smartphone vertieft. Ihr pechschwarz gefärbtes Haar reichte ihr fast bis zur Taille und durch ihre regelmäßigen Besuche im Sonnenstudio konnte sie glatt als Südländerin durchgehen, obwohl ihre Wurzeln höchstens bis nach Erfurt zurückreichten. Bis ihre angestrebte Model-Karriere endlich in Fahrt kam, machte sie eine Ausbildung in einer Parfümerie, was geradezu perfekt war, denn dadurch konnte sie den ganzen Tag ihrem Faible für jegliche Art von Kosmetikprodukten nachgehen.
Ich ließ mich geräuschvoll neben ihr auf einen Stuhl plumpsen. »Hi.«
»Ha…« Ihr blieb die Begrüßung förmlich im Hals stecken, als sie zu mir aufschaute. »Großer Gott, wie siehst du denn aus?«
»Wie seh ich denn aus?«, fragte ich alarmiert und wischte mir übers Gesicht.
»Als hättest du dringend einen Concealer nötig«, erwiderte sie mit einem vielsagenden Blick und fischte nach ihrer Handtasche unter dem Tisch. »Meiner wird zwar ein bisschen zu dunkel für dich sein, aber ein bisschen Farbe schadet deinem Bleichgesicht gerade wirklich nicht.«
Ich schnappte mir verärgert die Speisekarte, obwohl ich hier sowieso immer das Gleiche bestellte. »Lass mal stecken. Außer mein Teint blendet dich zu sehr.«