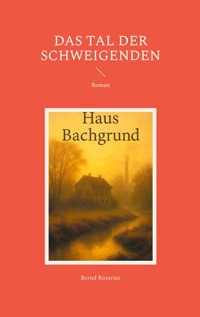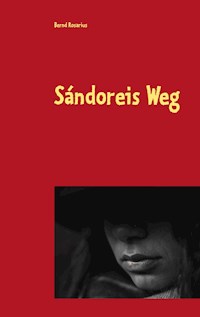
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sándoreis Weg war ein schwerer Weg! Ein Weg den sie gehen musste! War sie eine Träumerin? War sie eine Weltverbesserin? Was war Sándorei für eine Frau? Warum saß sie die meiste Zeit ihres Lebens im Gefängnis? Jetzt nach ihrem Tod, darf ich ihre Geschichte erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich widme die Erzählung Sándorei und ihrem Sohn, die früh getrennt wurden und Jahrzehnte später wieder zusammenfanden. Ich danke ihr, dass sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Sie steht stellvertretend für eine Generation, die in zwei Weltkriegen gelitten hat. Eine Generation, die nach dem Krieg dieses Land wieder aufgebaut hat. Eine Generation, der man Achtung und Mitgefühl entgegenbringen und Zeit widmen sollte.
Ich gedenke meinem kürzlich verstorbenen Freund Siegfried, der mich nach der Wende in der damaligen DDR mit dem Sohn und seiner Mutter Sándorei zusammenbrachte. Sie erzählte mir ihre Geschichte, die mich faszinierte, bisweilen sprachlos machte und mir schlaflose Nächte bereitete.
Ich verlor einen Freund. Einen besseren hätte ich nie finden können. Siegfried wird mir fehlen!
Bernd Rosarius
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Von Chemnitz nach Berlin
Heimat ade
Freund oder Feind ?
Semjon Petrow
Wo ist Susan?
Sie war nicht mehr zu retten
Die ersten Spuren
Vologda
Das hatten wir schon einmal
Ein Zwischenruf
Im Gleichschritt marsch!
Das Versteck
Die Suchmeldung
Das Ende einer Illusion
Ein Wechselbad der Gefühle
Der große Auftritt
Epilog
Prolog
Nach fünf Stunden Autofahrt kam ich in Chemnitz an. Als ich die kleine schmale Straße zu einem einsam gelegenen Haus fuhr, stieg meine Nervosität. Straße und Haus durfte ich nicht nennen, darum bat man mich sehr eindringlich. Diesem Wunsch entsprach ich, denn ich wollte mit dieser Frau unbedingt ein Gespräch führen. „Wenn sie nach Karl Marx Stadt kommen, dann fahren sie …“. Das waren die ersten Worte, die ich von ihr am Telefon hörte, und ich musste lächeln, weil sie sich immer noch nicht an den Namen „Chemnitz“ gewöhnen konnte. Es sollte kein Interview werden. Sie sollte erzählen und ich wollte zuhören. Ich musste mir Klarheit verschaffen. Lange habe ich daraufhin gearbeitet. Wer war sie? Eine Frau von neunzig Jahren. Ihr Sohn Michael war der Freund meines Freundes Siegfried, mit dem ich seit der Wende eng verbunden war. Michael musste seine Mutter überzeugen, mir ihre Geschichte zu erzählen.
Von der Straße aus wirkte das Haus sehr klein, doch als ich näher kam, musste ich feststellen, dass das Anwesen größer war, als ich angenommen hatte. Moderne Technik wie Sprechanlage, Videoüberwachung und Flutlichtquellen waren abgeschaltet. Die Eingangstür stand etwas offen – schließlich hatte man mich erwartet. Ein stattlicher Mann trat aus dem Schatten ans Licht und füllte den Türrahmen komplett aus. „Ich grüße dich“, rief er mir freundlich zu, ohne auf den klassischen Händedruck zu warten. „Geh weiter, meine Mutter ist im Wohnzimmer. Was möchtest du trinken?“ „Wenn ich eine Tasse Kaffee bekomme könnte?“ Ich ging also ein paar Schritte weiter und sah eine kleine Frau mit langen weißen Haaren im Rollstuhl sitzen. Ihr faltenloses Gesicht verriet nicht ihr hohes Alter. Auch sie begrüßte mich freundlich und bot mir einen Stuhl direkt an ihrer Seite an. „Was wollen Sie denn zuerst wissen?“ Ihre Frage überraschte mich nicht, denn ich war auf alles vorbereitet. Der Mann, der mir kurz nach meinem Eintreffen den Kaffee reichte, war ihr Sohn Michael, dessen Lebensgeschichte schon allein ein Buch füllen würde. Ich wollte unbedingt das Gespräch mit seiner Mutter führen, wollte die Lebensgeschichte aus ihrem Munde hören. „Sie nannten sich Sándorei. Wie sind Sie zu dem Namen gekommen? Was für eine Bedeutung hat dieses Pseudonym für sie?“ „Mein richtiger Name lautet Judith Margareta Luise Stomsky. In der Schule rief man mich Judith und später nur noch Stommy.
Mit fünfzehn Jahren lernte ich einen Ungar kennen, der war damals schon zwanzig Jahre alt und hatte den typischen ungarischen Vornamen Sándor. Er war für mich – nicht zuletzt aufgrund des Altersunterschieds – das erste große Vorbild. Ich kannte meinen Vater nicht, denn er ging fort, als meine Mutter mit mir schwanger war. Sándor war ein Mann, zu dem ich aufblicken konnte. Er war gebildet, belesen und steckte voller Ideen in der damals problematischen Zeit. Das war 1925! Sándor träumte von friedlichen Zeiten, von einer demokratischen Gesellschaft, von Gleichheit der Geschlechter und von der Verteilung des Volksvermögens. Alle Menschen sollten die gleiche Rechte bekommen, und die erworbenen Güter sollten gerecht aufgeteilt werden. Er erzählte mir von Karl Marx, von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Er brachte mich mit der KPD zusammen und mit der deutschen Gewerkschaftsjugend. Doch besessen war ich von einer Frau, von Rosa Luxemburg, die ich leider leibhaftig nicht mehr hören konnte, denn sie war tot. Aber ihr Geist lebte. Sie war aktiv in der polnischen und deutschen Sozialdemokratie tätig und galt als große marxistische Theoretikerin und Antimilitaristin. Ich las ihre Schriften in der Leipziger Volkszeitung und ihre Texte, die sie als Herausgeberin der ‚Roten Fahne’ verfasste. Vielleicht war ich so besessen von ihr, weil ich sie als Genossin im Kampf gegen eine von Männern dominierte Gesellschaft ansah. Doch ausschlaggebend für meine Begeisterung für eine neue Weltordnung waren die überzeugenden Argumente von Sándor. Wir blieben drei Jahre zusammen. Während dieser Zeit trat ich in die KPD und in den Deutschen Gewerkschaftsbund ein. Bei jedem Aufmarsch militanter Gruppierungen demonstrierten meine Freunde auf der Straße und verteilten ihre selbst verfassten Schriften aus der eigenen Kellerdruckerei.
Ich machte mit, verteilte Handzettel und hielt mir die Ohren zu, wenn Marschmusik erklang und ich die gleichmäßigen Tritte der Soldatenstiefel hörte. Ich merkte nicht mehr, wie sehr ich mich radikalisierte.
Sándor verstand es geschickt, mich zu manipulieren. Er war zudem meine erste große Liebe, ohne dass wir uns körperlich nahestanden. Er hatte die Schrift ‚Ich klage an’ von Émile Zola, die dieser während der Affäre Dreyfus veröffentlicht hatte, zum Anlass genommen, um mit eigenen Texten seine Wut zu verstärken. Zola war ein großer französischer Romancier des neunzehnten Jahrhunderts. Sándor war ein glühender Verehrer von ihm und seinen Schriften, solange es um die Kritik an der regierenden Obrigkeit ging. Die Kampfschrift von Sándor konnte nicht beendet werden. Sándor wurde während einer Demonstration durch einen Querschläger erschossen. Für mich brach eine Welt zusammen. Tagelang schloss ich mich in mein Zimmer ein, aß und trank kaum etwas. Sándors Freunde standen fest an meiner Seite und holten mich zurück ins Leben. Nun wollte ich die Schrift meines Freundes vollenden – aber unter meinem Namen. Meine Freunde rieten mir, ein Pseudonym zu wählen. In Gedenken an Sándor wollte ich seinen Namen benutzen und vielleicht durch ein weibliches Attribut ergänzen. ‚Sándora’ konnte ich nicht wählen, den Namen gab es schon. Ein Freund rief mir zu:
‚Die Welt ist eine Schweinerei
Sándor wusste das genau,
nenne dich doch Sándorei,
Sándor ist jetzt eine Frau.’
Unser Dichter in der Gruppe hatte den Nagel auf den Kopf getroffen. Von dem Tage an nannte man mich ‚Sándorei’. Unter diesem Namen veröffentlichte ich meine Schriften, und die erste Schrift war – wie konnte es auch anders sein? – ‚Ich klage an.’“ Ich wollte dieser betagten Dame, die jetzt unter dem Namen ‚Judith’ für mich existent war, eine Sprechpause gönnen. „Großartig“, hörte ich mich sagen, „Sie erzählen wunderbar, und wir sind schon mitten in ihrer Geschichte. Wenn es Ihre Kraft zulässt, erzählen Sie bitte weiter.“ Judith lächelte und antwortete: „Na ja, das war nur die Geschichte meines Namens und meines Freundes Sándor. Als ich älter war, erfahrener, reifer, habe ich die Zeit mit Sándor realistischer gesehen.
Meine Vorstellungen und Träume wurden gefiltert, und was übrig blieb, war Grausamkeit. Sándor war ein Träumer, und ich wollte eine Jeanne d’Arc sein, die an der Spitze ihrer Getreuen den Kampf gegen Ungerechtigkeit führt und die Schlacht heldenhaft und siegreich beendet. Das war auch nichts anderes als ein Traum. Meine Mutter hatte vehement versucht, mich von Sándor zu trennen, was ihr natürlich nicht gelang. Meine Mutter war zufrieden mit Sándors Ende. Das verzieh ich ihr nie. Ich entwickelte allerdings etwas Verständnis für sie, nachdem ich selbst Mutter geworden war. Der Bruch mit ihr stand damals unmittelbar bevor – aus unterschiedlichen Gründen.
Von Chemnitz nach Berlin
Sándor war umgeben von vielen Freunden – nicht nur politisch gleichgesinnten, sondern echten Freunden. Sein Tod erschütterte die gesamte treue Gefolgschaft.
Tränen flossen, Gedächtnisabende wurden eingeführt, und einige Freunde hatten sich radikalisiert. Ich versuchte, meine Schrift unter die Leute zu bringen, fand aber wenig Verständnis. Ein junger Mann stand mir gegenüber und schrie mich an: „Kann ich dein Pamphlet essen? Schau dich um, wie die Menschen hungern! Und du willst ihnen politisch-geistige Nahrung geben. Werden sie davon satt? Schäme dich!“
Einen Augenblick hielt ich inne und dachte nach. So ganz Unrecht hatte er nicht.
Nach dem verlorenen Weltkrieg kamen die Reparationspflichten auf uns zu, die dieses Land auf Jahrzehnte lahm legen würden. Die Wirtschaft lag jetzt schon am Boden. Die Arbeitslosigkeit war hoch, und die Menschen standen Schlange vor der Essensausgabe. Mütter weinten auf den Straßen, weil sie ihren Kindern keine Nahrung geben konnten. Die Männer brauten sich ihre Schnäpse selbst zusammen und ertranken ihren Kummer im Suff. Das Selbstwertgefühl der Männer war zerstört, denn sie konnten ihre Familien nicht mehr ernähren. Ich klemmte mir das Manuskript unter den Arm und marschierte zum Versammlungssaal. Dort saßen Sándors Freunde und diskutierten über die Veränderung der Welt. Ein neuer saß in der Runde, den ich zuvor noch nie gesehen hatte. Die Freunde stellten mich dem Neuen vor, und dieser ergriff sofort das Wort.
„Mein Name ist Richard, ich komme aus Berlin und besuche Freunde hier in Chemnitz. Mein Vetter Roman hat mich mitgenommen.“ Ich nickte kurz, setzte mich zwischen Freddy und Hans und erzählte von dem jungen Mann, der mich angeschrien hatte. „Siehst du“, rief Freddy, „das ist es. Die Menschen sind unaufgeklärt, sie brauchen eine geistige Erneuerung.“ „Und? Macht das satt?“ Richard aus Berlin hatte sich mit diesem Einwand zu Wort gemeldet. Seine Worte erinnerten mich an die Rufe des Fremden auf der Straße. „Es ist richtig, dass die Menschen keinen Krieg mehr wollen. Der Weltkrieg war verheerend. Den Krieg, den sie jetzt ausfechten müssen, ist genauso verheerend. Sie haben Angst vor dem Hungertod.
Nehmt doch mal folgendes Beispiel: Ein völlig unpolitischer Mensch möchte arbeiten, um seine Familie zu ernähren. Erst nimmt man ihm die Arbeit weg, dann das Essen für seine Familie. Nun steht er vor seinen weinenden Kindern und muss ihnen erklären, warum das so ist. Dann kommt plötzlich ein Geisteswissenschaftler daher und versucht, ihm eine neue, zukunftsorientierte Ideologie einzupflanzen. Ein anderer kommt daher und behauptet, wenn die Menschen bekämpft würden, die ihm dieses Leid zugefügt haben, gehe es immer besser und er bekomme wieder Arbeit und Essen. Was glaubt ihr? Wie würde sich dieser Familienvater entscheiden?“
Ich sah Richard erstaunt an. Der junge Mann an unserem Tisch, den so richtig niemand kannte, tat sich ständig mit interessanten Gedanken hervor. Er fiel mir besonders auf – nicht nur, weil er gut ar