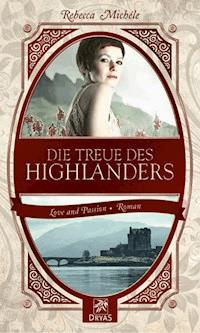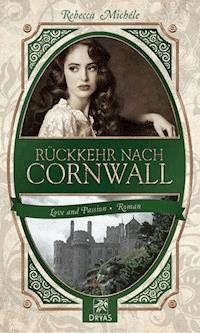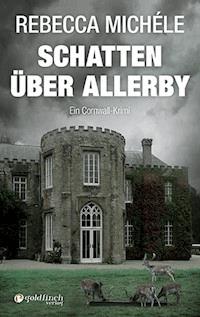
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Cornwall-Krimi mit Mabel Clarence
- Sprache: Deutsch
Die junge und attraktive Lady Michelle Carter-Jones ist tot, angeblich ist es Selbstmord - und das, obwohl sie wenige Tage zuvor zusammen mit Mabel Clarence eine große Geburtstagsparty für ihren älteren, an den Rollstuhl gefesselten Ehemann geplant hat. Für Mabel steht fest: Allen scheinbaren Beweisen zum Trotz - da kann etwas nicht stimmen! Als Pflegerin für Lord Carter-Jones getarnt, schleicht sie sich auf dem Herrensitz Allerby House ein und kommt einem schrecklichen Familiengeheimnis auf die Spur, das sie selbst in größte Gefahr bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Schatten über Allerby
Ein Cornwall-Krimi von
Rebecca Michéle
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Personen- und Ortsverzeichnis
Impressum
Leseprobe
1. Kapitel
Die zierliche Uhr im Regency-Stil auf dem Kaminsims schlug halb drei, als sich Mabel Clarence den Hut aufsetzte und auf ihrem kurzen Haar zurechtrückte. Sie zupfte sich ein paar Ponyfransen in die Stirn, dann betrachtete sie sich im Spiegel. Das taubenblaue, zweiteilige Kostüm mit dem farblich passenden kleinen Hut harmonierte gut mit der zartrosa Bluse. Zufrieden nickte sie ihrem Spiegelbild zu.
„Für den Anlass hoffentlich angemessen“, murmelte sie. In diesem Augenblick klopfte es an die Tür ihres Cottages. „Kommen Sie rein, die Tür ist offen“, rief Mabel und wandte sich um.
Ein großer, breitschultriger Mann trat ein. Sein graues Haar, das sich am Oberkopf bereits lichtete, trug er im Nacken so lang, dass es ihm auf den Hemdkragen fiel. Er musste sich bücken, denn die Türen in dem über zweihundert Jahre alten Cottage waren sehr niedrig.
Früher waren die Menschen eben kleiner gewesen, dachte Mabel, doch sie liebte das Haus. Außerdem stand es unter Denkmalschutz, sie hätte gar nichts verändern dürfen.
Hinter dem Mann schoss ein Hund bellend auf Mabel zu, stellte sich auf die Hinterpfoten und versuchte, ihr Gesicht abzulecken.
„Langsam, Debbie, heute nicht.“ Mabel kraulte die Mischlingshündin zwischen den Ohren und schob sie sanft von sich. „Du darfst mein Kostüm nicht schmutzig machen.“
„Du meine Güte, was haben Sie denn vor?“ Der Mann musterte Mabel erstaunt. „Ich wusste gar nicht, dass Sie so ein ... Ding besitzen.“
Mabel erwiderte seinen skeptischen Blick mit einem Augenzwinkern und griff sich an den Kopf.
„Wenn Sie mit Ding den Hut meinen, Victor, dann sehen Sie mal, wie Sie mich bisher verkannt haben. Jede Frau hat manchmal Freude daran, sich schick zu machen, besonders wenn es einen Anlass dafür gibt.“
„Na ja, steht Ihnen jedenfalls gut.“ Er zwinkerte ihr zu und sah sich dann in Mabels kleinem, gemütlichem Wohnzimmer mit der niedrigen Balkendecke und den weißgetünchten Wänden suchend um. Enttäuschung schwang in seiner Stimme mit, als er fragte: „Dann darf ich wohl nicht auf eine Einladung zum Tee hoffen?“
„Tut mir leid, Victor, aber ich bin verabredet.“
Mabel Clarence bedauerte es wirklich, heute keine Zeit für einen Tee und einen gemütlichen Plausch mit Victor Daniels zu haben. Der Tierarzt des kleinen Ortes Lower Barton, in dem sie nun schon seit einem knappen Jahr lebte, war ihr ein guter Freund geworden, mit dem zusammen sie schon einige Abenteuer erlebt hatte. Wochentags führte Mabel ihm den Haushalt, denn Victor war ein alter Hagestolz, der nur schwer mit weiblichen Wesen auskam. Im Umgang mit Tieren war er ein Perfektionist und liebte alles, was vier, sechs oder auch acht Beine hatte, eine Frau gab es jedoch keine in seinem Leben. Victor war nie verheiratet gewesen, und alles, was mit Kochen, Backen, Wäschewaschen und überhaupt mit dem Haushalt zu tun hatte, war ihm ein Graus. Bevor Mabel in sein Haus gekommen war, hatte er durch seine harsche, oft ablehnende Art schon mehrere Haushälterinnen vergrault, doch Mabel arbeitete gern bei ihm. Inzwischen wusste sie, dass sich unter seiner rauen Schale ein weicher Kern verbarg, außerdem waren sie und Victor sich in vielen Dingen sehr ähnlich.
Heute, an einem Sonntag, war Mabels freier Tag. Victor aß dann immer im einzigen Hotel des Ortes, dem Three Feathers, das eine ausgezeichnete Küche hatte, zu Mittag. Danach ging er mit seiner Hündin Debbie spazieren, stattete Mabel dabei häufig einen Besuch ab, und sie tranken zusammen Tee. Victor wusste genau, dass Mabel am Sonntagvormittag immer entweder süße Scones, einen Victoria Sponge Cake oder auch kleine Apple Pies buk, und für diese köstlichen Backwaren war der Tierarzt zu fast jeder Sünde bereit.
„Na los, fragen Sie schon!“, forderte Mabel Victor auf, der abwartend in der Tür stehen geblieben war.
„Fragen? Was?“
„Was ich vorhabe und warum ich Kostüm und Hut trage. Die Frage brennt Ihnen unter den Nägeln, das sehe ich Ihnen an, Victor.“
„Es geht mich doch nichts an, was Sie am Sonntag machen, Mabel“, gab er in seiner gewohnt brummigen Art zurück. „Solange Sie rechtzeitig ins Bett kommen und morgen früh pünktlich mein Frühstück auf dem Tisch steht.“
Manch andere Frau wäre jetzt nicht nur beleidigt gewesen, sondern vielleicht sogar zornig geworden, aber Mabel entlockten Victors Worte nur ein lautes Lachen.
„Trotzdem sind Sie neugierig zu erfahren, warum ich mich heute so schick gemacht habe“, sagte sie leichthin. „Es gibt auch keinen Grund, ein Geheimnis daraus zu machen: Ich bin zum Tee eingeladen.“
„Aha.“ Victor tat immer noch so, als würde ihn das überhaupt nicht interessieren, hakte dann aber nach: „Doch nicht etwa bei Trevor Cavendish?“
Mabel schüttelte den Kopf. „Falsch, mein Freund. Sie wissen genau, dass Sir Trevor gewisse Gefühle für meine Cousine Abigail hegt und an mir kein Interesse zeigt, was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht. Ich werde es Ihnen sagen, denn ich weiß, Sie mögen keine Ratespiele: Lady Carter-Jones hat mich zum Tee gebeten.“
„Lady Carter-Jones?“, wiederholte Victor erstaunt. „Etwa die Carter-Jones von Allerby House?“
„Eben diese.“ Mabel nickte. „Kennen Sie die Dame?“
„Kennen wäre zu viel gesagt, denn ich bin ihr nie begegnet. Vor ein paar Jahren wurde jedoch viel über die Familie getratscht.“ Er musterte Mabel erneut von oben bis unten und bemerkte schmunzelnd: „Für diese Einladung hätten Sie sich aber nicht derart verkleiden müssen.“
„Was wurde denn geredet?“
Mabels Interesse war geweckt. Als Lady Carter-Jones sie vor zwei Tagen angerufen und gebeten hatte, am Sonntagnachmittag mit ihr zusammen Tee zu trinken, hatte sie sich über die Einladung gewundert. Sie hatte den Namen Carter-Jones zuvor zwar schon gehört, auch war ihr bekannt, dass der Familienstammsitz Allerby House in der Nähe des Fischerstädtchens Fowey lag, einen persönlichen Kontakt hatte es bisher aber nie gegeben. Mabel vermutete, die Dame wolle sie kennenlernen, da sie, Mabel, als Eigentümerin von Higher Barton zwar nicht zum cornischen Landadel, aber immerhin zu den vermögendsten Frauen der Grafschaft gehörte. Abigail Tremaine, die frühere Eigentümerin von Higher Barton, hatte mit der Familie Carter-Jones sicher gesellschaftlich verkehrt, Mabel gegenüber den Namen aber nie erwähnt.
Mabels Cousine lebte nun schon seit längerer Zeit in Südfrankreich. Sie hatte Mabel das herrschaftliche Anwesen vor rund einem Jahr überlassen. Mabel, die aus ihrer früheren Tätigkeit als Krankenschwester eine kleine Rente und auch aus Higher Barton regelmäßige Einkünfte bezog, mochte keine Langeweile und liebte es, immer aktiv und in Bewegung zu sein. Deshalb arbeitete sie als Wirtschafterin bei Victor Daniels, dem Tierarzt. Er war manchmal etwas chaotisch – zumindest, was seine Haushaltsführung anging.
„Ich denke, Sie interessieren sich nicht für allgemeinen Tratsch?“, riss Victor sie aus ihren Überlegungen.
„Das tue ich auch nicht, ich mache mir lieber selbst ein Bild von den Menschen, mit denen ich es zu tun habe.“ Mabel sah auf die Uhr. „Es tut mir wirklich leid – wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden …“
Victor rief Debbie, die es sich gerade auf Mabels gemütlichem Sofa bequem machen wollte, zu sich. „Tut mir leid, meine Kleine, aber dein Mittagsschläfchen wirst du heute auf meiner Couch machen müssen.“ Er wandte sich wieder an Mabel. „Sie wissen, wie Sie nach Allerby House kommen?“, fragte er. „Die Straßen sind sehr verwinkelt, und da Sie ja immer noch kein Navigationsgerät haben …“
„Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich werde abgeholt“, unterbrach Mabel ihn. „Der Wagen müsste gleich hier sein.“
Victor pfiff durch die Zähne. „Oh, die Dame schickt Ihnen ihren Wagen? Respekt, Mabel, Lady Carter-Jones scheint etwas wirklich Wichtiges auf dem Herzen zu haben.“
„Vielleicht braucht sie meine Hilfe bei einem ungeklärten Verbrechen?“ Als Victors Augen sich entsetzt weiteten, fuhr Mabel rasch fort: „Das war ein Scherz, Victor! Ich glaube, sie möchte mich ganz einfach nur kennenlernen, wegen Higher Barton wahrscheinlich.“
In diesem Moment sah Mabel durch das Fenster jemanden auf das Cottage zukommen. Kurz darauf spähte ein in Uniform gekleideter Mann durch die immer noch offene Tür.
„Miss Clarence?“, fragte er mit sonorer Stimme. „Lady Carter-Jones schickt mich, ich soll Sie abholen.“
„Ich bin fertig“, antwortete Mabel und griff nach ihrer Handtasche.
Victor trat vor ihr aus der Tür, und Mabel schloss hinter ihnen ab. Das Cottage lag nicht weit von der Ortsmitte Lower Bartons entfernt. Die Nachbarhäuser, alle Ende des 18. Jahrhunderts als Katen für die damaligen Minenarbeiter erbaut, reihten sich aneinander und waren über einen schmalen Fußweg von der Straße aus zu erreichen. Somit hatte der Chauffeur nicht direkt vor Mabels Haus parken können, und Victor begleitete sie nun die wenigen Schritte bis zur Straße.
„Ein Rolls, klar“, murmelte er, als der Chauffeur Mabel beim Einsteigen behilflich war. „Vornehm geht die Welt zugrunde.“
Dann pfiff er die Hündin heran. Debbie gehorchte sofort, sah ihr Herrchen aus großen, dunklen Augen an und wedelte erwartungsvoll mit dem Schwanz.
„Also heute keinen Tee“, sagte Victor und kraulte Debbies Kopf. „Was hältst du von einem Spaziergang nach Roger’s Wood? Das Wetter ist so schön, der Frühling liegt schon in der Luft.“
Debbie gab ihre Zustimmung mit einem lauten „Wuff“ zu erkennen, und die beiden schlenderten die Straße hinab. Nach etwa achthundert Yards mündete diese auf eine Wiese, an deren Ende zahlreiche Wanderwege in das Waldgebiet Roger’s Wood führten, das bei den Bewohnern von Lower Barton für Spaziergänge sehr beliebt war.
Entspannt lehnte sich Mabel im Sitz des Rolls Royce aus butterweichem, hellem Leder zurück und genoss den Luxus, den der Wagen bot. Als der Chauffeur anfuhr, sah sie durch die Scheibe Victor nach, der mit weit ausholenden Schritten die Straße überquerte. Sie erinnerte sich an die letzten Monate, in denen sie gemeinsam einige aufregende Abenteuer erlebt und dem Tod ins Auge geblickt hatten. Das hatte sie zusammengeschweißt.
Mabel schloss zufrieden die Augen. Sie war mit ihrem Leben rundum glücklich und zählte sich mit knapp Mitte sechzig noch lange nicht zum alten Eisen. Nur weitere Tote – das musste nicht unbedingt sein. Als sie daran dachte, wie es ihr und Victor schon zweimal gelungen war, Mordfälle aufzuklären, die ohne ihre Einmischung wohl niemals gelöst worden wären, musste sie lächeln. Sie war allerdings weit davon entfernt, sich als zum Leben erwachte Miss Marple zu fühlen, obwohl ihr Name eine gewisse Ähnlichkeit vermuten ließ. Und so hatte sie keinesfalls vor, wieder über eine Leiche zu stolpern, sondern hoffte, dass es mit den Verbrechen in dem sonst eher beschaulichen Lower Barton nun ein für alle Mal vorbei war. Der Frühling stand vor der Tür, und Mabel freute sich auf ihren kleinen Garten. Die Arbeit, die sie im letzten Sommer und Herbst hineingesteckt hatte, sollte in diesem Jahr erste Früchte tragen. Auf jeden Fall war es Zeit, die Obstbäume zu schneiden, und außerdem wollte sie Tomatenstauden setzen.
Mabel öffnete die Augen und sah nach draußen. Sofort war ihr Garten vergessen, denn der Wagen hatte das kleine Städtchen Lostwithiel erreicht und bog nun nach rechts von der Hauptstraße ab. Mabel lehnte sich vor und klopfte an die Trennscheibe, die sogleich heruntergelassen wurde.
„Ja, Miss?“, fragte der Chauffeur und warf ihr durch den Rückspiegel einen Blick zu.
„Wohin fahren Sie? Nach Allerby geht es doch auf der A 390 noch ein Stück weiter, bis Sie dann links in Richtung Fowey abbiegen müssen.“
Erstaunt zog der Chauffeur eine Augenbraue hoch.
„Hat Lady Carter-Jones nicht erwähnt, dass sie Sie im Golfhotel erwartet?“
„Nein, das hat sie wohl vergessen.“
Mabel schüttelte den Kopf und lehnte sich wieder zurück. Sie war enttäuscht. Zu gern hätte sie Allerby House, das nicht der Öffentlichkeit zugänglich war, gesehen. Wahrscheinlich hatte sie der Einladung von Lady Carter-Jones zu viel Bedeutung beigemessen. Sie fragte sich, warum die Dame sie nicht einfach in Lower Barton aufgesucht hatte. Lebhaft konnte sie sich Victors Grinsen vorstellen, wenn sie erzählen würde, dass sie gar nicht nach Allerby eingeladen worden war.
Nachdem der Wagen eine steile, enge Straße bewältigt hatte, fuhr er auf einen weiten Platz und hielt vor dem Eingang des zweistöckigen, u-förmigen Hotels mit dunklem Krüppelwalmdach. Mabel war noch nie hier gewesen, denn das Golfhotel in Lostwithiel gehörte zu den exklusivsten und teuersten Etablissements in Cornwall. Das Restaurant war in der ganzen Grafschaft für seine erlesenen Speisen bekannt. Mitglieder im Golfklub waren die Honoratioren der Gegend, doch Mabel machte sich nichts aus diesem Sport. Die Lage des Hotels war indes bezaubernd. Mabel blickte weit über die grauen Schieferdächer Lostwithiels und über die grüne Hügellandschaft hinweg; am Horizont konnte sie sogar das Meer schimmern sehen.
Routiniert half der Chauffeur ihr beim Aussteigen. Sie zupfte ihre Kostümjacke in Form und hoffte, der Hut würde noch gut sitzen. Mabel war solche Kleidung nicht gewöhnt. Am liebsten trug sie praktische, pflegeleichte Hosen, weite Tweedröcke und schlichte Oberteile. Doch auch wenn sie den Tee nun wider Erwarten nicht in Allerby House einnehmen würde, war sie froh, sich gut gekleidet zu haben, denn für diese feine Lokalität war ihr Kostüm genau richtig.
In der großzügigen, hellen Lobby wurde sie von einem Angestellten begrüßt, der sie nach ihren Wünschen fragte.
„Lady Carter-Jones erwartet mich“, antwortete Mabel, und der Herr führte sie in das Restaurant.
Gewohnt, eine neue Umgebung mit wenigen Blicken zu erfassen, sah Mabel sich um. Nur wenige Tische waren an diesem Sonntagnachmittag besetzt. Die Gäste waren ältere Herren und Damen, die zu zweit oder zu dritt zusammensaßen und angeregt plauderten. Mabel überlegte, wer von ihnen wohl Lady Carter-Jones sei, da steuerte der Angestellte einen Ecktisch an, an dem eine einzelne junge Frau saß. Sie war sicher noch keine dreißig Jahre alt und passte wenig in das Ambiente des eleganten Restaurants. Der Pony ihres kurzgeschnittenen, aschblonden Haares war mit roten Strähnen durchzogen. Die enge Jeans brachte ihre schlanke Figur gut zur Geltung, und der hellblaue Baumwollpullover spiegelte die Farbe ihrer Augen wider. Ihr herzförmiges, hübsches Gesicht war ungeschminkt, und als sie Mabel erwartungsvoll zulächelte, zeigte sie zwei Reihen schneeweißer, perfekter Zähne.
Mabel hatte sich eine völlig falsche Vorstellung von Lady Carter-Jones gemacht, denn sie hatte eine gesetzte ältere Dame erwartet. Sie erinnerte sich an Victors Worte, dass sie sich nicht derart in Schale hätte werfen müssen, und verstand nun, was der Tierarzt gemeint hatte. Trotzdem war sie froh, sich ihrem Alter angemessen gekleidet zu haben.
„Miss Clarence?“ Lady Carter-Jones’ Händedruck war fest und warm. „Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Einen Tee, nicht wahr?“ Die junge Frau sah zu dem Kellner. „Und bringen Sie zur Auswahl bitte die große Kuchenplatte.“
„Vielen Dank für die Einladung“, sagte Mabel und setzte sich. Da sie kein Mensch war, der mit seinen Gefühlen hinter dem Berg hielt, fuhr sie fort: „Allerdings sehen Sie mich überrascht, dass wir uns hier treffen. Ich dachte, ich sollte nach Allerby kommen, Mylady.“
Lady Carter-Jones lächelte entschuldigend. „Als Erstes sollten wir diese Förmlichkeiten lassen. Bitte, nennen Sie mich Michelle, und ich darf Sie doch Miss Mabel nennen, nicht wahr?“
„Gern, Lady Michelle“, sagte Mabel und wunderte sich nicht, dass Michelle ihren Vornamen und Familienstand kannte. Was immer der Grund dieses Treffens war – Michelle hatte bestimmt Erkundigungen über sie eingezogen. Die junge Frau entsprach zwar gar nicht ihren Vorstellungen von der Herrin eines herrschaftlichen Besitzes wie Allerby House, sie war ihr aber auf Anhieb sympathisch. Sie ließ Mabel auch nicht im Unklaren, warum sie diesen Treffpunkt gewählt hatte, und kam, sobald der Tee serviert war und die Damen sich aus dem reichhaltigen Angebot den Kuchen ausgesucht hatten, gleich zur Sache.
„Zuerst, Miss Mabel, müssen Sie mir versprechen, dass niemand von unserem Gespräch etwas erfährt“, sagte Michelle und senkte ihre Stimme, obwohl die anderen Gäste viel zu weit weg saßen, als dass jemand das Gespräch hätten belauschen können. „Aus diesem Grund wollte ich Sie auch in diesem Hotel treffen, denn die Wahrscheinlichkeit, um diese Uhrzeit hier auf Bekannte zu treffen, ist gering.“
Gespannt straffte Mabel ihren Körper, ihr Pulsschlag beschleunigte sich. Vorhin hatte sie im Spaß zu Victor gesagt, dass die Lady vielleicht Hilfe bei einem ungeklärten Verbrechen benötigte. Sollte sich der Verdacht jetzt etwa bestätigen oder warum wollte Michelle nicht, dass man sie zusammen sah? Mabel sollte es gleich erfahren.
„Es ist nämlich so“, fuhr Michelle fort. „Ich möchte meinen Mann mit einer Geburtstagsparty überraschen, und diese soll auf Higher Barton stattfinden. Sie werden verstehen, Miss Mabel, dass ich das nicht auf Allerby organisieren kann, denn sonst wäre es ja keine Überraschung. Da ich von Ihren Veranstaltungen auf Higher Barton nur das Beste gehört habe, dachte ich, ich frage Sie einfach mal, ob Sie das machen würden. Es darf nur niemand davon erfahren, sonst wäre die ganze Überraschung im Eimer.“
Mabel wusste nicht, ob sie erleichtert oder ein wenig enttäuscht war. Also kein Verbrechen! Dass die Sprache und Wortwahl, derer Michelle sich bediente, nicht ihren Vorstellungen von einer Lady entsprach, überraschte Mabel dagegen kaum. Die Zeiten hatten sich eben geändert, und eine Dame des Adels verhielt sich heute nicht anders als eine ganz normale, einfache Frau.
„Sie hätten sich auch mit meiner Verwalterin in Verbindung setzen können“, sagte Mabel. „Mrs Penrose kümmert sich in erster Linie um die Veranstaltungen und …“
„Ich wollte aber Sie kennenlernen“, unterbrach Michelle sie bestimmt. „Sie sind die Eigentümerin von Higher Barton, und ich verhandle lieber mit dem Kuchen als mit dem Krümel. Das verstehen Sie doch?“
Mabel nickte und war versöhnt. Michelle war also doch nicht so schlicht, wie es auf den ersten Blick schien. Vor allen Dingen war sie offenbar eine Frau, die genau wusste, was sie wollte, und wahrscheinlich daran gewöhnt war, es zu bekommen.
„Selbstverständlich“, antwortete Mabel freundlich. „Sagen Sie mir einfach, was Sie sich vorstellen. Sie erlauben, dass ich mir ein paar Notizen mache?“ Ihrer Handtasche entnahm Mabel einen kleinen Notizblock, einen Kugelschreiber, den sie immer bei sich trug, und ihre Nahsichtbrille, denn ihre Augen waren eben nicht mehr die jüngsten. „Als Erstes – wann soll die Feier stattfinden?“
Michelle nahm ein zweites Stück Schokoladentorte von dem Servierwagen, den der Kellner neben ihrem Tisch stehen gelassen hatte, und trank einen Schluck Tee, bevor sie Mabels Frage beantwortete: „Am Samstag in drei Wochen. Ich hoffe, das ist nicht zu knapp.“
Mabel schluckte und runzelte die Stirn. Das war mehr als knapp, und sie wusste im Moment nicht, ob Higher Barton an diesem Wochenende überhaupt noch frei war, denn den Kalender führte Emma Penrose. Daher sagte sie: „Ich werde sehen, was sich machen lässt, Lady Michelle.“
Die junge Frau nickte zufrieden und fuhr fort: „Also, es handelt sich um den sechzigsten Geburtstag meines Mannes und ich möchte …“ Als sie sah, wie Mabel stutzte, sagte sie schnell: „Bevor Sie fragen – ja, Lord Douglas Carter-Jones, mein Mann, ist deutlich älter als ich, nämlich etwas mehr als dreißig Jahre.“
„Sie sind mir keine Rechenschaft schuldig“, versicherte Mabel rasch und ärgerte sich, ihre Überraschung nicht besser verborgen zu haben. Schließlich handelte es sich um eine geschäftliche Angelegenheit, und das Privatleben ihrer Auftraggeberin war völlig ohne Belang. „Mit wie vielen Personen rechnen Sie?“, fragte sie geschäftsmäßig.
„Nun, vierhundert werden es schon werden.“
Dieses Mal blieb Mabel ruhig, obwohl sie innerlich vor Freude tanzte. Das würde eine der größten Veranstaltungen werden, die sie und Emma Penrose jemals organisiert hatten. Drei Wochen waren zwar sehr knapp, aber es war durchaus zu schaffen, wenn sie sich bemühten.
„Sie müssen wissen, Miss Mabel“, fuhr Michelle fort, „mein Mann möchte seinen Geburtstag nicht feiern. Am liebsten wäre es ihm, wenn wir diesen Tag einfach ignorieren würden. Ich bin aber der Meinung, sechzig Jahre sind ein Grund, es richtig krachen zu lassen. Außerdem finden auch seine Ärzte, dass er sich nicht immer verkriechen sollte. Etwas Abwechslung und Leben in der Bude täten ihm nämlich gut.“
Mabel verkniff sich die Frage, ob Lord Carter-Jones krank sei, und notierte die üblichen Wünsche bezüglich des Essens, der Musik, der Bedienung und der Dekoration. Außerdem klärte sie, ob Gäste erwartet würden, die eine Übernachtungsmöglichkeit auf Higher Barton brauchten. Nach einer Stunde hatte sie alle Fakten beisammen: Michelle wünschte ein erlesenes Büfett vom besten Caterer in Truro, rund ein Dutzend Gästezimmer, da einige Gäste von weiter her anreisen und über Nacht bleiben würden, sowie eine separate Bar, an der Champagner und Cocktails ausgeschenkt werden sollten.
„Ich habe mich im Internet kundig gemacht“, sagte Michelle. „Higher Barton verfügt über einige große Räume. Ich dachte, wir engagieren zwei Kapellen – ein klassisches Streichquartett für die große Halle und eine Band mit flotter Tanzmusik für die Jüngeren. Diese könnte im Salon im ersten Stock spielen, so würden sich die beiden Kapellen akustisch nicht in die Quere kommen.“
Mabel nickte wohlwollend. „Sie haben sich wirklich gut informiert“, meinte sie. „Ja, wenn je eine Kapelle in der Halle und im Salon im ersten Stock spielt, stören sie sich gegenseitig nicht. Außerdem ist es bei der Vielzahl der Gäste erforderlich, die Party auf mehrere Räume zu verteilen, denn die Halle fasst nur etwa einhundertfünfzig Personen.“
„Ich sehe, wir sind uns einig.“ Zufrieden lehnte Michelle sich zurück. „Um die Einladungen kümmere ich mich, und Sie wissen: Das Ganze ist topsecret, nicht dass mein Mann oder meine Schwägerin Wind von der Überraschung bekommen.“
„Ihre Schwägerin?“
Michelle nickte und rümpfte leicht die Nase. „Die Schwester meines Mannes. Wir haben nicht das beste Verhältnis zueinander, und sie wäre mit einer solchen Party nicht einverstanden. Am liebsten würde sie Douglas in Watte packen und den ganzen Tag über beglucken. Also, Miss Mabel, ich kann auf Ihre Diskretion zählen?“
„Nun, mit Mrs Penrose und deren Mann muss ich natürlich alles absprechen“, entgegnete Mabel. „Ein Fest in einer solchen Größenordnung kann ich unmöglich ohne Hilfe organisieren. Außerdem wird sich das Verwalterehepaar so schnell wie möglich um die Helfer für den Aufbau kümmern.“
„Das ist selbstverständlich.“ Michelle zwinkerte Mabel vertraulich zu. „Ich möchte nur nicht, dass Sie oder sonst jemand in Lower Barton, Fowey oder so herumerzählt, dass ich ein Fest für meinen Mann plane. Er soll bis zu seinem Geburtstag davon ausgehen, dass dieser bedeutende Tag wie jeder andere sein wird.“
„Wofür halten Sie mich?“, fragte Mabel pikiert. „Ich bin keine Tratschtante und respektiere stets die Wünsche meiner Kunden.“
Michelle legte eine Hand auf Mabels Arm. „Entschuldigen Sie, Miss Mabel, ich wollte Sie nicht kränken. Aber in meinem Umfeld … da gibt es Personen, die alles tun würden, um diese Feier zu verhindern, würden sie zu früh davon erfahren …“
Ein Schatten fiel auf Michelles hübsches Gesicht, und ein bitterer Zug bildete sich um ihren Mund. Entgegen ihrem bisherigen Verhalten kramte sie plötzlich hektisch in ihrer Handtasche, nahm ein Medikamentendöschen heraus, schob sich schnell eine kleine, flache Tablette in den Mund und spülte sie mit dem Rest des inzwischen kalten Tees hinunter. Am liebsten hätte Mabel gefragt, ob sie krank sei, aber eine solche Indiskretion erschien ihr unangebracht. Instinktiv dachte sie jedoch, dass diese hübsche junge Frau wohl auch so ihre Probleme hatte. Nur eine Minute später strahlte Michelle Mabel aber wieder aus ihren hellgrauen Augen an.
„Rufen Sie mich an, wenn Sie die ersten Ergebnisse haben“, sagte sie und zog eine zerknitterte Visitenkarte aus der Gesäßtasche ihrer Jeans. „Aber bitte nur auf dem Mobiltelefon. Und wundern Sie sich nicht, wenn ich vielleicht etwas seltsame Antworten gebe. Dann bin ich nämlich nicht allein und kann nicht offen sprechen. In diesem Fall rufe ich Sie selbstverständlich so bald es geht zurück.“
Mabel versprach, alle Wünsche so schnell wie möglich zu erfüllen, dann trennten sich die Frauen mit einem Handschlag. Vor der Tür des Hotels stellte sich heraus, dass Michelle mit ihrem eigenen Wagen, einem dunklen Sportcabrio, gekommen war. Mabel stand erneut der Rolls Royce samt Chauffeur zur Verfügung, der sie wieder nach Hause brachte.
2. Kapitel
Nachdem Mabel am Montagmorgen Victors Haushalt auf Vordermann gebracht, eingekauft und dem Tierarzt einen Lunch gerichtet hatte, den er sich nur noch in der Mikrowelle aufwärmen musste, machte sie sich am späten Vormittag auf den Weg nach Higher Barton. Noch am Abend zuvor, unmittelbar nach ihrem Gespräch mit Michelle Carter-Jones, hatte sie Emma Penrose angerufen und von dem Auftrag berichtet. Erwartungsgemäß war Emma wegen der Kürze des Planungszeitraums in Aufregung geraten.
„Ach herrje, so viele Gäste, und das in weniger als drei Wochen!“
Nach einem Blick in den Kalender hatte sie festgestellt, dass Higher Barton an dem gewünschten Wochenende noch frei war, und Mabel gebeten, zu einer persönlichen Besprechung zu ihr zu kommen. Nun brüteten die Frauen über den ersten Plänen, die Emma bereits grob skizziert hatte.
Das Verwalterehepaar Penrose wohnte in einem Cottage im Park von Higher Barton, obwohl Mabel ihnen angeboten hatte, Zimmer im Herrenhaus zu beziehen. Freie Räume gab es ja genügend, aber Emma dachte diesbezüglich wie Mabel.
„Ist mir alles zu groß“, hatte sie gemeint. „Ich mag es lieber beschaulich und übersichtlich.“
Zweimal in der Woche wischte Emma Penrose in allen Räumen des Herrenhauses Staub, saugte und schrubbte regelmäßig die Holzböden. Zum Putzen der zahlreichen Fenster holte sie sich Hilfe aus dem Ort, ebenso wenn Veranstaltungen anstanden. In den letzten Monaten hatte sich ein fester Stamm aus zuverlässigen und fleißigen Frauen, Männern und älteren Schülern gebildet, die sich gern etwas dazuverdienten, denn Higher Barton wurde oft gebucht.
Es war eine gute Entscheidung, das Anwesen für solche Zwecke zu nutzen, dachte Mabel, denn so kam Leben in das Haus.
Emma Penrose hatte eine grobe Aufteilung der Räume, in denen die Party stattfinden sollte, erstellt und vor Mabels Eintreffen auch schon mit dem Caterer in Truro das Büfett abgesprochen.
„Glücklicherweise hatte die Firma an dem Samstag noch Kapazitäten frei“, sagte sie zu Mabel. „Heute Nachmittag werde ich verschiedene Kapellen und Bands anrufen. Im April wird nicht so viel geheiratet, dadurch werden wir wohl Glück haben, dass alles reibungslos klappt.“
Obwohl Emma die gewohnte Geschäftigkeit an den Tag legte, spürte Mabel, dass die Verwalterin reservierter war als sonst.
„Was haben Sie auf dem Herzen, Emma?“, fragte sie direkt. „Ich werde das Gefühl nicht los, dass Ihnen an dieser Sache etwas missfällt. Bereits gestern am Telefon schienen Sie nicht sehr erfreut zu sein, obwohl es sich um einen äußerst lukrativen und interessanten Auftrag handelt.“
Emma Penrose machte keinen Versuch, sich herauszureden. Aufgrund vergangener Ereignisse fühlte sie sich Mabel zu Dank verpflichtet und war seitdem stets offen und ehrlich zu ihr.
„Sie haben recht, Miss Mabel“, sagte sie und hielt Mabels fragendem Blick stand. „Wir planen eine Feier in einer solchen Größenordnung, daher hoffe ich, dass schlussendlich alles seine Richtigkeit haben wird.“
„Ich verstehe nicht ganz“, sagte Mabel. „Zweifeln Sie etwa an Lady Michelles Liquidität? Ich kenne die Familie Carter-Jones nicht und hoffe, sie steckt nicht in finanziellen Schwierigkeiten …“
„Das ist es nicht“, unterbrach Emma sie. „Es ist vielmehr Lady Carter-Jones selbst. Es wundert mich, dass sie sich für ihren Mann derart ins Zeug legt, obwohl ihre Ehe …“ Sie brach ab, und Mabel ahnte, worauf die Verwalterin anspielte.
„Ich weiß, dass der Lord deutlich älter ist als sie, das hat Lady Michelle mir selbst gesagt. Das geht uns aber nichts an. Denken wir also geschäftsmäßig und lassen private Mutmaßungen außen vor.“
„Sie ist aber so gar nicht, wie man sich die Frau eines Lords vorstellt“, platzte Emma heraus. „Ich habe Lady Carter-Jones zwar nur einmal gesehen, aber es kursieren so einige Gerüchte …“
„Die mich in keiner Weise interessieren“, sagte Mabel streng, obwohl sie selbst ein bisschen neugierig war. „Ich gebe zu, rein äußerlich habe ich mir eine englische Adlige auch anders vorgestellt. Auf mich machte Lady Michelle jedoch einen sehr sympathischen und geradlinigen Eindruck. Wir leben im 21. Jahrhundert, Emma. Sehen Sie sich die Herzogin von Cambridge an – auch sie scheut sich nicht, sich in Jeans und T-Shirt in der Öffentlichkeit zu zeigen.“
Emma musste Mabel zwar zustimmen, konnte dann aber mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. „Eine Masseurin bleibt eine Masseurin, auch wenn sie einen Lord heiratet, noch dazu einen Mann, der ihr Vater sein könnte und zu den reichsten Männern der Grafschaft zählt.“
Nun war Mabels Interesse doch geweckt, denn auch Victor hatte schon seltsame Andeutungen gemacht. „Michelle Carter-Jones war früher Masseurin?“
Emma nickte und ihre Wangen färbten sich rot. Da sie merkte, dass Mabel nun doch an ihrem Wissen interessiert war, fuhr sie schnell fort: „Nach einem schweren Unfall war Lord Carter-Jones lange im Krankenhaus und dann in einer Rehaklinik, so erzählt man es sich zumindest. Außerdem ist er an den Rollstuhl gefesselt. Als er nach Monaten nach Hause kam, heiratete er bald darauf diese … Frau und Allerby bekam eine neue Herrin. Ein sensationeller Aufstieg für eine kleine Masseuse.“ Grimmig zogen sich Emmas Mundwinkel nach unten.
„Wenn, dann Masseurin“, berichtigte Mabel die Verwalterin und sah sie streng an. „Das Wort Masseuse wird nur in anrüchiger Bedeutung verwendet. Wenn wir ganz genau sind, dann lautet die Berufsbezeichnung sogar Physiotherapeutin.“
„Von mir aus. Trotzdem ist es seltsam, dass eine junge Frau einen alten, dazu noch kranken Mann heiratet“, beharrte Emma auf ihrer Meinung.
Mabel reimte sich den Rest zusammen. Michelle war offenbar eine Angestellte der Klinik gewesen und hatte sich dort um Lord Carter-Jones gekümmert. Das Paar konnte sich aber nur kurz gekannt haben, als sie heirateten.
„Wenn ich Ihre Worte richtig interpretiere, glauben Sie, Lady Michelle habe ihren Mann nur geheiratet, um sich ins gemachte Nest zu setzen“, sprach Mabel ihre Gedanken laut aus. An Emmas verlegenem Lächeln erkannte sie, dass sie ins Schwarze getroffen hatte.
„So denken viele Leute in der Umgebung“, bekräftigte Emma ihre Worte. „Immerhin ist er dreißig Jahre älter als sie und zu einem Leben im Rollstuhl verdammt. Michelle Carter-Jones ist hingegen eine junge, gesunde Frau … Na, Sie haben sie ja selbst gesehen. Was will eine wie die mit einem solchen Mann? Wir wissen doch alle, dass ein großes Haus und ein dickes Bankkonto für eine gewisse Art von Frauen sehr interessant sind. Stirbt der Lord, hat Lady Michelle für den Rest ihres Lebens ausgesorgt und ist noch jung genug, um sich einen neuen Partner zu suchen.“
„Mit sechzig Jahren stirbt man noch lange nicht.“ Mabel war etwas indigniert. „Oder leidet Lord Douglas an einer weiteren schweren Krankheit?“
Emma merkte, dass sie einen Schritt zu weit gegangen war. Sie legte eine Hand auf Mabels Arm und sagte entschuldigend: „Ich wollte damit nicht sagen, dass Lord Douglas alt ist, und von einer Krankheit ist mir nichts bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass er vor ihr stirbt, ist jedoch hoch, das müssen Sie zugeben.“
„Vielleicht lieben sie sich wirklich“, gab Mabel zu bedenken und fuhr dann bestimmend fort: „Wie ich bereits sagte, das Privatleben der Kunden hat uns nicht zu interessieren. Ich zweifle nicht daran, dass die Rechnungen pünktlich bezahlt werden, und nur das zählt. Außerdem finde ich es eine nette Idee von Lady Michelle, ihren Mann mit einen Fest zu überraschen.“
Emma Penrose kannte Mabel gut genug, um zu wissen, dass sie jetzt besser schweigen sollte. Mabel Clarence beurteilte Menschen niemals nach ihrer Herkunft oder nach dem äußeren Schein und machte auch keine Unterschiede zwischen reich und arm. Vor allen Dingen verabscheute Mabel Klatsch und Tratsch und war der Meinung, jeder Mensch sollte nach seiner Fasson glücklich werden.
Victor Daniels hatte Mabel nichts über den Hintergrund der Einladung zum Tee berichtet. Natürlich hatte er am Montagmorgen während des Frühstücks gefragt, wie das Treffen verlaufen war, Mabel hatte ihm aber nur erzählt, Lady Carter-Jones habe sie kennenlernen wollen. Obwohl Mabel Victor gegenüber stets ehrlich war und ihm selten etwas verschwieg, fühlte sie sich an ihr Versprechen, das sie Michelle gegeben hatte, gebunden.
Nun war der Tierarzt beileibe kein Mensch, der Neuigkeiten sofort weitererzählte, im Gegenteil, er war schweigsam, sogar wortkarg. Leicht konnte ihm jedoch den Besitzern seiner tierischen Patienten gegenüber ein kleiner, unbeabsichtigter Hinweis entschlüpfen. Außerdem hatte Victor mit den Veranstaltungen auf Higher Barton nichts zu tun und interessierte sich auch nicht für Mabels diesbezügliche Aktivitäten. Ihm war es wichtig, dass sie seinen Haushalt in Schuss hielt und er wochentags einen guten Lunch und am Nachmittag frische, warme Scones zu seinem Cream Tea bekam. Mit der adligen Gesellschaft wollte Victor ohnehin nicht viel zu tun haben, denn in seinen Augen war das alles antiquiert und gehörte ins vorletzte Jahrhundert. Seinetwegen hätte man das Königshaus abschaffen und die dadurch frei werdenden Steuern lieber in die Tierrettung und in Tierheime investieren können.
Diese Einstellung teilte Mabel nicht. Sie hatte ihr Leben in London verbracht und die Angehörigen des Königshauses bei zahlreichen Paraden gesehen. Der Faszination, wenn die Queen in einem offenen Wagen nur wenige Meter an ihr vorbeifuhr, hatte sie sich nie entziehen können. Mabel war also eher royalistisch gesinnt, während Victor überzeugter Republikaner war. Politik war jedoch ein Thema, über das die beiden nicht diskutierten. Jeder vertrat seine eigene Meinung, und das war gut so.
Im Laufe der Woche beendete der Frühling sein kurzes Gastspiel. Regenschauer und kalte, böige Winde peitschten über das Land, im Osten der Insel schneite es sogar wieder. Am Freitag erwachte Mabel mit Kopfschmerzen, und wenig später spürte sie das erste Kratzen im Hals. Auch musste sie mehrmals hintereinander kräftig niesen, und ihr Kopf fühlte sich an, als wäre er in Watte gepackt.
„Du meine Güte, Sie sehen ja furchtbar aus!“, rief Victor, als er zum Lunch aus der Praxis in die Wohnung heraufkam. „Sie gehören ins Bett.“
„Das werde ich am Wochenende auch tun“, krächzte Mabel und wurde von einem neuen Hustenanfall geschüttelt.
Victor packte sie sanft an den Schultern, führte sie zur Tür, drückte ihr den Mantel und die Handtasche in den Arm und sagte: „Nichts da, Sie gehen sofort nach Hause, legen sich ins Bett und bleiben dort, bis Sie wieder gesund sind! Das verordnete ich Ihnen in meiner Funktion als Arzt.“
Obwohl Mabel sich wirklich schlecht fühlte, brachte sie ein Schmunzeln zustande.
„In Ihrer Funktion als Arzt?“, wiederholte sie. „Mit welchem Tier vergleichen Sie mich denn? Hoffentlich mit einem netten.“
Victor ging auf ihren Scherz nicht ein.
„Mit keinem, Mabel. Man braucht kein Humanmediziner zu sein, um zu erkennen, dass Sie eine schlimme Erkältung ausbrüten. Das wissen Sie als Krankenschwester ebenso wie ich. Also, ab ins Bett, viel heißer Tee und machen Sie sich Zwiebelsaftumschläge um den Hals! Ich möchte Sie erst wieder hier sehen, wenn es Ihnen besser geht.“
„Danke, Victor. Ich fühle mich wirklich nicht gut, dabei war ich seit Jahren nicht mehr krank.“
Obwohl sie eine pflichtbewusste Frau war, folgte Mabel Victors Anordnung, auch wenn sich der Abwasch in der Spüle stapelte und zwei Körbe mit Wäsche zum Bügeln bereitstanden. Im Moment nutzte es aber niemandem, wenn sie sich quälte. Sie würde die Erkältung nur verschlimmern und Victor womöglich anstecken.
In ihrem gemütlichen Cottage brühte sich Mabel einen starken Tee auf, in den sie einen Schuss guten Single Malt gab. Mabel trank selten Alkohol und wenn, dann meist nur ein Glas Wein zum Essen. Aber schon Queen Victoria hatte ihren Afternoon Tea mit Whisky angereichert, und die Königin hatte sich bekanntlich bis ins hohe Alter bester Gesundheit erfreut.
Mabel ging früh zu Bett und schlief bis zum späten Vormittag des folgenden Tages, an dem sie ihr Cottage nicht verließ. Der Kühlschrank und die Speisekammer waren gut gefüllt, außerdem hatte Mabel keinen Appetit. Glücklicherweise bekam sie kein Fieber, auch der Husten setzte sich nicht in den Bronchien fest. Nur ihr Hals war wund, und ein heftiger Schnupfen färbte ihre Nase rot.
Am Sonntagnachmittag erhielt Mabel Besuch von Emma Penrose, die eine große Schüssel in den Händen trug. „Selbstgemachte Hühnersuppe, das Beste bei einer Grippe“, erklärte sie und machte sich in der Küche gleich daran, die Suppe aufzuwärmen.
„Eine richtige Grippe habe ich zum Glück nicht“, belehrte Mabel die Verwalterin. „In dem Fall müsste ich unverzüglich ins Krankenhaus, denn damit ist nicht zu spaßen. Es ist nur ein grippaler Infekt, morgen werde ich wieder auf den Beinen sein. Ich freue mich aber sehr, dass Sie mich besuchen.“
„Keine Ursache, Miss Mabel, außerdem habe ich jetzt alles für Lord Carter-Jones’ Geburtstagsfeier zusammen. Obwohl die Zeit knapp ist, haben alle Lieferanten ihre Zusage gegeben; auch ist es mir gelungen, zwei sehr gute Kapellen zu engagieren.“
Mabel nickte zufrieden. Auf Emma war eben Verlass. Nachdem sie zwei Teller der heißen und wohlschmeckenden Suppe gegessen hatte, kuschelte Mabel sich wieder in eine Decke und ließ es zu, dass Emma Tee kochte und sie bediente. Seit Mabel mit zwanzig Jahren ihr Elternhaus verlassen hatte, um als Krankenschwester in einer großen Londoner Klinik zu arbeiten, hatte sie immer allein gelebt und sich um sich selbst gekümmert. Somit war es schön, auch einmal umsorgt zu werden. Sie tranken Tee, und Mabel forderte Emma auf, ihr die Unterlagen zu zeigen.
„Ich habe zwar einen Schnupfen, aber mein Kopf ist fast wieder klar“, sagte sie. „Wir können das Fest jetzt durchsprechen, damit ich Lady Carter-Jones morgen Bescheid geben kann, dass alles wie geplant stattfinden wird.“
Nach einer Stunde waren sie fertig. Was nun noch fehlte, waren ein paar Kleinigkeiten, die Emma und George Penrose aufgrund ihrer Erfahrungen allein bewältigen konnten.
Nachdem Emma sich verabschiedet hatte, machte Mabel es sich auf dem Sofa gemütlich. Die Hühnersuppe hatte sie gestärkt, und sie war fest entschlossen, am nächsten Tag wieder ihren Pflichten als Haushälterin bei Victor nachzukommen.
„Na, heiser sind Sie schon noch“, sagte Victor statt einer Begrüßung, als er die Küche betrat und Mabel ihm ein fröhliches „Guten Morgen“ zurief. „Ihre Stimme klingt, als hätten Sie ein Reibeisen gefrühstückt. Und mit dem Schnupfen sollten Sie sich besser auch noch etwas schonen …“
„Mir geht es gut“, unterbrach Mabel ihn. „Sie wissen doch – Arbeit ist die beste Medizin. So ein faules Wochenende hin und wieder ist zwar ganz nett, mir wurde es aber bald langweilig. Außerdem …“ Ihr Blick schweifte durch Victors Wohnküche, in der sich übers Wochenende das schmutzige Geschirr verdoppelt hatte und der Fußboden mit Krümeln übersät war. „Es wartet allerhand Arbeit auf mich, und wenn ich mich nicht heute daranmache, dann haben Sie bald keinen einzigen sauberen Teller mehr im Schrank.“
„Solange ich noch alle Tassen im Schrank habe“, brummelte Victor, und in seinen Augenwinkeln tanzten die Lachfältchen. „Seien Sie über meinen Mangel an häuslichen Fähigkeiten doch froh, sonst bräuchte ich Sie ja nicht.“
„Und damit würde meinem Leben etwas sehr Entscheidendes fehlen“, gab Mabel schlagfertig zurück. Sie sah zur Uhr. „Sie müssen jetzt in die Praxis, die ersten Patienten warten bestimmt schon.“
Victor nickte, wandte sich in der Tür aber noch mal zu Mabel um. „Was gibt es zum Lunch?“, wollte er wissen.
„Steak-Nieren-Pastete. Ich gehe nachher einkaufen.“
Zuerst machte Mabel sich daran, das schlimmste Chaos in der Küche zu beseitigen. Zur Unterhaltung schaltete sie das Radio ein und sang bei einem Song von Dean Martin leise mit. Dean Martin gehörte zu ihrer Jugend wie der Minirock, falsche Wimpern und natürlich die Beatles, obwohl sie immer eine ruhige, zurückhaltende Frau gewesen war, die in ihrem Beruf aufgegangen war und sich nie in Beatschuppen aufgehalten hatte. Beim Singen merkte sie, dass es wieder im Hals kratzte, daher lutschte sie schnell ein Ingwerbonbon, um die Heiserkeit zu lindern.
Gegen elf Uhr griff Mabel zu dem Mobilteil von Victors Telefon. Es war eine gute Zeit, um Michelle anzurufen; vielleicht konnte sie jetzt ungestört sprechen. Mabel freute sich, ihr die gute Nachricht zu überbringen, dass das Fest wie geplant durchgeführt werden konnte. Jetzt mussten sie nur noch hoffen, dass das Wetter mitspielte, denn Michelle hatte bei Einbruch der Dunkelheit ein Feuerwerk geplant, für das Emma die Genehmigung bereits eingeholt und einen erfahrenen Pyrotechniker engagiert hatte. Mabel nahm Michelles Visitenkarte aus der Handtasche und wählte die Nummer ihres Mobiltelefons. Es läutete lange, und Mabel wollte schon wieder auflegen, da wurde das Gespräch endlich angenommen.
„Ja, bitte? Wer spricht da?“
Mabel stutzte, denn es war nicht Michelle, sondern ein Mann – und die Stimme kam ihr trotz der wenigen Worte sehr bekannt vor.
„Wer ist denn dort?“ Jetzt zeigte ihr Gesprächspartner durch seinen Tonfall eine gewisse Ungeduld.
„Ich … möchte bitte Lady Carter-Jones sprechen“, krächzte Mabel heiser.
Nach einem kurzen Zögern auf der anderen Seite der Leitung hörte sie die Worte: „Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Wenn Sie mir bitte Ihren Namen nennen würden?“
Mabel lief es zuerst eiskalt über den Rücken, dann pulsierte das Blut heiß durch ihre Adern. Hastig drückte sie das Gespräch weg und warf das Telefon auf den Tisch, als wäre es ein glühendes Eisen. Das durfte doch nicht wahr sein! Trotz der Erkältung arbeitete ihr Gehirn wie immer in einer solchen Situation blitzschnell.
Sie riss sich die Schürze vom Leib, schlüpfte in ihren Mantel, stürmte ein Stockwerk tiefer, riss die Tür zur Praxis auf und rief Diana Scott, Victors Sprechstundenhilfe, zu: „Richten Sie Doktor Daniels bitte aus, dass ich dringend weg muss. Er soll sich zum Lunch etwas vom Asia-Imbiss kommen lassen.“
„Aber, Miss Mabel!“ Diana Scott war völlig überrascht, denn ein solches Verhalten kannte sie von Mabel nicht. „Das wird dem Doc gar nicht gefallen …“
Die letzten Worte hörte Mabel schon nicht mehr, denn sie war bereits draußen bei ihrem Wagen. Wenn sie Glück hatte, würde sie Sergeant Bourke beim Lunch antreffen, denn sie musste ihn unbedingt sprechen!
Etwa dreihundert Yards vom Ortskern Lower Bartons entfernt und damit nicht störend für das ansonsten mittelalterliche Stadtbild befand sich der moderne Supermarkt Morrisons mit einem großzügig bemessenen Parkplatz. In dem zum Supermarkt gehörenden Selbstbedienungsrestaurant herrschte um die Mittagszeit großer Andrang. Mabel ließ ihren Blick über die Gäste schweifen. Der rothaarige junge Mann, nach dem sie Ausschau hielt, war aber nicht unter ihnen. Sie nahm sich ein Tablett, griff nach einem Krabbensandwich in der Auslage und bestellte einen Kaffee. Das volle Tablett balancierte sie dann geschickt zu einem Tisch an der großen Fensterfront, von wo aus sie den Parkplatz und das langgestreckte, helle Bürogebäude gegenüber im Auge behalten konnte, denn dort war das Polizeirevier von Lower Barton untergebracht.
Mabel wusste, dass Sergeant Christopher Bourke fast jeden Mittag seinen Lunch bei Morrisons einnahm, sofern ein Einsatz ihn nicht anderweitig beschäftigte. Natürlich hätte sie auch einfach das Polizeirevier betreten und nach Bourke fragen können, das Risiko jedoch, dabei auf seinen Vorgesetzten zu treffen, wollte sie nicht eingehen. Chefinspektor Randolph Warden war zwar eigentlich ein sympathischer Mann mittleren Alters, Mabel und er waren aber keine Freunde. Bereits zwei Mal hatte sie ihm in seine Arbeit gepfuscht, wie er es ausdrückte, was nicht nur seinen Stolz als Polizist, sondern auch sein männliches Ego gekränkt hatte. Ohne Mabels Hilfe wären die wahren Täter jedoch nie hinter Schloss und Riegel gekommen.
Vielleicht war es nur Zufall gewesen, dass der Chefinspektor Mabels Anruf auf Michelles Mobiltelefon entgegengenommen hatte, und sie machte sich unnütz Sorgen. In diesem Moment sah Mabel den Sergeant das Bürogebäude verlassen. Mit großen Schritten überquerte er den Parkplatz und betrat den Supermarkt. Noch hatte er Mabel nicht entdeckt. Erst als er sich, ein volles Tablett in den Händen haltend, im Restaurant nach einem freien Platz umsah, stand Mabel auf und winkte dem jungen Mann.
„Sergeant, kommen Sie, an meinem Tisch ist noch Platz.“
Christopher Bourke freute sich über die unerwartete Begegnung. Er mochte Mabel Clarence, die ihn an seine früh verstorbene Großmutter erinnerte. Lächelnd stellte er das Tablett ab und setzte sich.
„Was für ein Zufall, Miss Mabel“, sagte er. „Ich wusste nicht, dass Sie auch hier essen.“
„Ach, ich musste einkaufen und hatte plötzlich Lust auf einen Kaffee“, wiegelte Mabel ab. Auf keinen Fall durfte der Sergeant auf die Idee kommen, sie habe bewusst auf ihn gewartet.
„Sie sind erkältet?“, fragte Bourke und musterte Mabel besorgt. „Sollten Sie nicht lieber im Bett bleiben?“
„Mir geht es gut, danke“, antwortete Mabel. „Sie wissen doch – ohne Arbeit kann ich nicht sein.“
Er nickte und widmete sich dann seinem Essen. Mabel wartete, bis er erst eine Schüssel Tomatensuppe und dann eine Portion Fish and Chips mit Erbsen gegessen hatte, obwohl sie vor Ungeduld beinahe platzte. Schließlich holte Christopher Bourke sich einen Kaffee von der Theke und trank diesen genüsslich.
Mabel fragte scheinbar beiläufig: „Und, Sergeant, was macht die Arbeit? In Lower Barton ist es ja glücklicherweise ruhig geworden.“
Bourke grinste und zwinkerte Mabel vertraulich zu. „Ja, zwei Morde binnen weniger Monate sind auch genug. Gerade fällt nur das Übliche an – geringfügige Verkehrsdelikte, eine entlaufene Kuh und ein paar Graffitischmierereien an der Gemeindehalle. Das größte Verbrechen, das in diesem Jahr in Lower Barton geschah, war ein Ladendiebstahl im Antiquitätengeschäft in der High Street.“
Mabel nahm einem Schluck von ihrem inzwischen kalten Kaffee. „Aus Ihren Worten schlussfolgere ich, dass es Chefinspektor Warden gut geht.“ Sie sah scheinbar desinteressiert nach draußen. „Kommt er auch manchmal zum Essen hierher?“
Bourke schüttelte den Kopf. „Nur selten, meistens gibt ihm seine Frau etwas zum Lunch mit. Heute ist der Chefinspektor ohnehin unterwegs, Sie brauchen also nicht zu befürchten, ihm zu begegnen.“ Er zwinkerte ihr zu, denn Bourke wusste um das Verhältnis zwischen ihr und seinem Chef.
„Unterwegs?“ Mabels Aufregung stieg. „Ein neuer Fall?“
„Kaum. Er rief mich vorhin kurz an. Scheint sich um einen Selbstmord zu handeln, vorsichtshalber wurde aber die Polizei informiert. Das ist in solchen Fällen üblich.“
Ein kalter Schauer lief Mabel über den Rücken. Sie beugte sich vor und flüsterte, obwohl niemand in dem weitläufigen Restaurant von ihr und Bourke Notiz nahm: „Es ist tragisch, wenn jemand keinen anderen Ausweg sieht, als seinem Leben ein Ende zu setzen. Handelt es sich um jemanden aus Lower Barton? Jemand Bekanntes vielleicht?“
Christopher Bourke war zwar mit Mitte zwanzig noch jung und stand am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, er war aber alles andere als dumm. Daher drohte er Mabel spielerisch mit dem Finger. „Weder jemand aus dem Ort noch jemand, den Sie kannten, Miss Mabel. Also kein Grund, dahinter wieder ein Verbrechen zu sehen. Bei der Toten handelt es sich um die Besitzerin eines Herrenhauses in der Nähe von Fowey. Carter-Jones, glaube ich, ist ihr Name. Mein Chef wurde gerufen, weil der eigentlich zuständige Kollege aus Fowey sich nach einer komplizierten Bandscheibenoperation auskurieren muss. Daher sind wir derzeit für diese Gegend zuständig. Ich nehme nicht an, dass Sie mit den Carter-Joneses verkehren, oder etwa doch?“
Er beobachtete Mabel aufmerksam, doch sie hatte sich so weit im Griff, um mit einem unschuldigen Lächeln zu antworten: „Ich höre den Namen heute zum ersten Mal aus Ihrem Mund.“
Das war nicht einmal gelogen, Bourke interpretierte Mabels Worte aber genau so, wie sie es beabsichtigt hatte. Er sah auf seine Armbanduhr und stand auf.
„Dann ist es ja gut, Miss Mabel, denn wie ich bereits sagte: Es sieht alles nach klassischem Suizid aus. Tut mir leid, die Pflicht ruft wieder. Es war nett, Sie getroffen zu haben. Grüßen Sie den Doc von mir. Und Ihnen natürlich gute Besserung.“
Der Sergeant tippte sich an seine Mütze und ging. Mabel sah ihm nach, bis er das Restaurant verlassen hatte. Erst dann stand sie ebenfalls vom Tisch auf, besorgte sich einen Einkaufswagen und schob ihn durch die breiten Gänge des Supermarktes. Sie musste ihre ganze Konzentration aufwenden, um alles Nötige einzukaufen, ohne dabei Unnützes in den Wagen zu legen, denn immer wieder hatte sie das Bild der lachenden Michelle Carter-Jones vor ihren Augen. Sie hoffte, Bourke falsch verstanden zu haben, denn es war ihr unbegreiflich, dass die junge Frau sich selbst getötet haben sollte. Michelle hatte von einer Schwägerin gesprochen, oder vielleicht lebten noch mehr Frauen mit diesem Namen in Allerby House.
Reiß dich zusammen, sagte sich Mabel. Es hat niemand gesagt, dass Michelle tot ist. Andererseits – wenn dem nicht so sein sollte, warum hatte Warden dann ihren Anruf entgegengenommen?
Obwohl Mabel den Supermarkt nicht sonderlich mochte – sie kaufte lieber in den kleinen Geschäften der High Street ein, wo die Verkäufer ihre Kunden mit Namen kannten –, besorgte sie jetzt alles, was sie brauchte, bei Morrisons. Sie wollte Victor heute besonders süße und lockere Scones mit einer ordentlichen Handvoll Rosinen backen. Das würde den Tierarzt hoffentlich versöhnlich stimmen – wo er doch auf ihren Lunch hatte verzichten müssen. Mabel wusste, wenn sie Victor erklärte, warum sie so eilig weggefahren war, würde er Verständnis für sie zeigen.