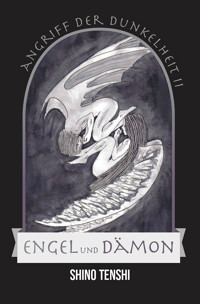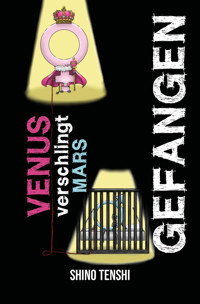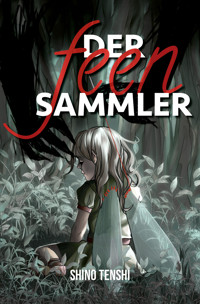9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schattenwesen – Sonne und Mond, Band 1 Ein Dark Gay Romance-Roman über Schmerz, Nähe und das Geheimnis der eigenen Herkunft. Was tust du, wenn dir dein Ebenbild begegnet – und es dich rettet, obwohl du niemandem mehr vertraust? Tsuki hat gelernt, sich unsichtbar zu machen. Gezeichnet von psychischer Krankheit, Ausgrenzung und tiefem Misstrauen, lebt er in einer Welt, die ihn Tag für Tag bricht. Bis ein neuer Mitschüler auftaucht – Taiyo. Offen, herzlich, warm. Und Tsuki zum Verwechseln ähnlich. Was beginnt wie Zufall, entwickelt sich zu einer erschütternden Reise zwischen Licht und Dunkelheit. Während Tsuki verzweifelt versucht, sich zu schützen, reißt Taiyo mit jeder Geste, jedem Blick an seinen Mauern. Doch wer ist Taiyo wirklich? Und was verbindet die beiden auf so unheimliche Weise? In einem Geflecht aus Identität, Trauma, Sehnsucht und der Frage nach dem eigenen Wert, erzählt Schattenwesen eine zutiefst berührende Geschichte über Nähe, Vertrauen und das, was in den Schatten lauert – in uns und zwischen uns. ✓ Für Fans von emotionaler Tiefe, psychologischen Abgründen und queeren Charakteren mit Narben ✓ Enge Geschwisterdynamik trifft auf düstere Vergangenheit ✓ Triggerwarnungen am Ende des Buches
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de/ abrufbar.
Druckerei:
ScandinavianBook
Teil der Scandinavian Print Group DE GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 10
91413 Neustadt a. d. Aisch
Telefon: 0421 5371 446
Verlag:
Living Oils
Elisabeth Dunker
Münchener Straße 80
84453 Mühldorf am Inn
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind dem Autor vorbehalten, einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung, Mikrovorführung, Verfilmung, sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme.
Alle Charaktere und Handlungen sind frei erfunden.
1. Auflage 2025
ISBN TB: 978-3-949750-24-3
ISBN E-Book: 978-3-949750-08-3
©️ Shino Tenshi (aka A. R. Tost)
All rights reserved
Webseite: https://shinotenshi.de/
E-Mail: [email protected]
Instagram: @shinotenshi87
Facebook: www.facebook.com/autorshinotenshi
Cover-Artwork: Kathrin Weck
Chibi-Artwork: Suki's Art
Cover & Buchsatz: BinDer Buchsatz Verena Binder
Shino Tenshi
Vorwort
Liebe Leser*innen,
mit „Schattenwesen“, dem ersten Teil der Sonne und Mond-Duologie, lade ich euch ein, in eine Geschichte voller Dunkelheit und Licht, Hoffnung und Verzweiflung einzutauchen. Dieses Buch ist für mich etwas ganz Besonderes, denn es verbindet nicht nur emotionale Tiefe mit spannenden Charakteren, sondern wurde auch von den Zwillingen aus Digimon Frontiers inspiriert – einer Serie, die mich schon lange begleitet.
Schreiben bedeutet für mich, die menschliche Seele zu ergründen und Geschichten zu erzählen, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Ich liebe es, tiefgehende Beziehungen zwischen meinen Charakteren zu erforschen, wie in diesem Buch zwischen Tsuki und Taiyo – zwei Brüdern, die durch Schicksal und Geheimnisse verbunden sind. Ihre Reise ist eine Erkundung von Identität, Verlust und dem unerschütterlichen Band, das Familie bedeuten kann.
Wenn euch die Geschichte gefällt und ihr mehr über mich und meine Werke erfahren möchtet, lade ich euch herzlich ein, mich auf meinen Kanälen zu besuchen. Auf meiner Homepage www.shinotenshi.de findet ihr nicht nur Informationen zu meinen weiteren Büchern, sondern könnt euch auch für meinen Newsletter anmelden, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Unter @shinotenshi87 gebe ich auf Instagram Einblicke in meine Geschichten, meinen Schreibprozess und die Themen, die mich bewegen.
„Schattenwesen“ ist mehr als eine Geschichte – es ist eine emotionale Reise, die ich mit euch teilen möchte. Es geht um die Frage, wie weit wir gehen, um die Menschen, die uns wichtig sind, zu schützen, und was passiert, wenn die Grenze zwischen Licht und Schatten verschwimmt. Ich hoffe, dass euch das Buch berührt, zum Nachdenken anregt und vielleicht sogar ein kleines Stück eurer eigenen Reise widerspiegelt.
Vielen Dank, dass ihr euch auf diese Geschichte einlasst und Tsuki und Taiyo auf ihrem Weg begleitet habe. Ich wünsche euch spannende, berührende und unvergessliche Lesestunden! Content Warnings findet ihr am Ende des Buches.
Herzliche Grüße,
Shino Tenshi
Teil I:Schmuck des Lebens
Kapitel 1: Mein Ebenbild
Es gibt diese Tage, an denen man aufsteht und schon weiß, dass etwas anders ist. Nur so ein kleines Kribbeln oder Ziehen im Bauch, das man gerne einmal ignoriert, doch heute lag etwas in der Luft.
Meine Mutter war wie jeden Morgen schon auf der Arbeit, wenn ich die Wohnung verließ, und so packte ich nur stumm die hergerichtete Brotzeit ein und machte mich dann auf den Weg nach draußen.
Das Einrasten der Tür durchzog die Stille und zeigte mir deutlich, dass dieser sichere Raum für mich nun eine Weile nicht existierte.
Nur kurz huschte der Gedanke, daheimzubleiben, durch meinen Kopf, doch dieses seltsame, ziehende Gefühl verhinderte, dass ich mich zurück in mein Zimmer verkroch.
Anders als an den Tagen davor schien die Schule mich heute zu rufen, anstatt mich höhnisch auszulachen und mir zu empfehlen, fern zu bleiben. Darum ging ich. Trotz dieser leichten Übelkeit, die sich wie jeden Morgen in meinem Bauch festkrallte und erst wieder verschwand, wenn ich zuhause in meinem Zimmer war.
Ich hasste diese Momente an den Tagen: Schule. Jeder Schritt war eine Qual für mich, doch mir blieb keine andere Wahl. Ich musste dorthin gehen.
Halt suchend klammerte ich mich in den Stoff meiner Netzhandschuhe, doch die Angst in meinem Herzen blieb. Ich wusste, dass es kein Zurück mehr gab und ich diesen Weg gehen musste. Heute mehr als sonst.
Leicht wehte der Wind durch die Straßen und spielte mit meinem schwarzen, kinnlangen Haar, das ich versuchte hinter meinen Ohren zu bändigen. Doch es rief eine Freiheit nach ihnen, der sie sich nicht verwehren konnten und so ließ ich jede weitere Bemühung fallen. Ich fröstelte, als der kalte Hauch über meine nackten Oberarme glitt, da mein schwarzes Sonnentop ihnen keinen Schutz gewährte.
Wenigstens schützte mich die lange, weiße Hose unten herum und verhinderte, dass ich noch mehr fror. Dieser Sommermorgen war kühler als erwartet, doch kaum betrat ich das Schulgelände, wurde die morgendliche Kühle von einer anderen Kälte ersetzt.
Abscheu diesem Ort gegenüber krallte sich in mein Herz. Dort waren ihr Gelächter und ihre spöttischen Blicke, die sich wie heiße Klingen durch meine Seele schnitten.
Aber heute war dieses Gefühl nicht alleine und so blieb diese sonst so überwältigende Übelkeit nur ein leicht flauer Druck im Magen, der von diesem komischen Ziehen im Zaum gehalten wurde.
Ein Ziehen, das sich wie das leichte Flattern von Schmetterlingen anfühlte. Ein zarter Hauch von Glück und positiver Erwartung. Es wirkte so absurd auf mich, doch ich spürte seit langem einmal wieder einen positiven Grund, um in dieses Gebäude der Hölle zu gehen.
Um mich herum waren die Schüler, die ich seit Jahren kannte. Die mich schon so oft ignoriert oder zu Boden gestoßen hatten. Ich bewegte mich in diesem Strom wie in Trance und wich all den Körpern aus. Sah sie nicht, aber nahm sie dennoch wahr.
Dieser sechste Sinn, der einen davon abhielt gegen etwas zu stoßen, lotste mich sicher zu meinem Ziel. Ein Ziel, das einen Schauer durch meinen Körper jagte und eine endlose Panik in meinem Herzen erweckte.
Als aus dem Ziehen ein heißes Pulsieren wurde, stoppte ich. Zum Unmut all der anderen, die nun immer mal wieder grob gegen mich stießen, bevor sie anfingen, mir mit leisen Flüchen auszuweichen.
Nur wenige Meter von mir entfernt standest du. Abseits und in das Gespräch mit dem Direktor vertieft. Es fühlte sich an, als sah ich auf eine neue Version von mir selbst. Eine aus einer anderen Welt oder Dimension. Dieses Lächeln, das ich so sehr vermisste, lag auf deinen Lippen und auch die entspannten Gesichtszüge gab es bei mir schon seit Jahren nicht mehr.
Deine schwarzen, zusammengebundenen Haare waren eine kleine Spur länger als meine und reichten dir bis knapp unter die Schulter.
Alles an dir wirkte offen und ungezwungen, als würdest du auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Unerreichbar für mich.
„Hey, geh endlich weiter! Du stehst im Weg!“ Ein grober Stoß ließ mich taumeln und brach so den Sichtkontakt zu dir ab, dennoch suchte ich dich sofort wieder.
Ich erblickte deine weiße Jacke mit den roten Streifen nur kurz, denn man schob mich weiter und ich ließ mich vom Strom mitreißen.
Wer bist du? Wieso bist du hier? Warum habe ich dich noch nie zuvor gesehen? Weshalb sehen wir uns so ähnlich?
Fragen, die ich mir selbst nicht beantworten konnte und die nicht verschwanden, als ich mich auf meinem Platz im Klassenzimmer niederließ.
Kaum spürte ich das kalte Holz unter mir, verschwand das zaghafte Flattern aus meinem Bauch und wurde von dieser brennenden Übelkeit verschlungen.
Ich wollte von hier verschwinden und nie wieder zurückkehren, doch wie jeden Tag rührte ich mich nicht. Auch nicht als ein süßliches Parfüm zu mir durchdrang und die Übelkeit sich zu einem heißen Stein, der sich durch meine Eingeweide brannte, verwandelte.
Es wurde nicht besser, kaum dass sich eine Mitschülerin vor meinen Tisch platzierte und mich angewidert ansah. „Hey, Tsuki! Warum siehst du jetzt wieder aus wie ein Loser? Als ich dich vorhin gesehen habe, dachte ich, dass du es endlich begriffen und mal Stil entwickelt hast. Aber scheinbar habe ich mich zu früh gefreut.“
Ihre braunen Augen verdunkelten sich durch die Abscheu, die sich durch sie wand, als sie schon arrogant mit einer Hand ihre braunen, leicht gewellten Haare über ihre Schulter warf.
Das dezent geschminkte, zarte und durchaus hübsche Gesicht verzog sich mit jeder Sekunde, die sie mich länger ansah, zu einer Fratze der Verachtung, als sich ihre Nase kräuselte und ihre rötlichen Lippen angewidert zuckten.
„Das war nicht ich, Jessica“, rang ich mich zu einer Antwort durch. In der Hoffnung, dass sie dann wieder ging, aber sie zupfte nur an ihrer weißen Bluse und zog den roten Rock ein wenig tiefer, sodass er wieder über ihre Knie ging.
„Wer soll es denn sonst gewesen sein?“, fragte sie schnippisch nach, doch ich konnte nur mit den Schultern zucken und sah dann demonstrativ aus dem Fenster. Ich wollte diese Unterhaltung nicht mehr führen und hoffte, dass das Mädchen diese Geste verstand.
Mit leisem Fluchen entfernten sich ihre Schritte klackernd, was mich erleichtert ausatmen ließ und den glühenden Stein in meinem Magen abkühlte.
Du warst also real. Ich habe dich mir nicht eingebildet. Du warst auf dieser Schule und sahst genauso aus wie ich.
Die Schmetterlinge kehrten zurück und versuchten verzweifelt, den Stein aus meinem Bauch zu tragen, doch sie schafften es nicht und so blieb diese Gefühlsmischung in mir.
Eine Mischung, die ich kaum deuten konnte. Einerseits dieses beflügelnde Gefühl, das mich heute hierher gebracht hatte, andererseits eine Angst, die sich nach und nach in Panik verwandelte.
Eine Panik, die alles in mir verschlang. Den Stein, die Übelkeit und schließlich auch die Schmetterlinge. Hinterließ nur diese unheimliche, alles verzehrende, schwarze Finsternis, die mir sämtliche Sinne raubte.
Was soll ich tun, wenn wir uns begegnen? Wird dir die Ähnlichkeit auffallen? In welche Klasse gehst du überhaupt? Wie lange bist du schon hier? Sollte ich gehen und mich doch krank melden? Der Lehrer ist noch nicht da.
Und dann? Nie wieder kommen? Das ist total lächerlich. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Der Unterricht beginnt bald.
Und so blieb ich sitzen. Starrte aus dem Fenster und versuchte, die Angst in meinem Inneren zu bändigen.
Es gelang mir nicht.
Der Schulgong zerschlug die Gespräche, die Gruppen, die sich um vereinzelte Tische versammelt hatten, und meine Fluchtgedanken. Jetzt gab es kein Entkommen mehr.
Kaum wurde mir diese Tatsache bewusst, entzündete sich der Stein in meinem Inneren erneut und setzte seine Reise durch meinen Bauch fort. Das Zimmer verlassen, dieser Wunsch wuchs mit jeder Sekunde in mir. Bis zu dem Moment, als sich die Tür öffnete und unser Lehrer Herr Brand eintrat. Sofort breitete sich sein herbes Parfüm im Raum aus, während er mit festen Schritten zu seinem Pult ging. Sein leicht nach vorne gebeugter Körper wippte bei jeder Bewegung mit.
Mit einem leisen Klatschen landete seine Tasche auf dem Tisch und er streckte sich kurz aus, sackte aber im nächsten Moment schon wieder zusammen. Sein rotes Haar fiel ihm in sanften Locken ins Gesicht, doch er strich sie sich immer wieder hinters Ohr. Eine ungünstige Länge, doch er änderte die Frisur nicht, daher schien er es so zu wollen.
„Meine lieben Schüler. Ich habe euch heute einen neuen Kameraden mitgebracht. Sein Name ist Taiyo Hikari und er ist erst seit einer Woche in unserer Stadt, weil sein Vater aus beruflichen Gründen hier zu tun hat. Komm rein, Taiyo.“ Er winkte in Richtung Klassentür und keine zwei Atemzüge später tratst du in den Raum ein.
Ein Raunen ging durch die Menge und alle Blicke fielen sofort auf mich. Sie fühlten sich wie tausend, glühende Nadeln an, die sich in jede Pore meines Körpers bohrten.
Ich sackte tiefer in meinen Stuhl und wünschte mir, dass ich verschwand, doch man erlöste mich nicht, denn die folgenden Worte hoben mein Grab aus.
„Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Seid ihr verwandt? Na ja, an sich auch egal. Neben Tsuki ist noch ein Platz frei. Setzt dich da hin.“ Der Lehrer wartete nicht einmal auf eine Antwort von uns, doch wir schüttelten dennoch simultan den Kopf.
Ich begegnete deinen himmelblauen Augen, die mich fixierten und in denen ich einen tosenden Sturm erblickte, der verzweifelt versuchte, diese Situation zu verstehen. Du scheitertest, dennoch wich deine Verwirrung einem Lächeln, als du entspannt auf mich zutrast, um dann neben mir Platz zu nehmen.
„Hallo, also, noch einmal, mein Name ist Taiyo. Schön dich kennen zu lernen.“ Du reichtest mir deine Hand, die ich verwirrt ansah.
Willst du dich mit mir anfreunden? Was versprichst du dir davon? Du solltest lieber schauen, dass du Anschluss zu den anderen findest. Ich werde dir nur Unglück bringen.
„Was ist los? Keine Angst, die beißt nicht.“ Dein Lächeln blieb, als deine Hand kurz zuckte, damit man endlich einschlug. Ich atmete tief durch, bevor ich diese warme Geste entgegennahm.
„Tsuki.“ Ich brachte nicht mehr heraus. Dort war diese Wärme, die das Ziehen in meinem Inneren verstärkte und dieses schmerzhafte Brennen kurz löschte.
„Schon verrückt, dass wir uns so ähnlich sehen, oder nicht?“, startetest du eine Unterhaltung, die mich wehmütig lächeln ließ, bevor ich dann mit den Schultern zuckte.
„Ich … ich will mich auf den Unterricht konzentrieren.“ Dein Interesse war mir unangenehm. Ich hatte Angst, dass du nur nach einem Grund suchtest. Nach einem Geheimnis, mit dem du mich fertig machen konntest. Wieso solltest du sonst Interesse an mir haben? Niemand hier wollte mein Freund sein. Warum also du?
„Ja, da hast du Recht. Aber dennoch. Ich finde unsere Ähnlichkeit krass. Als wärst du mein verlorener Zwilling, wenn ich nicht Einzelkind wäre.“ Du lachtest auf, was mich kurz schüchtern lächeln ließ.
Ich wollte diese Unterhaltung nicht mit dir führen und dennoch sprachst du unbeirrt weiter.
„Aber mein Dad hat gesagt, dass meine Mum bei meiner Geburt gestorben ist, und daher kann ich keinen Bruder haben. Stell dir das mal vor, man entdeckt so seinen verschollenen Zwilling. Wie krass ist das denn?“ Erneut lachtest du auf, was ein Räuspern von Herrn Brand zur Folge hatte.
„Taiyo! Ich weiß, dass eine neue Klasse und Umgebung immer sehr aufregend ist und du bestimmt ganz schnell deine Klassenkameraden kennenlernen willst, aber dafür sind die Pausen da. Bitte konzentrieren wir uns daher weiter auf den Unterricht, ja?“
Ich war ihm unsagbar dankbar für diese Ermahnung. Endlich musste ich mich dieser Unterhaltung nicht weiter stellen, die mich mit jedem Wort mehr überforderte. Normalerweise sprach ich gar nicht mit meinen Mitschülern. Dein aufdringliches Interesse irritierte mich daher sehr und versuchte, mich aus einer Komfortzone zu reißen, die ich mir hier mühsam aufgebaut hatte, um diesen kalten Alltag zu überstehen.
Betrübt senktest du deinen Kopf und begannst ebenfalls den Unterrichtsstoff mitzuschreiben. Ich bemerkte aber, dass dein Blick immer wieder zu mir wanderte. Sofort kehrte die Aufregung, die das Ziehen und die Schmetterlinge mit sich brachte, zurück.
Ein zartes Kribbeln jagte über meinen Arm und Rücken und fuhr hoch bis in meinen Nacken. Ich schluckte trocken und versuchte, das leichte Zittern meiner Hand zu unterdrücken. Sie fühlte sich kühl an und ich sehnte mich nach der Wärme deines Händedrucks. Nach diesem kurzen Halt, der mir so viel mehr versprach, doch in diesem Moment nicht zurückkam.
Es existierte nur die feste Stimme unseres Lehrers, die den Raum erfüllte. Untermalt von dem leisen Kratzen der Kreide auf der Tafel. Wissen, das ich mir einprägen sollte, doch die Schmetterlinge in mir pusteten alles wieder aus meinem Kopf heraus. Alles bis auf die Erinnerung an deine Berührung und dein Lächeln.
Etwas, was ich immer sehen konnte, wenn ich nur kurz zur Seite blickte. Dein offener, sanfter Himmel, der zum Fliegen einlud und diese Freundlichkeit, die alles versprach. All das, was ich schon lange aufgegeben hatte.
Kann ich es bei dir finden? Diese Zuflucht? Freundschaft? Verbundenheit? Vertrauen? Ich will so gerne. Kann ich? Soll ich es wagen?
Ein leiser Klatscher riss mich aus meinen Gedanken und kaum konzentrierte ich mich wieder auf meine Umgebung, erblickte ich einen kleinen, weißen Zettel auf meinem Tisch. Suchend sah ich über den Tischrand hinaus und traf auf Jessicas stechende Augen, die mich fesselten.
„Gib ihn an Taiyo“, befahl sie mir leise aber mit Nachdruck und ich griff zitternd danach. Kurz versuchte ich, ihn zu öffnen, doch das scharf geflüsterte Nein stoppte mich sofort.
Du bekamst davon nichts mit, denn dein Blick war auf die Tafel gerichtet und immer wieder schriebst du etwas in das Heft vor dir. Alles in mir schrie, dass ich den Zettel weg schnipste, doch dann schob ich ihn zu dir. Ich hatte kein Recht, dir den Zugang zu der Klassengemeinschaft zu verwehren.
Du nahmst ihn zögerlich an dich und öffnetest ihn, bevor du dann die Botschaft lasest. Die Zeit lief in Zeitlupe ab, als dieser gewaltige Eisklotz all die Schmetterlinge in mir niederwalzte.
Dein Blick hob sich und dann begegnetest du den von Jessica. Ihr Lächeln wurde verführerisch und sie zwinkerte dir zu. Doch anstatt es zu erwidern, wurde dein Gesicht zu Stein und du zerknülltest den Brief, bevor du ihn demonstrativ auf die rechte obere Ecke legtest. So weit wie nur möglich weg von dir.
Entsetzten trat in Jessicas Gesicht, bevor es von Hass gestürmt wurde und sie sich dann wieder nach vorne wandte.
„Warum hast du das getan?“, fragte ich dich und sah wieder dein Lächeln.
„Weil ich nicht glaube, dass ich neben einem Loser sitze, wie sie geschrieben hat. Außerdem will ich nichts mit Menschen zu tun haben, die andere niedermachen. Du etwa?“
Ich schüttelte kurz den Kopf, worauf du noch breiter lächeltest. „Das ist schön, dann sind wir uns ja einig.“
Das Kribbeln kehrte bei diesen Worten wieder zurück und ich wollte mich diesen Glücksgefühlen so gerne hingeben, doch etwas stoppte mich und schickte einen eiskalten Schauer über meinen Rücken hinab.
Ich kann niemandem hier trauen. Sie wollen mich alle nur vernichten und so wird das auch bei dir laufen. Ja, ganz bestimmt. Auch du wirst mir am Ende nur leid bringen. Darum verschwinde. Verschwinde aus meinem Leben.
Doch du bliebst.
Kaum erklang der Schulgong, packte Herr Brand seine Sachen zusammen und verabschiedete sich knapp von uns, bevor er den Raum verließ. Er war noch nicht gänzlich aus der Tür verschwunden, da erhob sich schon der alltägliche Gesprächslärm und du drehtest dich zu mir um. Dein Lächeln war offen und sanft, genauso wie deine Worte: „Hey, unsere Ähnlichkeit ist echt der Hammer, oder? Damit kann man bestimmt witzige Sachen machen.“
Du strichst dir eine lose Strähne hinter dein linkes Ohr, dabei fiel mir der kleine goldene Ohrring in Form einer Sonne auf. Unter dieser unbewussten Bewegung schwang an deinem Handgelenk ein goldenes Armband mit einer sanften Gravur, die ich nicht deutlich sehen konnte, mit. Ich ließ meinen Blick weiter wandern, bis er an deiner Halskette hängen blieb, die aus zwei Schlangen bestand, die sich umeinander wickelten. Die eine golden, die andere silbern.
„Ich bleibe lieber unter dem Radar“, wehrte ich deinen Vorschlag ab und brachte das Lächeln auf deinen Lippen ins Stocken, doch du winktest ab.
Ein kurzer metallischer Schlag erklang, als deine rechte Hand auf den Tisch fiel und sofort erblickte ich die Geräuschquelle. Um deinen Ringfinger schlang sich ein goldener Ring mit einem Rubin als Schmuckstein, was mich verwirrte. Ich griff instinktiv nach meinem eigenen Schmuck.
„Sollte nicht der nächste Lehrer gleich kommen?“ Du sahst auf die goldene Uhr an deinem rechten Handgelenk. Ihr Armband war mit je einem roten Stein pro goldener Facette geschmückt. Ängstlich verbarg ich meinen Schmuck, so gut es ging, vor dir. Ich trug die gleiche Menge, nur in Silber und mit Saphiren. Anstatt der Schlangen hatte ich übereinander liegende Engelsflügel um den Hals. Einer golden, der andere silbern. Der einzige Unterschied. Und so jagte ein unangenehmer Schauer durch meinen Körper.
„Nein, wir haben immer fünf Minuten Pause zwischen den Stunden. Deswegen beginnt der Unterricht schon um zehn vor und nicht zur vollen Stunde.“ Ich sprach diese Worte nicht bewusst aus, sondern nur weil in deinen Augen eine Aufforderung lag, die ich erfüllen wollte. Dabei hoffte ich, dass ich mich von meiner eigenen Erkenntnis ablenken konnte.
„Ach so, ich hab mich schon gewundert. Aber das ist gar keine so schlechte Idee. Du, sag mal, kann ich mich auch in den anderen Räumen neben dich setzen? Ist doch witzig mit unserer Ähnlichkeit, oder?“
Ich zuckte mit meinen Schultern. Es war mir egal, wenn du unbedingt bei mir und somit am Rand der Klassengemeinschaft sein wolltest, dann war das deine Entscheidung und in die wollte ich dir nicht reinreden.
„Das ist klasse. Wir werden bestimmt viel Spaß haben und …“
Du wurdest von Frau Malers Eintreten unterbrochen und mir fehlte das Verlangen mehr zu hören. Deine Worte klangen so nett und versuchten Hoffnung zu sähen, doch ich wollte diese Saat nicht. Sie versprachen zarte Blumen zu werden, aber am Ende kamen nur alles verschlingende Fleischfresser heraus, die versuchten mich zu töten. In diesem Garten war kein Platz für fremde Pflanzen.
„Ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Wir werden bestimmt super Freunde.“ Deine Worte waren leise. So leise, dass ich sogar kurz glaubte, dass ich sie gar nicht hören sollte. Doch als ich zu dir sah, lag dort ein sanftes Lächeln auf deinen Lippen und unsere Blicke berührten sich. Das Flattern in meinem Inneren kehrte zurück. Ich konnte nicht verhindern, dass sich ein leichtes Schmunzeln in mein Gesicht verirrte. Solange bis ich Jessicas Blick begegnete und der dortige Hass und Kälte all deine Wärme verschlang.
Nein, wir haben keine Zukunft. Keine Freundschaft. Du wirst früher oder später zu ihnen gehen und dann alles, was ich dir bis dahin anvertraut habe, gegen mich verwenden. Ich darf mich nicht auf dich einlassen. Nein, das bedeutet nur den Untergang für mich. Darum, bleib weg. Bitte, bleib fern von mir.
Egal wie sehr ich mir meine Einsamkeit zurückwünschte, du bliebst an meiner Seite. Deine Wärme kroch langsam meinen Arm hinauf und deine Worte legten sich wie eine sanfte Umarmung um mein Herz. All diese Nähe klang so vielversprechend und zu schön, um wahr zu sein, doch die kalten Blicke der anderen verhinderten, dass ich mich gänzlich in diese Scheinwelt verlor.
„Normalerweise hasse ich es, wenn wir umziehen müssen. Dauernd neue Freunde finden und neue Schule. Ich hatte mir geschworen, dass ich dieses Mal einen auf Einzelgänger mache, aber dann hab ich dich gesehen und diese Ähnlichkeit. Das kann kein Zufall sein. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen.“ Deine Stimme verstummte nicht. Sie war immer da, wenn kein Unterricht stattfand. Sie war da, genauso wie der Argwohn unserer Klassenkameraden.
„Es wäre besser, wenn du dir einen anderen Sitzplatz suchen würdest.“ Ich versuchte, dich von mir zu stoßen. Deine verlockende Wärme raubte mir den Blick für die kalte Wirklichkeit.
Es gab hier keine Freundlichkeit für mich. Dieses Gebäude war das reinste Kriegsgebiet für mich und auch wenn du jetzt ein Verbündeter zu sein schienst, so würdest du dich am Ende auf die Seite des Feindes schlagen.
„Wieso denn? Ich mag es neben dir.“ Du verstandst nicht und dein irritierter Blick sprach Bände.
Du solltest verschwinden, solange es noch ging, und vor allem aufhören, dich zu belügen. Neben mir war dir dein Unglück sicher, das du dann zu meinem machen würdest. So war es immer und so wird es immer bleiben.
„Außerdem ist es doch witzig, wenn wir die Lehrer mit unserer Ähnlichkeit verwirren.“ Schon wieder. Dich schien nur mein Aussehen zu interessieren. Diese trügerische Gleichheit, die alle um uns herum irritierte, doch an sich, auch wenn unsere Gesichter sich ähnelten, so war dort die Kleidung, die für jeden hier Zeichen genug sein sollte, aber es reichte nicht. Sie sahen uns und erkannten mich nicht.
„Wir müssen jetzt in einen anderen Raum.“ Meine Worte waren ruhig und ich packte wie alle anderen meine Sachen zusammen. Sofort folgtest du meinem Beispiel und wir verließen gemeinsam das Zimmer, um dann zum Chemieraum zu gehen.
Fröhlich summtest du ein Lied neben mir und dein Lächeln färbte auf mich ab, doch als hätte sie es gespürt, rempelte mich Jessica grob an. Dabei riss sie mir meine Umhängetasche von der Schulter. Die Tatsache, dass ich den Tragegurt aber festhielt, verhinderte, dass sie zu Boden fiel. Dein Lied verstummte.
„Was ist ihr Problem?“, knurrtest du neben mir und ich lächelte nur traurig, als ich den pochenden Schmerz in meiner Schulter ignorierte und meine Tasche wieder schulterte. „Der Gang ist breit genug. Sie hätte dich nicht anrempeln müssen. Oder ging der Angriff gegen mich? Schließlich sehen wir uns ähnlich. Vielleicht hat sie uns verwechselt.“
Deine irrsinnige Spekulation ließ mich auflachen.
Wie kommst du denn auf diesen Schwachsinn? Jessica weiß ganz genau, wer von uns beiden du bist. Sie lässt mich nur spüren, dass sie mich noch mehr hasst, weil du dich für mich und nicht für sie entschieden hast.
„Nein.“ Meine Antwort war kurz und knapp.
Zu kurz für dich, denn die Verwirrung kam zurück in dein Gesicht und du kräuseltest irritiert die Augenbrauen.
„Was macht dich da so sicher? Schließlich sehen wir uns echt zum Verwechseln ähnlich. Die Lehrer kriegen es ja nicht einmal gebacken, obwohl wir unseren festen Platz haben.“
Schon wieder. Kennst du denn kein anderes Thema? Interessierst du dich nur dafür? Das ist doch totaler Schwachsinn. Als wäre das so toll. In erster Linie ist es nervig. Warum kannst du nicht jemand anderen ähnlich sehen?
„Ja, ich versteh es auch nicht.“ Ich versuchte, das Gespräch zu vermeiden, doch du bliebst. Mit deinen Worten, deiner Nähe und deiner Wärme. Du wolltest nicht mehr weggehen, auch nicht als wir im neuen Raum ankamen. Natürlich war der Platz neben mir frei, weil ich von der Klasse gemieden wurde. Jetzt nicht mehr, denn sofort nahmst du ihn für dich ein. Dein Lächeln wurde breiter und in deine Augen trat ein begeistertes Glitzern.
„Schon krass wie ähnlich wir uns sind.“ Deine Stimme war nur ein Hauch, doch er reichte aus, um die Botschaft gänzlich eiskalt in mein Herz zu hämmern: Du bist nur hier, weil wir uns ähnlich sehen. Nur deswegen und aus keinem anderen Grund.
„Es heißt doch, dass jeder einen Doppelgänger auf der Welt hat. Tada, du hast deinen gefunden. Können wir das Thema jetzt gut sein lassen, okay?“ Ein dumpfer Schmerz jagte durch mein Herz und ich konzentrierte mich krampfhaft auf das Pult vor mir. Ich wollte deine Reaktion auf meine Worte nicht sehen. Nicht erkennen, was ich dir damit vielleicht angetan habe, und deine Stimme verstummte für den Rest des Schultages.
Ich hatte Recht. Ich interessiere dich nicht. Du willst nur wissen, warum wir uns so ähnlich sehen. Wäre sie nicht, dann hättest du mich niemals wahrgenommen und darum ist es gut, wenn dieser Kontakt nicht tiefer geht. Unsere Wege müssen sich trennen. So schnell wie möglich und dürfen sich nie wieder berühren. Ja, nie wieder.
Du schwiegst den Rest des Schultages, doch du bliebst an meiner Seite. Stumm und leise, aber deine Wärme war immer spürbar. Genauso wie dieser sanfte Duft nach Moschus, der mich den ganzen Tag begleitete und kaum schlug das letzte Mal der Schulgong, trennten sich unsere Wege am Tor.
„Bis morgen, Tsuki.“ Eine so belanglose Floskel, doch Worte, die ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte und mein geschundenes Herz sanft küssten. Deine Wärme verschwand und hinterließ die altbekannte Kälte. Sie kroch meine Arme hoch und krallte sich in mein Herz, um all die Wunden, die sich durch deine Anwesenheit langsam zu schließen begannen, wieder aufzureißen.
Ein trauriges Lächeln legte sich auf meine Lippen und ich atmete tief durch, um dann meinen Heimweg anzutreten.
Lass mich bitte gehen. Hör auf, mich mit falschen Versprechen zu locken. Ich will nur den Tag überleben. Daher, lass ab von mir und geh deinen eigenen Weg. Mir geht es gut, so wie es ist. Glaube mir, das ist die Wahrheit. Daher, verschwinde wieder und lass mich alleine. Denn das ist mein Leben und damit kann ich umgehen. Deine Nähe dagegen ist zu viel. So viel, dass sie mich zerstören wird.
Aber du warst nun in meinem Leben und dachtest gar nicht mehr daran, zu gehen. Nicht solange, bis es dir gänzlich gehörte und du es zerbrachst.
Kapitel 2 Wer bist du?
Mit einem leisen Klicken fiel die Tür hinter mir ins Schloss. Ich ließ meine Schultasche im Flur auf den Boden sinken und hörte schon das freudige Quieken aus meinem Zimmer. Es zauberte ein Lächeln auf meine Lippen und nahm mir die Schwere von meinem Herzen.
„Ja, dir auch ein herzliches Hallo, Akirai. Ich komme gleich. Weißt ja, erst einmal essen und telefonieren.“ Ich lachte kurz auf, als die Freiheit, die mich immer in meinem Zuhause heimsuchte, auch die letzte Schwere von meinen Schultern nahm. Meine Mutter aß in der Mensa und kam nicht nach Hause dafür. Wir sahen uns unter der Woche nur abends.
Mein Weg führte mich in die Küche und dort direkt zu unserem Kühlschrank, der in einer Ecke stand. Mit einem kräftigen Ruck öffnete ich die Tür und tauchte in seinen kühlen Schlund ein, um die Tupperdose mit meiner Portion des Mittagessens herauszuholen. Es war das letzte Stück der Lasagne, die wir am Wochenende hatten.
Ich stellte sie in die Mikrowelle und schaltete diese ein. Während der Teller sich drehte, griff ich nach dem Haustelefon im Flur und rief bei meiner Mutter in der Arbeit an. Das war unser Ritual, damit sie wusste, dass ich sicher zuhause angekommen war. Seit diesem einen traurigen Zwischenfall bestand sie darauf und wenn es sie beruhigte, dann sollte sie es haben. Ich brach mir damit keinen Zacken aus der Krone.
Es klingelte nur zweimal, als schon ihre Stimme erklang: „Hallo, Tsuki, bist du gut nach Hause gekommen bist? Wie geht es dir? Wie war die Schule heute?“
Ich lächelte, denn ihre Stimme beruhigte mich jedes Mal, auch wenn ich schon lange nicht mehr ehrlich auf diese sporadischen Fragen antwortete. „Passt schon. Schule war anders heute. Wir haben einen neuen Mitschüler bekommen.“
„Einen neuen Mitschüler? Ist er nett? Wie heißt er denn?“
„Sein Name ist Taiyo Hikari.“
„Taiyo Hikari? Ein … ein seltsamer Name.“
„Findest du? Tsuki Kage fällt hier auch eher auf.“ Ich verdrehte genervt die Augen. Wieso ignorierte sie immer wieder, dass wir nicht gänzlich in die Kultur passten?
„Ja, aber wir sind Japaner. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie auch Japaner sind?“
„Sehr sogar, weil wir uns zum Verwechseln ähnlich sehen.“
„Echt? Das ist jetzt schon verrückt.“ Sie wirkte beunruhigt, doch obwohl ich wartete, dass noch etwas kam, schwieg sie.
„Das findest nicht nur du, Mama. Taiyo war auch ganz besessen davon. Er … er war sehr anhänglich.“ Langsam ging ich aus dem Flur zurück in die Küche und ließ mich an unseren kleinen Esstisch nieder.
„Das ist doch gut. Dann hast du endlich wieder einen Freund und kommst vielleicht öfters raus aus deinem Zimmer. Ich hatte schon Sorge, dass sowas nie passieren würde.“ Die Schwere war aus ihrer Stimme wieder verschwunden. Ich wollte gerade nachhaken, doch das Klingeln der Mikrowelle unterbrach mich und meine Mutter nutzte die Chance sofort.
„Dein Essen ist fertig. Dann lass es dir schmecken. Wir reden heute Abend weiter, okay?“ Sie wirkte kurz angebunden, und kaum bestätigte ich ihr die Planung, legte sie schon auf. Ich selbst lauschte noch einer Weile dem Freizeichen, bevor ich ebenfalls die Verbindung unterbrach und mein Essen aus der Mikrowelle holte.
Heißer Dampf stieg empor und der Teller war nur mit Hilfe von einem Handtuch berührbar, sodass ich ihn erst einmal auf den Tisch stellte und mir Besteck holte. Das leise Rascheln von Stroh und Heu drang zu mir durch und mit einem Klicken sprang der Kühlschrank surrend an. Ansonsten war es still in der Wohnung. Eine Stille, die ich genoss. Immer wieder erwischte ich meine Gedanken dabei, wie sie zu dir zurückkehrten.
Dein Lächeln, deine sanften Worte und deine unumstößliche Nähe. Diese Selbstverständlichkeit, mit der du an meiner Seite bliebst. Etwas, was ich schon seit Jahren nicht mehr erfuhr. Doch auch wenn sich meine Mutter darüber freute, war ich selbst zwiegespalten. Denn schon lange hatte sich niemand mehr in meine Nähe begeben, der mich später nicht verraten hatte. Alle erlagen früher oder später Jessicas Verlockungen. So wird es dir auch ergehen. Ganz sicher.
Um nicht mehr an dich zu denken, ließ ich meinen Blick durch den großen Raum wandern. Wir hatten eine Drei-Zimmer-Wohnung. Küche, Ess- und Wohnzimmer teilten sich den größten Raum in der Wohnung. Dann hatte meine Mutter ihr eigens Reich, genauso wie ich. Vom kleinen Flur gingen alle vier Zimmer weg, daher stand dort nur ein kleiner Schuhschrank und die Garderobe hang an der Wand darüber. Das kleine Bad lag direkt rechts neben der Wohnungstür und war gerade groß genug für eine Person. Es hatte nur eine Dusche, ein Waschbecken und eine Toilette, aber das reichte für uns vollkommen. Die Küche bestand nur aus Kühlschrank, einer zweiteiligen Theke und einem Herd. Auf der Theke selbst standen die Mikrowelle und der Brotkasten. Die Kochutensilien und Bestecke waren in den Schubladen und Schränken verstaut. Ich saß an unserem kleinen Esstisch zwischen Herd und Couch, die zusammen mit einem Fernseher, einem Regal und einem kleinen Tischchen unser Wohnzimmer bildete.
Mein Zimmer war gegenüber von der Wohnungstür. Das meiner Mutter lag neben dem Badezimmer. Die Wohnung war klein und kuschelig, was ich an ihr mochte. Man konnte sich darin nicht verlieren und wir hatten keinen Wunsch nach mehr Platz. Es reichte gänzlich für uns zwei. Wer sollte schon noch dazu kommen? Ja, wir zwei waren uns genug. Mehr als genug.
Die Lasagne hatte mittlerweile eine essbare Temperatur und so nahm ich das Besteck in die Hand, um mit dem Essen anzufangen. Unter die Geräusche der Wohnung mischte sich nun das Klappern des Metalls auf dem Porzellanteller ein und begleitete mich durch meine Mahlzeit. Genauso wie der Gedanke an dich, der stetig bei mir blieb. Ich versuchte, zu verstehen, wer du warst und warum du jetzt in mein Leben tratst. Doch ich kam auf kein Ergebnis. Noch nicht …
Ich schob mir die letzte Gabel mit Lasagne in den Mund und noch während des Kauens stand ich auf, räumte meinen Teller weg und ging mit meiner Umhängetasche in mein Zimmer. Sofort hörte ich das freudige Quieken aus der wichtigsten Ecke, so wie das Rascheln im Heu. Der Raum selbst hatte nur ein Bett, einen Schreibtisch, zwei Regale und Akirais Käfig.
Meine Tasche ließ ich zum Schreibtisch rutschen, der gegenüber der Tür unter dem Fenster stand, bevor ich zum Käfig schritt. Ich öffnete die Tür und holte meine pelzige Freundin heraus. Ruhig ließ ich mich mit ihr auf mein Bett, das rechts neben der Tür stand, fallen. Mein Blick fiel auf das Hängeregal, das die Wand darüber beanspruchte. Ich wusste, dass dort ein paar Blu-Rays und Mangas zu finden waren, doch sie interessierten mich gerade nicht.
Aus Gewohnheit setzte ich Akirai auf meine Brust. Sofort schnupperte sie und stupste mein Kinn an, damit ich sie streichelte. Normalerweise machte ich jetzt Hausaufgaben, doch mein Kopf fühlte sich wirr und flüchtig an. Egal, wohin ich meine Gedanken lenkte, sie kehrten immer wieder zu dir zurück. Zu deinem Lächeln und zu deinem ganzen Sein.
Taiyo Hikari, ein japanischer Name, wie meiner. Unsere Abstammung von diesem Land konnten wir nicht leugnen. Das schwarze Haar, genauso wie die runde Gesichtsform und die mandelförmigen Augen. Meine Mutter stammte aus Japan, daher war auch mein Name aus ihrer Muttersprache: Tsuki Kage. Wenn man unsere Namen übersetzte, dann würde grob Sonnenlicht und Mondschatten dabei herauskommen. Ich musste lachen. Das war doch Irrsinn. Vornamen konnten sich die Eltern aussuchen, aber die Nachnamen doch nicht. Es war sicher nur ein blöder Zufall.
Ich stockte, als der Anhänger von meiner Kette über die Schultern nach unten fiel, sodass ich ihn kurzerhand wieder hervorholte. Zwei Engelsflügel lagen spiegelverkehrt aufeinander. Der eine silbern, der andere golden. Trennten sich oben und unten leicht voneinander. Ja, die Anhänger unserer Ketten waren der einzige Unterschied in unserem Schmuck.
Das Einzige, was nicht zu unseren Namen passte, denn während du rote Steine, Gold und als Motiv die Sonne trugst, war mein Schmuck silbern, mit blauen Steinen und in der Form eines Sichelmondes. War das Zufall? Konnte das noch Zufall sein?
Ja, vielleicht ein Schmuckstück, doch wir trugen beide einen Ring, eine Uhr, ein Armband und Ohrstecker. Ich wusste, dass auf meinem Armband mein Name in japanischen Schriftzeichen und mit einem Sichelmond eingraviert war. Auf der unteren Seite waren auch zwei japanische Wörter und eine Sonne. Lange hatte ich darüber nachgedacht, was es bedeuten könnte, doch nun erwachte in mir ein Verdacht. Konnte es sein, dass dort dein Name stand? Aber wie sollte das möglich sein? Wir kannten uns nicht und hatten uns heute überhaupt das erste Mal gesehen. Das war totaler Wahnsinn und Blödsinn sowieso. Energisch schüttelte ich den Kopf und strich noch einmal über das weiche Fell von Akirai, die sich daraufhin zufrieden ausstreckte. Sie war ein hellbraunes Rosetten-Meerschweinchen mit unterschiedlichen großen schwarzen und weißen Flecken. Ihre Augen waren schwarz umrandet, was aussah, als würde sie eine Maske tragen.
„Heute war ein verrückter Tag, Akirai.“ Ich schüttelte den Kopf, als ich sie weiter streichelte. „Das glaubst du mir bestimmt nicht. Wir haben heute einen neuen Mitschüler bekommen. Sein Name ist Taiyo Hikari. Ja, ich weiß, klingt genauso japanisch wie meiner. Aber das ist nicht das einzige, was seltsam ist. Er sieht mir auch noch sehr ähnlich. Seine Augen sind nur leicht heller als meine und auch die Haare ein wenig länger, aber sonst, könnte man uns für Zwillinge halten.“
Akirai zuckte mit der Schnauze nach oben und fiepte, was mich lachen ließ. „Ja, ich weiß, was man sagt. Japaner sehen alle sehr ähnlich aus. Aber das ist ja nicht alles. Er trägt ähnlichen Schmuck wie ich. Die gleiche Anzahl, nur dass seiner aus Gold mit roten Steinen ist und eine Sonne abbildet. Das kann doch kein Zufall sein. Auch unsere Namen. Sonnenlicht und Mondschatten. Das ist doch …“
Erneut lachte ich auf, als ich mir des Irrsinns bewusst wurde, bevor ich mich erhob. Akirai rutschte dadurch automatisch auf meine Hand und ich streichelte sie weiter. „Das kann doch nicht mehr Zufall sein, oder? Aber was ist es dann, Akirai? Was ist es, wenn kein Zufall? Schicksal? Wer bist du, Taiyo Hikari?“
Sanft stupste mich Akirai an meiner Brust an und sofort liebkoste ich sie wieder, während ich weiter auf die bunte Bettdecke, die fein säuberlich am Fußende meines Bettes zusammengelegt war, vor mich hinstarrte. Ein schwarzhaariger Mann in rotem Trainingsanzug war darauf abgebildet, umringt von goldenen Kugeln mit roten Sternen darin.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Morgen würden wir uns wiedersehen. Dann würdest du erneut an meiner Seite sein und mich mit unserer Ähnlichkeit nerven. Ich verstand es doch auch nicht, aber desto länger ich darüber nachdachte, umso mehr wurde mir bewusst, dass es kein Zufall sein konnte. Dort war mehr. So unglaublich viel mehr, aber wollte ich dieses mehr erfahren?
Zweifel stürmten mein Herz und ich starrte aus dem Fenster, doch ich sah nur den großen Baum, der schon immer dort stand. Seine grünen Blätter versperrten mir die Sicht auf mehr und somit glitt mein Blick weiter. Suchte nach etwas, an dem er sich festhalten konnte, bevor ich mich weiter in meinen Gedanken verlor.
Taiyo Hikari, du warst nett zu mir. Von der ersten Sekunde an. Wolltest mein Freund sein. Hast die anderen abgewiesen. Schon lange hatte keiner mehr ein freundliches Interesse an mir gehabt. Sie zogen mich auf, grenzten mich aus, ärgerten mich und verspotteten mich. Nur weil ich in ihren Augen anders war. Anders auf Grund meiner Kleidung, meiner psychischen Krankheit und meiner Herkunft.
Ich stoppte das Streicheln von Akirai, als mein Blick auf die Netzhandschuhe fiel. Dieses Kleidungsstück trug ich nicht nur, weil es mir gefiel, sondern weil es auch verdeckte, was mich belastete und warum mich alle verspotteten und ausgrenzten. Ich biss mir auf die Unterlippe und schob die Gedanken beiseite.
Kurz glitt mein Blick auf meine Umhängetasche, die liebesbedürftig bei meinem Schreibtisch lag. Sie schrie danach, dass ich meine Hausaufgaben machte, doch mein Kopf fühlte sich zu voll und vor allem schwer an. Das würde nichts bringen. Also wählte ich die andere Richtung.
Ich musste hier raus. Ein wenig frische Luft schnappen und dann kam ich hoffentlich auf andere Gedanken oder zumindest würdest du endlich aus ihnen verschwunden sein. So hoffte ich und mit dieser Hoffnung im Herzen trat ich auf den Flur, zog meine Schuhe an – Akirai immer noch auf dem Arm – griff nach dem Haustürschlüssel und trat dann ins Freie.
Sofort schlug ich die Richtung von unserem Stadtpark ein. Ich verbrachte an schönen Tagen meistens meine Nachmittage dort. Akirai konnte herumlaufen und ein wenig frisches Gras fressen und ich wurde dmeine schweren Gedanken los. Daher hoffte ich, dass es auch dieses Mal so sein würde und ich von dir befreit würde. Du, der mich überallhin verfolgtest. Denn in meinen Gedanken waren sie immer da: Dein freundliches Lächeln und deine wunderschönen Augen. So schön und unendlich warm, dass man in ihnen versinken wollte. Nur vergehen und nie wiederkehren. Niemals wieder.
Kapitel 3 Gleich und doch verschieden
Der Geruch von frischem Gras, Blumen und Bäumen stieg in meine Nase. Akirais weiches Fell strich sanft über meinen Hals, bevor sie an meiner Haut schleckte. Ich lauschte dem harmonischen Gesang der Vögel und ließ die warmen Sonnenstrahlen die trüben Gedanken vertreiben.
Der Kies knirschte leise unter meinen Schuhen, als ich den sandigen Weg entlang ging und die entgegenkommenden Personen mit einem Nicken grüßte. Einige kannte ich vom Sehen und manche sogar beim Namen, da wir uns regelmäßig hier begegneten. Der Park war nicht weit von meiner Wohnung entfernt und langweilig genug, dass meine Klassenkameraden ihn nicht aufsuchten.
Ein freudiges Quicken drang an mein Ohr, als wir uns allmählich unserem Lieblingsplatz nährten: eine Bank im Schatten eines großen Baumes. Weit weg vom Sportplatz oder dem Café, das hier für das leibliche Wohl der Besucher sorgte. Ich war nur einmal dort gewesen, aber hatte es sofort bereut, als ich Jessica und ihren Freundinnen begegnet war.
Warum konnten sie mich nicht in Ruhe lassen? Es sollte doch nicht allzu schwer sein einander zu ignorieren. Ich verlangte ja nicht einmal, dass sie mich mochten oder sich mit mir beschäftigten. An sich wollte ich nur diese Zeit, so gut es ging, überstehen und dann ein Leben aufbauen, in dem man mich schätzte und mit Freunden, die mich verstanden.
Ich nahm auf der Bank Platz und setzte Akirai vorsichtig in die Wiese. Sie blieb immer an meiner Seite und mümmelte zufrieden das frische Gras. Daher machte ich mir keine großen Sorgen, dass sie weglaufen könnte. Erneut strich eine angenehme Brise über mich hinweg und ich schloss genießerisch die Augen.
Ich hörte von weiter weg Stimmen, doch der fröhliche Gesang der Vögel übertönte sie die meiste Zeit, sodass ich diese Einsamkeit genoss und den Frieden auf mich wirken ließ. Ich wünschte mir, dass jeder Tag so sein könnte und ich nie wieder zurück in die kalte Wirklichkeit musste. Doch mir war klar, dass diese Momente immer nur von kurzer Dauer waren und ich mich der Realität stellen musste.
Plötzlich spürte ich eine Bewegung hinter mir und im nächsten Moment lagen schon ein Paar Hände auf meinen Augen. Ich stoppte und unterdrückte den panischen Impuls aufzuspringen, denn sie waren viel zu groß und rau, um Jessica zu gehören. Auch schlich mir ein herber Duft in die Nase, der jegliche Weiblichkeit ausschloss. Zumindest wenn es um meine Klassenkameradin ging.
Der fremde Puls tippte sanft gegen meine Haut. Er war zu schnell. Fast so schnell wie mein eigener, der unter der Aufregung hochgefahren war. Ich wartete auf eine Frage oder ähnliches. Irgendetwas, was den Neuankömmling verraten würde, doch es kam nichts. Nur eine neue Brise, die das Gezwitscher der Vögel und das Stimmengewirr mit sich brachte.
Akirai drückte sich an mein Bein, was mich stutzig machte. Ihr panischer Schrei drang zu mir durch. Ich schnellte sofort nach vorne und griff nach ihr, um sie auf den Arm zu nehmen. „Akirai!“
Mein Blick fiel auf eine weiße, schwarz getigerte Angorakatze, die vor mir stand und mein Meerschweinchen mit hellblauen Augen musterte. Ihr Gesicht war braun und hatte auf ihrer Stirn ein schwarzes M. Sie trug rehbraune Stiefel und sah gepflegt aus. Ich hatte diese Katze noch nie hier bemerkt.
„Kirika! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du nicht die Tiere von anderen auffressen sollst? Du kriegst zuhause genug zum Fressen!“ Deine Stimme hinter mir klang amüsiert und nur halb so ernsthaft, wie sie sollte, nachdem deine Katze gerade mein Meerschweinchen bedroht hatte.
Aber das konnte doch nicht sein. Wieso warst du jetzt schon wieder hier bei mir? Gab es denn kein Entkommen vor dir? Was sollte ich jetzt tun?
Ich drehte mich ruckartig zu dir um und wollte einen Schritt ausweichen, als du so nah bei mir warst. Nur die Bank zwischen uns, doch ich stieß gegen einen felligen Widerstand, der mich straucheln ließ. Mit einem Ausfallschritt erlangte ich mein Gleichgewicht zurück und sah in dein breit grinsendes Gesicht.
„Was machst du hier?“, hauchte ich fassungslos. Wie konnte es sein, dass du hier warst? Du wolltest dich doch nicht mit den anderen treffen oder doch? War ich denn nirgends vor dir sicher?
„Ich gehe mit meiner Katze Kirika spazieren. Sieht man das nicht?“ Dein Lächeln wurde eine Spur breiter. Amüsierte dich mein Anblick? Warst du hier, um mich auszulachen? Wolltest du wie alle über mich herziehen, weil ich mein Meerschweinchen dabei hatte? Wieso konntest du mich nicht ignorieren?
„Doch, irgendwie schon, aber du bist mir bestimmt nachgeschlichen“, murmelte ich eher zu mir selbst. Du hörtest meine Worte und lachtest auf.
„Nein und ja. Ich bin echt erst wegen des Spaziergangs mit Kirika hergekommen, damit sie ihren täglichen Auslauf bekommt. Aber dann habe ich dich gesehen und bin dir gefolgt, um zu sehen, was du tust und um sich vielleicht mit dir zu unterhalten. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du was zum Fressen für Kirika dabei hast.“
„Akirai ist nichts zum Fressen!“, empörte ich mich. Du lachtest erneut auf, was mir einen Stich ins Herz versetzte. Ich schluckte trocken, um dieses Gefühl loszuwerden. Du durftest mich nicht so berühren oder gar verletzten. Deine Worte und Taten sollten nicht dieses Gewicht für mich haben. Unwichtig. Du solltest unbedeutend für mich sein. Egal. Einfach nur egal.
„Ja, das habe ich ja nie behauptet. Aber Kirika ist halt eine Katze. Vielleicht wollte sie auch nur spielen.“ Mit ruhigen Schritten kamst du um die Bank und standest direkt vor mir. Dein Aftershave verdrängte den Duft der Natur um mich herum und ich versank in deinen himmelblauen Augen. Du sahst immer wieder zu meinem Schmuck.
„Es klang nicht so als wollte Kirika wirklich nur spielen“, flüsterte ich gebannt und starrte auf deine Lippen, die sich zu deinen nächsten Worten elegant bewegten.
„Ja, Kirika kann da gerne mal ein wenig grob sein. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass sie dein Meerschweinchen nicht fressen wollte.“
„Akirai. Sie heißt Akirai.“ Warum sagte ich dir das? Es ging dich nichts an. Doch das sanfte Lächeln, das sich nun in deinem Gesicht zeigte, hinterließ ein angenehmes Ziehen in meinem Bauch.
Du sahst erneut nach unten. Deine nächsten Worte zerrissen den Bann und schleuderten mich wieder zurück in die Wirklichkeit. „Schon komisch wie ähnlich wir uns sind. Wir tragen sogar fast identischen Schmuck. Als würden wir damit verzweifelt jemand suchen.“
Du kamst einen Schritt näher und dein Atem strich über meine Wange, bevor der Schmerz zurückkam. Es ging dir immer nur um die Ähnlichkeit. Nur deswegen standest du vor mir. Allein aus diesem Grund hattest du mich angesprochen. Wäre diese Tatsache nicht, dann hättest du mich wie alle anderen ignoriert.
Diese Erkenntnis schmerzte mehr, als jedes Wort von dir es jemals gekonnt hätte, und ich versuchte, den Schmerz hinter einem traurigen Lächeln zu verstecken. Doch an dem erschrockenen Flackern in deinen Augen erkannte ich, dass es mir nicht gelang.
„Wie alt bist du?“ Eine simple Frage, die mich jedoch zögern ließ. Warum stelltest du sie mir überhaupt? Wir waren in derselben Klasse. Daher konnten wir gar nicht allzu weit entfernt vom Alter sein. Ich holte tief Luft, weil ich Angst hatte, dass mir meine Stimme sonst den Dienst versagen würde. „Ich bin sechzehn Jahre alt.“
Das Flackern in deinen Augen wurde wilder und dein Lächeln schwand unter der Verwirrung, die dir diese Antwort bescherte. Kurz erwachte der Impuls in mir dich nach ihrem Grund zu fragen, doch das Gefühl, dass ich so wenig wie möglich mit dir zu tun haben wollte, stoppte mich. Ich sollte am besten gehen und nie wieder zurücksehen. Dich vergessen und vor allem mich nicht weiter auf dich einlassen. Das Ganze konnte nur schief gehen. Sowas hatte noch nie funktioniert.
„Ist dir in deinen Netzhandschuhen nicht zu warm, so dünne Maschen wie die haben?“ Du schienst die Unterhaltung fortführen zu wollen. Instinktiv legte ich meine Arme aufeinander und hielt sie fest. Es war mir unangenehm, wenn man mich auf sie ansprach. Doch noch schlimmer war es, wenn das Gespräch auf das fiel, was sie verdeckten.
„Nein, es geht schon. Man gewöhnt sich an vieles. Ich finde es angenehm sie zu tragen.“ Du hobst skeptisch eine Augenbraue und wolltest noch einmal nachsetzen. Aber ich ging einen Schritt zurück. Ich wollte mich nicht weiter mit dir unterhalten. Nicht die Fragen beantworten, die dann immer kamen. Dir nicht erzählen, wie es in meinem Inneren wirklich aussah. Du würdest es auch nur gegen mich benutzen, wie alle anderen vor dir.
Noch zwei weitere Schritte, als ich schon über meine Schulter deutete. „Ich … ich muss jetzt auch wieder gehen.“ Mit diesem Satz drehte ich mich schon um, doch deine Stimme blieb und mit ihr auch du.
„Halt! Wo willst du denn schon wieder hin?“ Deine Schritte knirschten synchron mit meinen über den sandigen Weg, den wir entlang gingen. Ich wich deinem Blick aus, sah lieber auf die Katze, die neben uns herlief und streichelte Akirai beruhigend durch das Fell.
„Nach Hause. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht fertig und meine Mutter kommt bald heim. Sie hat es nicht gerne, wenn ich dann nicht fertig bin.“
Es war eine Lüge.
Meine Mutter war eine herzensgute Frau und sie war selten auf mich wütend. Zumindest nicht wegen so Kleinigkeiten wie Hausaufgaben. Nicht einmal damals wurde sie zornig. Nein, nur unendlich traurig. Ich hatte so eine Mutter nicht verdient.
„Dann wohnst du hier in der Nähe?“, haktest du weiter nach und liefst ruhig neben mir her. Dein Blick suchte meinen, doch ich starrte auf den Boden vor unseren Füßen. Deine Frage fuhr wie ein Blitz durch mich hindurch und ließ mich ruckartig den Kopf heben. Du darfst niemals erfahren, wo ich wohne! Dann würde ich dich nie wieder loswerden!
Ich sah dich mit weit aufgerissenen Augen an, bevor ich mich wieder fing und mit den Schultern zuckte. „Kann schon sein.“ Meine Finger suchten Akirais tröstende Nähe und ihr sanftes Schlecken beruhigte zusätzlich. Ihre Nähe gab mir den Mut, den ich für dieses Gespräch brauchte.
„Wie kann schon sein? Du musst doch wissen, wo du wohnst.“ Meine Antwort war dir nicht genug. Ich knurrte tief, während ich weiter lief und hoffte, dass du die Verfolgung endlich aufgabst. Deine Schritte verschwanden nicht von meiner Seite.
„Ja, klar, weiß ich, wo ich wohne. Aber woher soll ich wissen, was für dich nah ist?“, beantwortete ich aggressiv deine Frage und begegnete wütend deinem Blick. Deine Augen huschten unruhig über mein Gesicht und ich konnte sehen, wie es dahinter arbeitete. Immer wieder öffnete sich dein Mund, doch dann kam keine Antwort über deine Lippen.
Ich biss mir auf die Unterlippe. An sich wollte ich nicht laut werden, doch deine Nähe setzte mich unter Druck. Ich wollte, dass du nur verschwinden und mich in Ruhe lassen würdest. Das konnte doch nicht allzu schwer sein.
Dennoch blieb ich schweigend vor dir stehen. Du sagtest kein Wort mehr, sondern sahst mich nur an. Dein Blick schien alles von mir zu wollen und nahm jede noch so kleine Information gierig auf, um dann eine eisige Kälte an dieser Stelle zu hinterlassen. Jede Sekunde wuchs mein Wunsch zu verschwinden, bis er mich erdrückte.
„Was habe ich dir getan? Warum bist du so abwesend zu mir? Liegt es an unserer Ähnlichkeit oder bin ich dir zu aufdringlich?“ Deine Frage war nur ein Flüstern im Wind, das hauchzart meine Ohren umspielte und mein Herz schwerer machte. Der Biss auf meine Unterlippe wurde stärker und ich schmeckte Blut. Sofort ließ ich los und drehte mich im gleichen Moment von dir weg, um meinen Weg fortzusetzen.
Ich wusste nicht, was ich dir antworten sollte. Alles in mir schrie danach, dich von mir zu stoßen. Doch in mir war dieses kleine Fünkchen namens Hoffnung, das sich tapfer gegen all die Grausamkeiten stemmte, die mein Geist für dich bereit hielt. Diese kleine sanfte Stimme, die mir zuflüsterte, dass du es sein könntest. Dieser Mensch, der endlich wieder ein Freund für mich werden könnte. Ein Freund, den ich mir so lange schon wünschte.
„Komm, Kirika. Wir gehen nach Hause.“ Die Trauer in deiner Stimme war echt und versetzte mir einen Stich in meine Brust. Kurz stockte mein Schritt, aber dann spürte ich Akirais Schlecken und holte zittrig Luft. Nein, es war gut so. Solange ich alleine blieb, konnte mir keiner mehr wehtun. Dann war ich sicher und das war das einzige, was wirklich zählte.
Dennoch konnte ich die einzelne Träne nicht zurückhalten, die über meine Wange lief und auf Akirais schnüffelnde Nase zerplatzte. Sofort schleckte sie die nasse Spur weg, doch dieses beklemmende Gefühl in meiner Brust konnte sie mir nicht nehmen. Es bohrte sich tiefer, sodass ich mich an meinen Vorsatz klammerte und ihn mir immer wieder in Gedanken vorsagte: Sicher sein und am Leben bleiben. Für Mutter. Damit sie nie wieder so sehr weinen muss. Nie wieder …
Die langsam untergehende Sonne tauchte mein Zimmer in ein mystisches Rot, das zum Träumen verleitete. Ich saß an meinem Schreibtisch über meine Hausaufgaben gebeugt und versuchte verzweifelt, diese Gleichung zu lösen. Normalerweise ging mir so etwas leicht von der Hand. Vor allem Mathematik war nie ein Problem für mich, doch jetzt waren dort keine Zahlen und Formen, sondern immer wieder dein Gesicht.
Ein leises Quieken neben mir holte mich zurück in die Wirklichkeit und dein Abbild verschwamm vor meinen Augen. Akirai saß auf dem Schreibtisch und stupste mich sanft mit ihrer Nase an. Ich streichelte sie und lächelte leicht.
„Danke, Akirai. Ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich fertig werde, sonst kommt Mutter nach Hause und ich sitze immer noch hier. Dann gäbe es nur wieder dumme Fragen, weil so etwas normalerweise nicht vorkommt, und das brauch ich echt nicht.“
Ich schüttelte bestimmt meinen Kopf, um auch den letzten Rest von dir zu vertreiben. Kurz tief Luft holen und dann war der Fokus da. Kein Lächeln, das mir die Sicht raubte und keine Schmetterlinge, die meine Gedanken zerstreuten. Mein Stift flog wie von Geisterhand über das Papier und erledigte die Hausaufgaben im gewöhnten Tempo.
„So, das wäre geschafft, Akirai.“ Ich streckte mich erleichtert, kaum dass ich das letzte Heft wieder in die Tasche steckte. Als Akirai schon an den Rand des Schreibtisches getrottet kam, um hochgenommen zu werden, lächelte ich leicht. Natürlich nahm ich sie wieder auf den Arm und kraulte sie sanft am Kopf.
„Danke, dass du mir dabei geholfen hast, den Fokus nicht zu verlieren. Ohne dich wäre ich jetzt noch nicht fertig. Dieser Taiyo bringt noch mein ganzes Leben durcheinander. Warum kann er sich nicht mit jemand anderen anfreunden wollen? Nur weil wir uns ähnlich sehen? Das ist doch totaler Quatsch.“ Ich schnaubte und hörte ihr leises Quieken gefolgt von einem kurzen Gurren, was mich beruhigte.
Mein Blick war auf mein Fenster gerichtet. Die Straße lag vor mir und die Bäume tanzten unter dem sanften Wind. Es schien immer noch die Sonne. Einige Passanten gingen vorbei.
„Ja, du hast recht. Ich sollte mich nicht so von ihm beeinflussen lassen. Aber irgendwie ist das alles …“ Ich stockte, als ich meinen Augen nicht traute. Auf der Straße gingst du mit deiner Katze, die brav wie ein Hund neben dir herlief.
Wieso warst du jetzt hier? Bist du mir etwa gefolgt? Nein, dafür warst du eindeutig zu langsam unterwegs, aber warum tauchtest du jetzt erst hier auf? Wohnst du etwa hier in der Nähe? Gab es denn gar kein Entkommen vor dir?
Ich sah dir nach, wie der Wind mit deinem Haar spielte. Dein Kopf war gesenkt, deine Hände steckten in den Hosentaschen und die Schultern hingen herunter. Du gingst nicht, sondern schlurftest eher. Deine Katze dagegen schritt leichtfüßig und mit erhobenem Schwanz neben dir her.
Ein Schauer glitt über meinen Rücken, als du stehen bliebst und dich dein Tier mit fragendem Blick kurz umrundete. Was war los mit dir? Es konnte nicht sein, dass mein Verhalten dich so stark beeinflusste. Du könntest dich mit jedem anfreunden. Die ganze Klasse wollte dein Freund sein, also solltest du von mir ablassen. Aber du bliebst jetzt stehen und fuhrst dir mit einer Hand übers Gesicht.
Deine Arme bewegten sich wild gestikulierend und die Passanten, die an dir vorbeigingen, sahen dich irritiert an. Du reagiertest nicht auf sie, sondern unterhieltest dich weiter mit deiner Katze.
„Der ist schon ein komischer Vogel, Akirai“, flüsterte ich und kraulte weiter mein Meerschweinchen in meinen Armen. Es war ein seltenes Verhalten, das hatte man mir schon öfters gesagt, aber Akirai genoss meine Nähe sehr. Vielleicht weil sie sonst keinen Artgenossen hatte, doch ein zweites Tier erlaubte mir meine Mutter nicht. Egal, wie oft ich ihr mit artgerechter Haltung kam, die Antwort blieb immer gleich: Kein Platz und kein Geld.
Erneut ein sanftes Brummen und leichtes Quieken. Dein Oberkörper fiel in sich zusammen, doch nur für eine Sekunde, dann standest du schon wieder aufrecht. Dein Kopf bewegte sich. Langsam in meine Richtung, genauso wie dein Körper, der sich mit drehte. Unsere Blicke trafen sich.
Ein Schauer glitt über meinen Rücken. Schmetterlinge explodierten in meinem Bauch, durch deren Wucht stieß ich mich erschrocken von meinem Tisch mit so viel Kraft ab, dass wir laut krachend gegen meine Zimmertür prallten. Akirais Angstschrei war die Folge, genauso wie sie zusammenzuckte und sich tiefer in meine Armbeuge verkroch, um dann ein besänftigendes Gurren ertönen zu lassen.
„Sorry, Akirai. Das wollte ich nicht, aber er durfte uns nicht sehen. Dann wäre es vorbei mit der Ruhe gewesen. Kommt nicht mehr vor. Versprochen“, sprach ich beruhigend auf sie ein und kraulte sie wieder hinter den Ohren.
Hast du mich gesehen? Es hat sich zumindest so angefühlt. Wieso sahst du zu mir hoch? Das war doch total bescheuert! Kommst du jetzt hier her?
Ich lauschte in den Raum, ob die Türklingel ertönte. Es blieb still. Nur Akirais leise Geräusche und das Rauschen meines Blutes im Ohr. Entweder hattest du mich nicht gesehen oder nicht erkannt. Egal was davon, meine Ruhe schien aktuell noch in Sicherheit zu sein.
Umständlich zog ich mich mit den Beinen samt Stuhl wieder zurück an meinen Tisch. Zum Glück war mein Zimmer klein, sonst würde das jetzt anstrengender sein. Das letzte Stück griff ich nach der Tischplatte und zog mich gänzlich heran. Sofort sah ich wieder auf die Straße, doch von dir war nichts mehr zu sehen. Du warst verschwunden und noch einmal lauschte ich in die Wohnung.
Würdest du jetzt doch klingeln? Suchtest du nach meinem Namen und überlegtest, ob es richtig war? Was sollte ich tun, wenn du jetzt vor meiner Tür stehen würdest? Aufmachen? Ignorieren? So tun als wäre ich gar nicht da und hoffen, dass du unseren Blickkontakt als Trugbild abstempeltest? Meine Gedanken blieben ungestört und nur das Ticken der Uhr im Wohnzimmer erfüllte die Stille. Du kamst nicht hierher, sondern warst verschwunden. Auf dem Weg nach Hause oder irgendwo anders hin. Konnte mir ja egal sein. Wieso warst du schon wieder in meinen Gedanken? Das war doch totaler Schwachsinn! Geh raus! Geh endlich raus da! Argh!
Akirai quiekte wieder und schleckte über meine Hand, die sich krampfhaft in meinen anderen Arm gekrallt hat. Nur langsam ließ ich locker und lächelte meine pelzige Freundin dankend an. „Du hast Recht. Es macht keinen Sinn, darüber zu grübeln.“
Ich erhob mich, um Akirai in ihren Käfig zu setzen. Sofort huschte sie durchs Einstreu und zu ihrem Heuhaufen, um etwas zu fressen. Ich griff nach ihrer Schüssel für das Frischfutter, um in der Küche ein bisschen Gemüse und Obst aufzuschneiden.