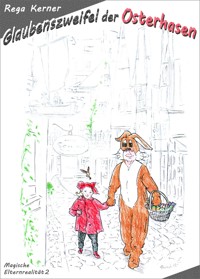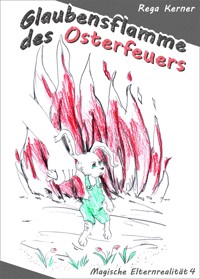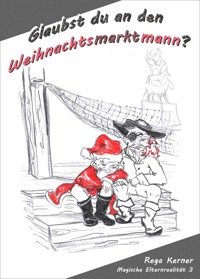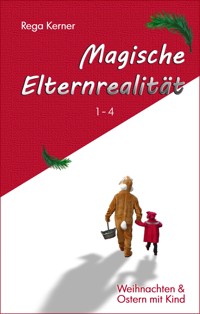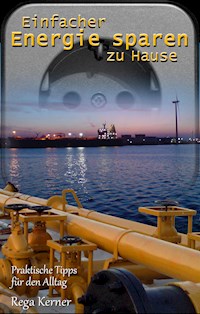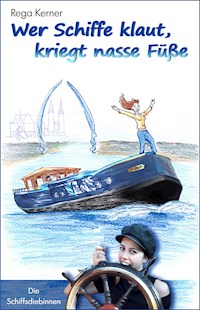4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: medienschiff.de
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was soll das arme Schwein auf einem Schiff? Vorher ahnte die Schifferin davon auch nichts! Hinterher … oh je, Nur soviel sei verraten: Das Schiffschwein öffnet dir die Tür in eine Welt, die kaum jemand kennt: Leben auf dem Binnenschiff. (Und zerwühlt dieses beschauliche Dasein gründlich.) Augenzwinkernd verrät es dir alle Tücken der Minischwein-Haltung und gewährt gleichzeitig Einblick ins Allerheiligste der Binnenschiffer, sowie in das Wesen der Schweine. Auf beengtem Schiffsraum kommen Menschlichkeit und Tierschutz zwangsläufig auf den Punkt, die Binnenschifferin entwickelt dadurch recht eigenwillige, humorvolle Ideen - unter anderem, wie wir die Welt ein wenig verbessern könnten. Und Situationskomik ist mit diesem Tier im Wohnzimmer sowieso vorprogrammiert. Die maritime Tiergeschichte, inklusive Reiseabenteuer, mit Schmunzel-Garantie: Für alle die Tiere oder Schiffe mögen. (Oder beides. Aber vielleicht noch mehr für jene, die noch gar nicht wissen, dass sie beides nach diesem Buch mögen werden.) Also, wer du auch bist: Willkommen an Bord, bei Minischwein "Spekje", Schiffshund "Lady" und der Frau des Kapitäns: Wir waren uns also einig. Bis wir, wieder einmal, vom Rhein in den Main einfuhren. "In einer Stunde kriegst du dein Schwein." Da sah ich sie wieder vor mir, die winzigen fröhlichen Ferkel, wie sie im vergangenen Jahr über das Schleusengelände flitzten. Ihre stolze Muttersau, die schimpfend, mit wackelndem Bauch und schwenkenden Zitzen hinter den Wildfängen her schnaufte. Aber eines zu retten, zu wählen, hieß ja auch, alle anderen zurückzulassen. Also fragte ich, ob wir nicht zwei mitnehmen können? Oder am besten alle? Ben schüttelte grinsend den Kopf, dass die Haarstoppeln wackelten. „Eins oder keins. Jetzt oder nie.“ In derselben Sekunde strampelte sich ein Ferkel frei, plumpste unsanft auf den Boden, rappelte sich hoch, raste blind vor Angst auf mich zu und sprang mir direkt in die Arme. Ich hab dich. Und lass dich nie mehr los. Du hast mich vorhin angeschaut und bist jetzt gesprungen. Du willst das Schiffsleben, das wir dir anbieten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rega Kerner
SCHIFFSCHWEIN Spekje
Das Minischwein auf dem Binnenschiff
Autobiografischer Roman
2. Auflage © 2019
E-Book: medienschiff.de, Bremen
Gedruckte Erstausgabe 2016:Isensee Verlag, Oldenburg
Illustrationen: Nicole Fabert
Lektorat: Jan Bakker
Titelbild: "Cover dein Buch", filmschiff.de
Alle Rechte vorbehalten
--> Webseite zum Buch: www.schiffschwein.de
--> Inhaltsverzeichnis des E-Books
Was soll das arme Schwein auf einem Schiff?
Fern von Wiese, Erde, Artgenossen, verdammt zu glattem Stahldeck, kreischendem Motorlärm und Dieselgestank. Das ist doch kein Leben für so ein Tier! Aber was, wenn es das einzige Leben wäre, das du ihm anbieten kannst?
Stell dir vor, du könntest das Schwein fragen, was es will.
Erkläre ihm bitte, dass es nur zwei Alternativen gibt: Entweder im Alter von zarten drei Monaten als Spanferkel an einem Spieß zu drehen oder auf einem fiesen Tankschiff, bei ein paar Verrückten, so alt und zäh zu werden, wie es kann …
Was würdest du wählen, wenn du ein Schwein wärst?
Zumal es dir ja jederzeit freistünde, über Bord zu springen.
Falls du doch lieber sterben möchtest.
Ich kroch in einen Stall und stellte diese Frage in den Raum.
Das Klauentier antwortete mit rheinwasserklarem Blick und zerwühlte unser Leben.
Mein Frieden scheiterte einst auf Erden und zog mit mir aufs Wasser. Hier ging es uns gut. Wenn Binnenschiffe, im Sonnenuntergang oder arbeitslos, eng aneinander geschmiegt auf Hafenwellen ruhen und Schlaflieder glucksen, kommt man traditionell ins Gespräch mit den temporären Nachbarn.
Das beginnt meistens mit der Weckerfrage:
»Wann fahrt ihr morgen weg?«, brüllte ich den Standardsatz von unserem langsam beidrehenden Bug aus, das Tau in der Hand, dem bereits liegenden Schiff zu. Dort raffte sich ein Schatten hinter Steuerhausfenstern auf, trat vor die Tür und hielt vier Finger hoch.
»Dacht ichs mir doch«, fluchte mein Kapitän Ben durch die Sprechanlage: »Frag mal, ob fünf oder sechs nicht früh genug ist.« Mit der ganzen Hand und einem Daumen, Bettelgeste und Trauermine versuchte ich, den Frühaufsteher zu erweichen, natürlich schüttelte der seine Haare samt Schiffermütze und bestand auf die vier Finger. Einem sadistischen Naturgesetz folgend wollten die Innenliegenden grundsätzlich viel eher ablegen als mein Mann. Zur Versöhnung oder weil ich nur eine Frau bin, half der Gnadenlose mir, unsere Tampen an seinem Schiff festzumachen: »Soll ich bei euch anklopfen oder stellt ihr selbst den Wecker?«
»Klopfen. Falls du verschläfst, dürfen wir das auch.«
Je nach Sympathie wurden die Themen, nach der Weckerfrage, technischer oder privater Natur, beziehungsweise beendet. Im besten Fall versackte man den Abend miteinander auf einem der anwesenden Schiffe. Gerade weil diese Tradition schwindet, pflegten Ben und ich sie gerne. Selbst wenn die anderen Schiffe nicht neben, sondern hinter unserem anlegten.
Wir kuschelten mit kühlem Feierabendbier achtern auf dem Ruderkasten und bewunderten ein antikes Frachtschiffchen, dessen Lack bereits von weitem glänzte wie bei einer Luxusyacht. »Boooh, noch kleiner ist noch mehr, wollen wir später nicht auch mal auf so eins stolz sein?« Dieser stahlgewordene Lebenstraum zielte direkt auf mich ab, sein selbstbewusster Bug schob sich dicht an unser Heck, der Vergleich mahnte: »Ihr könntet auch mal wieder streichen … «
Ben sprang ans Ufer und sammelte Taue auf, welche die ebenso antike Schifferin ihm gekonnt vor die Sicherheitsschuhe schleuderte. Bis ich meine Arbeitslatschen im Halbdunkel gefunden hatte, um mitzuhelfen, waren alle Tampen auf Poller gelegt. Neben dem Schiffsführer drängte ein gepflegter Pudel heraus, schlitterte über die Ladeluken und verbellte uns Landgänger fröhlich. Mit »Hübscher Kerl, wie alt? Wie brav!«, war der Gesprächseinstieg gleich viel intimer als bei der Weckerfrage: »Ja klar haben wir auch einen Hund. Plus Papagei, zwei Goldfische und noch ein ganz besonderes Tier. Aber das schaust du dir am besten selbst mal an.« Neugierig kletterte der grauhaarige Mann an Land, seine Frau entließ ihn gnädig auf unsere Arche Noah: »Ich mach noch die Maschine klar und komme gleich nach!« Ben und ich freuten uns also traditionsgemäß auf den Austausch von Fachsimpeleien und Tratsch.
Der Besucher stoppte mitten im Wohnzimmer, als rund hundert Tierkilos begeistert um die Ecke galoppiert kamen und ihm, nach knapper Vollbremsung, mit nasser Nase die Füße küssten. Eine Weile schwebten nur Schnüffelklänge um uns. Dann stellte der Beschnupperte tonlos trocken fest: »Das ist ein Schwein.« Wir kicherten und sprudelten abwechselnd heraus, wie es in diese Schiffsräume gelangt war.
Unser Nachbar nahm scheinbar alles aufmerksam auf, aber ohne Regung in Gesicht oder Gliedmaßen. Der draußen noch so Gesprächige war zur Salzsäule erstarrt. Mangels Rückmeldung verstummten wir auch langsam wieder. Es war völlig unklar, ob er nun begeistert oder schockiert sei, wahrscheinlich rätselte er selbst genauso darüber wie ich. Sein zweiter und letzter Satz kam, Wort für Wort betont, tief aus dem Bauch: »Hier muss ich eben drüber nachdenken.« Woraufhin er sich abrupt umdrehte und ging. Am nächsten Morgen war das schöne Schiffchen hinter uns verschwunden.
Ich habe das Ergebnis des Nachdenkens niemals erfahren, die zwei Sätze blieben jedoch vielzitiert hängen. Gehen und Nachdenken wäre eine Alternative gewesen. Vorher. Vor dem Schwein …
Schweineloser Schiffsfriede
»Schon wieder Suppe?« Karel blieb schmollend im Eingang unseres achtern gelegenen Kapitänsdomizils stehen. Mein Mann räumte einen der drei tiefen Teller zurück in den Schrank und drückte dem erwachsenen Sprössling seiner Jugendehe eine ganze Packung Weißbrot auf den Arm: »Wer die Suppe nicht ehrt, ist die Suppe nicht wert. Und Tschüss.« Gehorsam verzog sich Karel, von Berufung mehr Kapitänssohn als zweiter Kapitän, eine Schiffslänge weit in die Bugwohnung; um seinen Papagei, sowie sich selbst, mit holländischweicher Backware zu füttern.
Suppenfreitags durften Ben und ich ohne unseren dritten Mann speisen. Akribisch angelte meine Gabel feinste Fleischfasern aus der reichhaltigen Flüssigkeit und klopfte sie in einen Becher, der Hund hypnotisierte mich durch die Tischplatte, um schneller an diese Sammlung zu gelangen. Der Kapitänskoch schlürfte vom unsortierten Löffel: »Auch was zu meckern?« Mein vegetarischer Idealismus hatte lange gelernt, sich zu arrangieren und über die vollmundigen Kommentare der übrigen Besatzung zu lächeln. Beruhigend streichelte ich seinen Oberschenkel, was die Hundezunge ermutigte, meine Hand zu lecken.
Den Rest der Woche extrahierte ich mir Gemüse und Kartoffeln mit einem Griff, die beiden Männer verzehrten allabendlich ein dickes Stück Fleisch, am liebsten Schweinekoteletts. Ansonsten hatten wir mit den molligen Klauentieren nichts zu tun. Solange man nicht weiter bedenkt, dass sie in zersägten Teilen die Hälfte unseres Tiefkühlers füllten.
Und wer tut das schon?
Obwohl es, neben Hauptmahlzeit und Schichtwechsel, kaum Berührungspunkte mit dem Einsiedlersohn im Vorschiff gab und ich meinen Mann nie geheiratet hatte, gehörten wir zu der aussterbenden Gattung des hierarchischen Familienbetriebs.
Ich stieg in dieser Rangordnung von der Geliebten über Matrosin zur Steuerfrau auf, blieb jedoch mehr Frau als Steuer.
Schiffe sind weiblich, wie ich. Weil die Besatzung männlich ist und unterwegs sonst nichts zum Liebhaben hat. Keiner anderen Frau verzeihen Kapitäne so viele Macken: Bei welcher könnte man ebenso jeden Fehler reparieren oder überstreichen? Auf unserem Bug prangte das Wort Hunter. Hat das Fahrzeug einen maskulinen Namen, wird es im Sprachgebrauch zweigeschlechtlich. Stimmungsabhängig. Funktionierte alles nach Wunsch, hatte »der Hunter« es gut gemacht. Lief etwas weniger glatt, maulte Ben: »Sie zickt wieder.« Ging viel kaputt, war es »das Schrottding«. Nur am emotionalen Tiefpunkt ist das Schiff genauso sächlich wie das Schwein.
Zu gern hätte ich herausgefunden, wo die Persönlichkeit meines Partners aufhörte und die seiner Hunter anfing. Sie bildeten eine sich gegenseitig beeinflussende Einheit. Ein mächtiges Schiff mit einem mächtigen Mann. Da ist absolut nichts Weibliches dran. Ich werde seine große, eiserne Dame nie »die Hunter« nennen. Oder hab ich das gerade getan?
Der Hunter ruhte, das Funkgerät platzte fast vor Neid: »So kommst du nie zu einem Neubau!« Ben kehrte, für den Landgang bereits in Jeans statt Jogginghose, zurück ins Steuerhaus: »Hab ich das vergessen auszumachen?« Ich schob ihn zur Seite, um meine Schwimmweste aufzuhängen, der Lautsprecher regte sich weiter auf: »Die Sonne steht hoch am Himmel und du liegst schon wieder.« Wir suchten den Urheber auf dem stillen Neckar, die Restaurantterrasse winkte uns zu, dahinter näherte sich ein Bug mit eiliger Welle: »Ich kenn dich. Du bringst es nie zu was.« Mein Kapitän machte es sich in seinem Chefsessel bequem: »Kennst du den?« Als ob ich mir so viele Schiffe merken könnte wie er. Ich erklomm den Barhocker am Kartentisch: »Das ist besser als Radio.« »Pass auf, bald bist du pleite«, fauchte das Hörspiel. Da man beim Funken nicht antworten kann, solange der andere sendet, kommentierte Ben den wütenden Monolog ungehört: »Der sollte selbst aufpassen, dass er keinen Herzkasper kriegt.«
»Wenn ich morgen früh zurückkomme, sehe ich dich garantiert immer noch hier faulenzen.«
»Das hoffe ich auch. Dann war der Abend gut.«
Der alte, aber schuldenfreie Hunter zerrte im Sog des hastig Vorbeifahrenden an den Tampen, sein Eigner riss nun doch den Hörer an den Mund, ich wusste, was er gern gesagt hätte: »Arschloch. Von Abstoppen an Liegestellen auch noch nix gehört.«
Sachlich mischte sich das zweite Funkgerät ein: »Fahrzeug mit Überlänge zu Tal oberhalb der Engstelle.« Aus guter Seemannschaft wurde mein Mann fast nervös: »Der hört den vor lauter Aufregung nicht, der donnert einfach weiter. Da wird's gleich eng.« Er wies auf die idyllische Landschaft hinter der Flussbiegung und hielt den Knopf gedrückt, um eine Warnung auf dem blockierten Funkkanal zu senden, doch es gab keine Lücke: »Wenn ich mein Schiff schon ein Vierteljahrhundert hätte wie du, hätte ich schon lange genug für ein Neues verdient!« Der Schornstein des Entgegenkommenden blitzte zwischen zwei Bergen auf: »Fahrzeug mit Überlänge fährt in die Engstelle ein.« Ben hängte den Hörer auf den Haken: »Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat, aber gleich hat er echt eins.« Ahnungslos schimpfend, entschwand das Schiff hinter demselben Berg: »Du bist total versaut. Das weiß doch jeder auf dem Revier. Wenn alle so faul wären, hätten, … Oh Gott!«
Tiefschwarze Rauchpilze wuchsen über die Baumkronen hinaus, schwere Motoren jaulten gequält. »Vollhand zurück, sonst schaffst du kein Vierteljahrhundert!«, lachte Ben und schaltete beide Funkgeräte aus.
Händchenhaltend bummelten wir über die Uferpromenade, das überlange Fahrzeug kam unbeschädigt vorbei. »Schwein gehabt!«, atmete ich auf, Ben korrigierte: »Nee, gute Reaktion und zwei fette, nagelneue MWM Maschinen.« Die letzten Schritte zur Bierquelle langweilte er mich mit einem seiner Lieblingsthemen: »Dafür muss der auch mit doppelter Besatzung Tag und Nacht durchkacheln, ohne Wahl, was wohin wie viel. Er gehört der Bank und die will sehen, dass das Geld sich bewegt. Egal, ob rot oder schwarz.« Strahlend umarmte uns die Restaurantchefin: »Gebackene Auberginen und Salamipizza oder mal was anderes?«. Das moderne Schiff, welches nicht wusste was es lädt, wie viel dafür bezahlt wird und wohin die Reise geht, entzog sich unseren Blicken und Gedanken. Es gab Wichtigeres zu entscheiden: »Gib doch noch mal die Karte.«
Über dem letzten Pizzaviertel zitierte Ben einen weisen Freund: »Auf der Mosel fährt man nicht nach Fahrplan, sondern nach Speiseplan.«
»Wir sind auf dem Neckar.«
»Na und?« Ich zog einen Flusslauf durch die Auberginensoße und nickte. Die Mosel wird überbewertet. Auch an den Ufern von Rhein, Main und Neckar wimmeln Touristen, nur ein Tauwurf trennt das Binnenschiff vom Urlaubsland. An den Anfang des Soßenflusses malte ich ein Meer. Die Tanklager im Seehafen, wie Rotterdam, Amsterdam oder Antwerpen, sind ätzend. Da galt Augen wie Nase zu, Diesel oder Heizöl laden und durch. Anschließend, mit der Fracht rheinaufwärts, zückte Ben sein überquellendes Visitenkartenbuch, um die Reiseplanung anzupassen: An die beste Gastronomie nahe möglicher Anlegestellen. Eine aufgespießte Aubergine zerstörte Fluss und Meer, um selbst zwischen meinen Zähnen zu enden.
Den Reiz des Neuen kapierten wir nicht. Es war doch viel schöner, von einer sonnigen Terrasse den vorbeihetzenden Geldbewegern zuzuprosten.
Passagiere auf einem Fahrgastschiff erwiderten meinen Gruß mit dem Glas. »Habt ihr noch Montag Ruhetag?«, überprüfte Ben seine Visitenkartendaten. Die Restaurantchefin lächelte, räumte die Teller ab, wies im Vorbeigehen auf ein Schild direkt neben ihm, stellte eine volle Flasche Grappa auf den Tisch und setzte sich zu uns. »Brauch ich nicht so viel laufen. Alles gut bei euch?« Aus dem angewiesenen Schild mit den Öffnungszeiten folgerte ich, dass sie erst gegen Mitternacht wieder aufstehen, den Besen holen und uns rausfegen würde.
Auf der Schiffsautobahn Niederrhein schliefen wir gern mit Abstand zum Ufer. Rasselnde Ankerketten spielten die Melodie von Zweisamkeit, in der kein Nachbar uns stören konnte.
Nur das Handy. »Du vereinsamst doch auf dem Schiff!«, klagte es regelmäßig. Ich hangelte mich mit einer Hand aus der Jacke: »Quatsch, Ma. Deine Freunde im Haus nebenan kannst du auch morgen besuchen. Aber morgen denkst du, übermorgen passt besser und übermorgen verschiebst du es wieder auf morgen. Auf einmal hast du sie, vor lauter morgen, ein Jahr nicht gesehen.« Ben streckte die langen Beine auf den Couchtisch und lockte mit hochgezogenem Shirt. Muttersorgen sind hartnäckig: »Das ist bei euch doch noch viel schlimmer.« Der nackte Bauch sog mich schrittweise näher: »Nee. Wenn wir anlegen, wird sich sofort getroffen. Nix morgen. Weil wir morgen weg sind und keiner weiß, wann wir wiederkommen. Nächste Woche oder nächstes Jahr?« Ein Bein hob sich vom Tisch und umschlang mich. »Jetzt!«, befahl mein Oberbefehlshaber, ich stürzte auf ihn in den Feierabend: »Ma, hab zu tun. Tschüüüüß!« Vereinsamen. Bla Bla. Sie redete doch nur von sich selbst, weil sie nicht in unserem Fahrgebiet wohnte.
»Ihr schafft das doch vorm Wochenende?«, bettelte das Telefon. Nicht nur meine Mutter brachte das Gerät zum Jammern. Auch das Befrachtungsbüro hatte sich seufzend damit abgefunden, dass der Hunter etwas länger für jeden Transport brauchte als andere Tanker.
»Mal sehen. Verirre ich, wartest du«, feixte Ben. Trotzdem wurde unser Schiff von manchen Kunden bevorzugt: »Tu meine Ladung bitte in den Hunter, wenn er frei ist. Da weiß ich zwar nie, wann es ankommt, aber ich weiß, dass alles gut ankommt.« Bei Kollegen stimmte die Menge der flüssigen Fracht am Zielort wohl nicht immer. Apfelbauern essen Äpfel und Schiffsmotoren drehen bekanntlich auf Diesel und Heizöl.
Natürlich wurde bei uns auch gearbeitet. Manchmal ein bisschen. Die zwei Männer steuerten abwechselnd. Zusätzlich engagierte der erste Kapitän sich selbst als Koch, der zweite Kapitän war für das Laden und Löschen zuständig und die Steuerfrau versorgte die Maschinenräume. Der Hund bewachte das Deck, die Goldfische die Wohnung. Beides mit mäßigem Erfolg. Während der Fahrt betätigten Karel und ich uns je nach Wetter, Zeit, unserer Lust oder Bens Laune mit allgemeinem Schiffsunterhalt, wie Abseifen, Rostkratzen und Streichen.
Wir lebten friedlich vor uns hin, es fehlte uns an nichts.
Vor allem ganz bestimmt nicht an einem Schwein!
Schafschleuse wird Schweineschleuse
über Schweine kann man streiten. Bevor ich damit anfange, möchte ich wenigstens eine Feststellung treffen, der jeder zustimmt:
Wasser fließt von oben nach unten.
Unser Motor stampfte gegen die Strömung den Main hinauf, da kam wieder so ein ständiges Ärgernis. Die Schleuse mit zugehörigem Wehr bremste den Hunter samt seinem Element. Stoppen ist prima, aber bitte freiwillig. Doch das Bauwerk schluckte unseren freien Willen. Stundenlang dümpelten wir neben Kollegen und hohen Anlegestellen im Unterwasser, starrten auf die rote Ampel sowie einen Spalt zwischen den schweren Stahltoren: »Da, er ist ein wenig größer.« Ben prüfte meinen Wunschblick: »Nee, ist noch zu. Aber wir sind die nächsten.« Meine Unterschenkel falteten sich auf dem Barhocker in den Schneidersitz, bereit aufzuspringen, wenn es losging. Die Strudel vor der Einfahrt rauschten mir zu: »Gleich öffne ich mein Maul und fresse dich, dann bist du noch lange nicht oben.« Im Wartezimmer für Schiffe hilft nur Schleusenmeditation: Wann hast du Oberwasser?
Tief unten in der Schleusenkammer ist man klein und wertlos, umzingelt von feuchten, hohen Mauern, nur ein Lichtviereck über sich. Ein Hoffnungsschimmer, bald geht es aufwärts. Das Wasser steigt, das Schiff erhebt sich, es wird heller, die Mauern schrumpfen. Plötzlich erlaubt die Spundwand den ungebremsten Blick auf eine weite, leuchtende Landschaft. Am Gipfel der Emotionen öffnen sich die Tore, das Gefängnis entlässt dein Schiff in die Freiheit. Du fährst ins Oberwasser.
Vergiss bei aller neuen Selbstsicherheit nur nie, dass du auch wieder runterkommen musst. Tanker laden nun mal meist im Seehafen. Landkartengetäuschte Menschen behaupten zwar, das Meer läge hoch im Norden. Das ist Unsinn. Es liegt am Tiefpunkt der Reise.
Wir waren uns doch einig:
Wasser fließt von oben nach unten.
Die Schleuse spuckte uns und unseren freien Willen ins Oberwasser aus. Dort entschloss Ben sich sofort für Feierabend, wir legten den Hunter an seine Leinen und wandelten zurück über die Wiese, die eben noch unsere Aussicht über die Mauern erhellt hatte. Zwei Schafe musterten uns kritisch durch die Büsche, ein Hahn schrie Alarm, seine Uhr war sicher kaputt, Herbie baute den Grill auf.
Dieser kleine, quirlige Schleusenmeister liebte Tiere in jeder Form: Er liebte es, sie fürsorglich aufzuziehen. Ebenso liebte er es, sie hinterher aufzuessen.
Sein kleines Paradies auf dem Schleusengelände erwuchs aus einer Handvoll Schafen, ursprünglich angeschafft, um dem Wasserschifffahrtsamt die Sorge und Kosten für ständiges Rasenmähen zu ersparen. Die Herde vermehrte sich, steigende Ausgaben für das Winterfutter waren nicht zu unterschätzen, darum kamen mit der Zeit Hühner und Kaninchen hinzu, deren Endprodukte wieder halfen, das Schaffutter zu finanzieren. Wildlebende Wasservögel, welche vom überreichen Futterangebot auf der Schleuse angelockt wurden und gerne für immer blieben, ergänzten das bunte Treiben.
Für diese Abendgestaltung brauchten wir keine Visitenkarte mit Öffnungszeiten. Wenn wir Herbies Stimme nicht im Schleusenfunk erkannten, verbrachte er gerade seine Freizeit auf der anderen Seite, rund um die chaotisch zusammengezimmerten Ställe.
Bei einem Kaltgetränk bewunderten wir Herbies neueste Tierbabys, der Hahn suchte immer noch lauthals seine Uhr. Gemeinsam fachten die Männer den Grill an, meine Stimmung sank der Sonne hinterher. Die Kinder und Geschwister von den um uns herumlaufenden Tieren brutzelten auf dem Rost. Ben streichelte mit einer Hand ein Schaf, während er in der anderen eine Wurst hielt, die aus Schleusenlämmchen gemacht war. Vielleicht von dieser Mutter. Ich kämpfte um emotionales Oberwasser: »Das ist wenigstens nicht so scheinheilig, wie Fleisch nur abgepackt zu kaufen, um nicht an das Tier erinnert zu werden, das es mal war.« Mein liebender Mann pflückte ein Blatt vom Baum, wickelte es um die Wurst und hielt sie mir vor die Nase. Weil ich lieber eine Folienkartoffel aus der Glut angelte, bekam das Schaf sein Päckchen. Es stülpte die Lippen, zog das Blatt ab und schluckte es. »Recycling pur, es frisst nur die Verpackung. Das kannst du von deiner Alufolie nicht behaupten«, trumpfte Ben und stopfte sich das Wurstende in den Mund. »Ach komm, immerhin haben sie es vorher gutgehabt.«
Mit fleischvollem Mund klang es nicht so versöhnlich, wie es gemeint war. Ich packte meinen Erdapfel aus: »Klar. Kein Paradies ohne Fehler.«
Herbi entwickelte zum Verschlingen der Tiere, die er geliebt hatte, seine ganz eigene Philosophie: Er schlachtete keines, dem er einmal einen Namen gegeben hatte. So hoppelten doch ein paar betagtere Wesen zwischen den jungen Nutztieren herum, geschützt durch den eigenen Namen. Dazu gehörte so manches Mutterschaf, sowie Herbis erstgeborener Bock. Dieser besonders freche Kerl setzte seine Hörner gerne gegen ungebetene Gäste ein. Ein dickes Kaninchen, das zu faul war, noch irgendetwas einzusetzen, fragte sich wahrscheinlich jeden Morgen, wann Herbi bemerken würde, dass es in seiner Dauerschläfrigkeit eigentlich nur noch als Braten taugt. Was wissen Langohren schon von Namensschutz? Die Heldin unter den Tieren mit lebenslangem Lebensrecht war allerdings Berta. Dieses magere, total zerrupfte, wohl ehemals weiße Huhn, überlebte auf unerklärliche Weise stattliche zwei Fuchsanfälle.
Der Grill glühte aus, Berta erbettelte ein letztes Brotstück, wackelte in den Stall und steckte den Kopf unter die verbliebenen Federn. Herbi lächelte ihr nach, nun mussten wir ihre Geschichte hören. Ob wir wollten oder nicht.
Stall und Wiese hätten nach aller Logik ein fuchssicheres Gelände sein sollen. Zwei Schleusenkammern liegen zwischen Festland und Domizil der Tiere. Sie leben auf einer Art Insel, auf einer Seite rauscht der Fluss zum Wehr, auf der anderen Seite kommen nur Schiffe in die Schleuse. Über der gesamten Anlage liegt eine Fußgängerbrücke, von welcher sehr hohe Treppen zu jedem Schleusenabschnitt führen. Alternativ kann man bloß abpassen, welche Schleusentore gerade geschlossen sind, um darüber zu laufen. Beide Zugänge, also Tore sowie Brückentreppe, haben einen grobmaschigen Gitterboden, den kein Tier ohne Training freiwillig überschreitet. Vergleichbare Roste werden im Wald auch als Wildsperre auf den Boden gelegt, z.B. um gefährliche Straßenüberquerungen zu verhindern.
Dennoch waren eines Morgens alle Hühner tot. Nur Berta lief, wild gackernd, zwischen den Leichen herum. Dies ist das fürchterliche Erkennungszeichen des Fuchses, er reißt nicht nur ein Opfer, um es zu verzehren, sondern ermordet alles, was ihm in die Fänge kommt. Vielleicht, um es später abzuholen, ohne zu begreifen, dass die Wiese kein Kühlschrank ist. Oder einfach als Übung. Der schlaue Fuchs kann nicht so dumm sein, dass seine Augen dreißigmal größer sind als sein Magen. Blutrausch ist die treffendste Erklärung. Selbst die Schafe wirkten verstört.
Herbi räumte das Massaker unter Tränen auf, fütterte sein letztes Huhn und besorgte sich am nächsten Tag neue Hennen. Diese waren noch ganz jung, legten also winzig kleine Eier. Worüber wir uns prompt beschwerten, als wir auf der Durchfahrt unsere Eierdosen abholten. Da erzählte Herbi das grausame Geschehen, noch immer fassungslos. Keiner konnte sich erklären, wie der Fuchs auf das Gelände und wieder weggekommen war. Wir vermuteten, dass es sich um ein besonders schwimmfreudiges Exemplar handelte. War er ins Wasser gefallen und hatte sich nur durch Zufall auf die Schleuse gerettet? Unsere Vorstellungskraft kenterte rettungslos bei der Visualisierung vom Rückweg über den Main: Ein zierlicher, wildpaddelnder Fuchs mit einem dicken, klatschnassen Federtier im Fang …
Eine Weile geschah weiter nichts, alle glaubten an einen Einzelfall, aber in Wahrheit fand der Fuchs die jungen Hühner einfach noch zu mickrig. Das lohnte den so-oder-so mühsamen Weg nicht. Erst als sie ausgewachsen und lecker fett waren, kehrte der Killer zurück. Wieder war es Berta, die ihren Herrn morgens als einzige begrüßte.
Nachdem die zweite Ladung Junghennen eingetroffen war, legte Herbi sich nächtelang mit einem Gewehr auf die Lauer. Er schloss das Federvieh abends ein, verstopfte alle möglichen Schlupflöcher, schlief fast nur noch im Stall. Vergebens. Nur einmal konnte er einen schattenhaften Blick auf den Räuber erhaschen. Der erschien tatsächlich auf dem schwierigsten Weg — den untersten Stufen der Gittertreppe. Dort nahm Meister Reineke Witterung auf, erkannte die Menschennähe und entschwand sogleich wieder, die Stufen hinauf, in die Dunkelheit. So schnell, als wären die Gitter glatte Planken. Herbi traute seinen nachtblinden Augen kaum.
Erwischt hat er ihn dann doch. Nach dem Hinweis eines Bekannten, der einen Fuchsbau beim benachbarten Hafenbecken entdeckt hatte, ging Herbi dort auf Jagd. Von seinem Erfolg berichtete er mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn als er den erschossenen Fuchs in Händen hielt, imponierte ihm das prächtige Tier. Wäre es nur ab und an um ein einzelnes Huhn gegangen, hätte der besondere Schleusenmeister den Verlust gerne als natürliches Zusammenleben akzeptiert.
Schwund ist immer. Zumal bei den Hühnern, die ein bisschen dümmer waren als die anderen Inselbewohner. Es fiel schon mal das eine oder andere in die Schleusenkammer. Aus der es für niemanden ein Entkommen gibt, der keine Leitern klettern kann. Wir Schiffer hatten die Anweisung, eventuelle Brotreste möglichst weit weg aufs Gelände zu werfen, damit das Vogelvieh nicht wie verrückt zum Schiff rannte und dabei vergaß, vor dem Wasser zu bremsen.
Herausgefischte Hühner starben grundsätzlich trotz Rettung am Schock. Dies geschah zwar selten, erklärt aber Herbis theoretische Toleranz bezüglich gelegentlicher Besuche von Raubtieren. Nur Massenmord war ihm zuwider und musste gestoppt werden.
Wären die Eiervögel hinsichtlich Wasser etwas schlauer, würden garantiert mehr von ihnen auf Binnenschiffen herumstolzieren. Ich kenne einige Schiffer, die von der Idee, sich morgens ein Frühstücksei an Deck einzusammeln, begeistert wären, könnte man die Tiere nur frei herumlaufen lassen. Wie den Bordhund. Ohne den Schifffahrtsbetrieb störende Zaunkonstruktionen. Nur von einem habe ich gehört, der tatsächlich Hühner und Brieftauben an Bord hielt. Sicher eingezäunt. Spannender als Hennen im Käfig ist hier die Frage, ob und wenn wie, die fliegenden Postboten ihr Zuhause auf einem fahrenden Schiff finden. Bezüglich Zustellungsalternative zum Postfach. Tauben bei Herbi hatten es da einfacher. Die durften sich, wie alle anderen Besucher auf seiner Insel, tüchtig durchfuttern.
Zu all diesen Tieren kamen eines Tages die Sau Rosa und ihr Eber auf die Schleuse.
Rosa war ein Bilderbuchminischwein, wie der Laie es sich vorstellt: Ein zu heiß gewaschenes Großschwein, dick, langgedrungen und wie der Name schon sagte, natürlich rosa. Ihr tiefschwarzer Mann lief auf deutlich höheren Beinen, für ein Minischwein erstaunlich schlank und drahtig. Er schien eine Mischung aus Hängebauch- und Wildschwein, mit feurigen Augen und langen, weißen Hauern eine respekteinflößende Erscheinung. Ich habe den Eber nur aus sicherem Abstand schemenhaft hinter Gittern gesehen. Er war zu wild, um Fremde in seiner oder Rosas Nähe zu dulden.
Beide hatten bisher in einem privaten Vorgarten gelebt, was zu Problemen mit Nachbarn und Behörden führte. Sie sollten darum geschlachtet werden. Eine typische Minischweinbiographie. Herbi hörte davon und empörte sich. Natürlich nicht gegen Schlachtung im Allgemeinen, aber Rosa war schwanger. Und das ging in seiner Denkwelt gar nicht. Man schlachtet keine schwangere Sau! Kurzerhand erweiterte er seine Stallanlage um die nötigen Anbauten und holte die zwei zu sich. Na ja, so kurzerhand wird es kaum gewesen sein, denn beide Schweine wurden irgendwie über die Schleusenbrücke und lange Treppe auf das Gelände getragen. Oder über die schmalen Schleusentüren. Eins von beidem. Wie er das, überhaupt und im Detail, hinbekommen hatte, gehörte wohl zu den Kapiteln, über die er lieber schwieg. Eindeutig war aber seine Aussage über die Zukunft der Schweine: »Die beiden großen dürfen bleiben, aber die vielen Ferkel, wenn sie denn da sind, das geht nicht. Dafür ist das Gelände zu begrenzt. Die werden Mini-Spanferkel.« Herbis Argumentation schien mir durchaus einleuchtend, auch wenn die Vorstellung von Ferkeln am Spieß lang verschüttete, unangenehme Kindheitserinnerungen wachrief.
Frühe Prägung »pro Schwein«
Meine optimistischen Eltern hatten einst ein Haus auf dem Land gebaut. Zum Einstand und besseren Kennenlernen der Dorfgemeinschaft veranstalteten sie ein Fest, zu dem alle Nachbarn geladen waren. Im großen Garten wimmelte es von Menschen, das Büfett mit allem Drum und Dran war in der Doppelgarage aufgebaut. Aber meine Mutter hatte mir streng verboten, diese zu betreten. Eine Weile hielt ich mich daran, meistens war ich ja ein braves Kind. Sogar in jenem Trotzalter, zwischen zwei und drei Jahren. Wahrscheinlich habe ich die Anordnung auch nicht bewusst überschritten, obwohl die brennende Neugier auf diesen Raum, in den alle hineingingen, um dann mit tollen Sachen wieder rauszukommen, nahezu übermächtig war. Später im Getümmel und Gelaufe, ich hatte genug gegessen, keine Spielidee mehr und Mami war unauffindbar, bin ich doch mit irgendjemandem unbemerkt mitgegangen. Vielleicht aus Versehen. Ein Mischgestank von Fett, Alkohol, Schweiß und frischer Wandfarbe waberte im halbdunklen Raum. Da stand ich plötzlich, mutterseelenallein zwischen drängelnden Fremden, in der neuen Umgebung. Auge in Auge mit einem Spanferkel am Spieß. Es war riesig, bestimmt größer als ich selbst und sehr, sehr tot. Man hatte ihm eine Metallstange in den weit geöffneten Mund gesteckt, die am Popo wieder rauskam. Ein ganzes Tier, wie ich es aus der schönen Kinderliteratur kannte, aber gar nicht so glücklich auf der Wiese, wie es sich doch gehört. Ich fing an zu weinen, was ich da sah, konnte ich nicht begreifen. Nur, dass es eindeutig ganz, ganz böse war. Aber warum? Und was hatte Papa damit zu tun? Der erschien plötzlich hinter dem Schwein, rührte da in einer überdimensionalen, magischen Glaskugel, mit roter Flüssigkeit und vielen Obststücken. Er versuchte, mich abzulenken, indem er mir erklärte, wie man Bowle macht. Die sah toll aus, aber ich durfte sie doch nicht probieren. Das Schwein spiegelte sich in dem Glas. Ich blieb untröstlich. Papa brachte mich wieder in den Garten. Er versprach, Mama nicht zu erzählen, dass ich trotz Verbot in die Garage gelaufen war. Damit blieb auch das aufgespießte, geröstete Tier unser grauenvolles Geheimnis, über das ich nie sprechen durfte, um mich nicht selbst zu verraten. Er hatte wohl ein schlechtes Gewissen, weil meine Mutter von Anfang an gegen das Spanferkel war. Es hätte das Kind schockieren können. Was in seinen sachlichen Augen natürlich Unsinn war. Tiere töten und verspeisen gehört zum Leben, das muss man lernen. Als ich aufhörte zu weinen, war das Thema für ihn erledigt.
Das Bild brannte sich unauslöschlich in mein Gehirn. Wenn der richtige Auslöser kommt, schauen mich die toten Augen heute noch direkt wieder an. Auch in ganz absurden Zusammenhängen: Als Kind hatte ich panische Angst vor Spritzen, ich fürchtete immer, sie kämen auf der anderen Seite wieder heraus. Ich glaubte jedes Mal sogar, mit realen Schmerzen zu fühlen, wie sie, immer länger werdend, meinen Körper ganz durchdringen und schielte dabei auf die gegenüberliegende Seite, ob man sie da schon rauskommen sieht. Wie die Stange bei dem Schwein.
Die Ferkel auf der Schleuse waren auch so ein Auslöser, wenn auch nicht mehr so angstbesetzt. Ihr Anblick aktivierte stattdessen alle Schutzinstinkte. Vielleicht konnte ich hier wiedergutmachen, was Papa damals versäumte. Er hatte das Schwein nicht gerettet, obwohl ich es von ihm erwartete.
Nicht, dass ich ihm die Schuld an meinen Schweinegeschichten geben will. Auch wenn Eltern natürlich für ewig und immer schuld sind. Außer man gehört zu den seltenen, humorvollen Unikaten, die trotzdem irgendwann Selbstverantwortung übernehmen.
Ein belesener Freund zitierte vermutlich, als er vorschlug: »Vielleicht sollten wir bei unseren Essgewohnheiten mehr auf die Instinkte der Kinder hören. Biete einem Kleinkind einen frischen Apfel vom Baum und ein lebendes Kaninchen an. Welches davon wird es streicheln und von welchem wird es abbeißen?«
Schweineentscheidungsfindung
Mein Mann hatte schon lange keine Kleinkindinstinkte mehr. Er bestellte auf der Schleuse solch ein Mini-Spanferkel: »Bitte in zwei-Mann-Portionen zerlegt und eingefroren.« Der Schlachter brachte es jedoch nicht übers Herz, sein Opfer in Stückchen zu hacken, dann sei es doch kein Spanferkel mehr! Nun war es also geschlachtet und als komplettes, totes Schweinchen tiefgekühlt. Vom Rüssel bis zur Schwanzspitze. Zu groß für unsere Schubladen im Gefrierschrank. So Mini sind Mini-Spanferkel dann doch nicht. Stundenlang wurde herumtelefoniert, wo es, bis zur Grillsaison im Frühling, einen eisigen Platz bekommen könnte. In Folge dessen transportierten Bekannte es mit dem Auto von Frankfurt nach St. Goar, wo es vorübergehend bleiben durfte. Später wurde dort der Kühlplatz anderweitig benötigt und das Eisfleisch zog mit Kopf und Beinen in eine Truhe nach Mainz um. Wieder per Auto und auch noch ein Stück auf unserem Schiff. Auf Tankern gibt es draußen, neben vielen Leitungsrohren, auch sogenannte Deckskisten. Das sind feuerfeste Stahlkästen auf Füßen, mit schrägen, schweren Deckeln, bestimmt für allerlei Schiffszubehör. Nie vergesse ich diese steife Form, gestaut in so eine Kiste an Deck. Vom Steuerhaus glotzte ich die ganze Fahrt auf die Hinterbeine, die unter der Klappe hervorragten. Der umgebende Schnee sah gar nicht mehr romantisch aus. Durch die Sprechanlage krächzte Karels Papagei: »Aufstehen! Aufstehen!« Das Gefrierfleisch hörte nicht auf den Vogel.
Als einzige Vegetarierin an Bord, machte mir das Dauerthema vom toten Schwein immer mehr zu schaffen. Irgendeines der vielen Tiefkühltruhen-Organisations-Telefonate begann mein Mann mit der Frage: «Wie geht's meinem Schweinchen?«, worauf ich mir nicht verkneifen konnte, aus dem Hintergrund zu kommentieren: »Wenn es gut ist, geht's ihm schlecht.« Und laut herauszuposaunen, ich würde das nächste Mal eines retten. Das Ende von diesem war, dass auch die Mainzer Kühltruhe keine Bleibe bis zur warmen Jahreszeit bot. Ben verschenkte seinen Braten an die Truheneigner. Somit drehten andere den Spieß mit Ferkel schon zu Silvester über dem Feuer. Es soll nicht einmal gut geschmeckt haben.
Wenn du das arme Schwein wählen lassen könntest, Grill oder Tanker … wir verblieben darüber diskutierend. Nächte lang, mit und ohne Alkohol. Voller Erleichterung hörten wir endlich, dass die Sau auf der Schleuse keine Ferkel mehr bekommen sollte.
Eine Weile war unser Leben wieder schweinelos. Aber wenn das Schicksal etwas von dir will, drängelt es geduldig weiter. Nach ein paar Monaten rief uns jener Freund an, dem man einen Streich gespielt hatte. Aus Rache, weil er die Kinder im Bekanntenkreis zum Leidwesen der Eltern öfter mit Kleintieren beschenkte, hatte man ihm zum Geburtstag ein Hängebauchschwein geschenkt. Er hauste auf einer Dauerbaustelle, die mal ein Wohnboot werden wollte. Selbst wenn das je gelänge, wäre dort kein Platz. Das Schiffsgrößenverhältnis ließ ihn an uns denken: »Auf euren 82 Metern Stahl ist doch genug Raum für so ein kleines Schweinchen?« Da hatte die Falle wieder zugeschnappt, unsere Diskussion entflammte erneut. Dieses Tier war zwar vorübergehend auf einem Bauernhof untergebracht, aber wenn sich kein anderes Heim fände, sollte es nach ein paar Wochen geschlachtet werden. Einige Nächte, Bierkisten und Weinflaschen später, kamen mein Mann und ich zu dem Entschluss, wenn es denn nun unbedingt sein soll, würden wir es trotz aller Bedenken probieren — aber wir baten unseren Freund doch nachdrücklich, sich erst nach einer schweinegerechteren Bleibe umzusehen. Einem Ort, wo das Tier Wiesen, Bäume, Stall, Schweinegesellschaft und Modderwühlen genießen kann. Als die Nachricht kam, man habe den frechen Kerl auf dem Bauernhof so liebgewonnen, dass er dort bis zu einem natürlichen Tod bleiben dürfte, fühlten wir eine Sorge von den Schultern sacken. In einem abschließenden Gespräch klärten mein Mann und ich das Thema für immer:
»Kein heiles Schwein auf unserem Schiff. Und sei es noch so mini. Das wär doch auch kein Leben für ein Hoftier. Außerdem waren wir mit Hund und Goldfischen genug beschäftigt, warum sollten wir uns solch einen Aufwand zumuten?« Zweimal war der Kelch vorbei geschwebt, nun hatten wir entschieden. Dieser Beschluss konnte auch nicht wanken, nachdem wir erfuhren, dass die Sau auf der Schleuse doch wieder schwanger war. Ungewollt, nachdem der Eber sich als Ausbruchskünstler erwiesen hatte.
Wir waren uns also einig. Bis wir, wieder einmal, vom Rhein in den Main einfuhren. Auf dem Main scheint immer die Sonne. Es gibt so Wetterwunder, die das Schiff begleiten. Dies ist eines davon. Egal, über welchen Nebel oder Regen wir zuvor gerade fluchten, wenn die Mainmündung in Sicht kommt, geht die Sonne auf und die Stimmung wird leicht bis mittelschwer euphorisch. Also — herrlicher Spätsommer und ein paar Bier begleiteten uns durch die ersten Mainschleusen, da sagte Ben, buchstäblich aus heiterem Himmel: »In einer Stunde kriegst du dein Schwein«. Ach du Scheiße, ich meine, wir hatten uns doch dagegen entschlossen …?!? Spontan ist er gern, aber nie ohne dabei seine Autorität zu betonen: «Es ist jetzt oder nie, liegt an dir. Aber wie du selbst am Anfang sagtest, wenn das Schwein wählen könnte …« Da sah ich sie wieder vor mir, die winzigen fröhlichen Ferkel, wie sie im vergangenen Jahr über das Schleusengelände flitzten. Ihre stolze Muttersau, die schimpfend, mit wackelndem Bauch und schwenkenden Zitzen hinter den Wildfängen her schnaufte. Wie sie sich vergeblich mühte, die Unerzogenen zu erziehen, die in rosa, gefleckt und gestreift in alle Richtungen ausschwärmten und irgendwann doch von allein wieder bei der Mutter zusammenkamen. Und ich sah sie wieder vor mir, die tiefgekühlten Beine, die aus unserer Deckskiste in den Himmel ragten, wie ein mahnender Finger: »Seht, was aus mir geworden ist, dem fröhlichen Ferkel, das die ganze Welt entdecken wollte! Ihr wisst nicht einmal, ob ich rosa, gefleckt oder gestreift war und fresst mich doch.«
Diese Antwort des gefrorenen Schweins war eindeutig. Meine auch.
Aber eines zu retten, zu wählen, hieß ja auch, alle anderen zurückzulassen. Also fragte ich, ob wir nicht zwei mitnehmen können? Oder am besten alle? Und dann einen schönen Ort suchen, wo sie leben dürfen? Ben schüttelte grinsend den Kopf, dass die Haarstoppeln wackelten. »Nicht gleich übertreiben, sonst überlege ich es mir wieder anders. Eins oder keins. Jetzt oder nie.«
Ferkel in Kisten
Für den Einzug des Schweinchens musste sämtlicher Alkohol umziehen. Unsere Deckskisten waren mit einem Holzlattenrost ausgelegt, der an einen Stallspaltenboden erinnerte. Vielleicht gab es vor fast fünfzig Jahren einen Propheten auf der Bauwerft des Schiffes, der sich dachte, das könnte nicht schaden, falls hier mal ein Ferkel einziehen sollte. In jener Deckskiste, die bisher die Bierkästen für eine ganze Reise aufnahm und kurzzeitig sein gefrorenes Geschwister beherbergte, sollte es wohnen. In einer tragbaren Plastikkiste mit Löchern, welche bisher die Schnapsflaschensammlung zusammengefasst hatte, sollte es an Bord getragen werden. Die letzte Stunde vor der Schleuse verbrachte ich also mit Flaschen- und Bierkistenschlepperei. Außerdem stellte ich alle Schiffsgerümpelbereiche auf den Kopf, vergleichbar mit Kellern oder Dachböden, um eine Abdeckung zu finden, damit das Ferkel beim Tragen nicht aus der deckellosen Schnapskiste springen könnte. Ich entschied mich für ein schweres Metallfußabtretergitter, plus Kabelbinder zum Sichern.
Ein diensthabender, kooperativer Schleusenmeister teilte uns die Kammer neben dem Stall zu. Wir legten an und gingen mit Schnapskiste, Gitter sowie überschüssigem Adrenalin bewaffnet an Land. Von Herbi, der schon auf uns wartete, bekam ich einen Stroh- und einen Heuballen. Davon rupfte ich etwas Material, um Schnaps- sowie Bierkiste wohnlicher einzurichten. Den großen Rest von beidem lagerte ich im Hohlraum unter dem Steuerhaus, als Reserve. Liegend, damit man die Hütte bei Bedarf noch absenken könnte. Ob dieser Ort als Strohlager so geeignet war, ist sicher streitwürdig, da sich hier auch der Notausgang vom Maschinenraum befand. Im Falles eines Motorbrandes sicher nicht optimal. Es war aber das einzige, was uns einfiel, wo genug Platz war, herumfliegende Halme nicht extrem störten und vor allem keiner reinguckte. Brennbare Materialien sind auf Tankern nicht gern gesehen, egal wo. Außerdem war der Notausgang sowieso nur für das Gesetz. Wäre ein Brand so schlimm, dass der Hauptausgang nicht mehr passierbar wäre, käme man da erst recht nicht hin. Von uns wäre sowieso keiner da. Abweichend von all den offiziellen Bestimmungen, was man im Falles eines Feuers im oder rund um den Maschinenraum versuchen soll, gab es eine ganz klare, interne Betriebsanweisung: »Eine Bratpfanne dürft ihr noch eben versuchen zu löschen, aber wenn es im Maschinenraum brennt, keine Heldentaten, sondern sofort abhauen. Falls es keine Landverbindung gibt, ins Wasser springen und wegschwimmen. Natürlich unter Berücksichtigung von Wind und Strömung.« Die getrockneten Halme waren, von geschlossenem Stahl umgeben, realistisch gesehen also keine Gefährdung. Stattdessen hatten wir damit eine spürbare Geräuschisolierung für den Steuerstand.
Nach dem Streu- und Knabbermaterial bekam ich von Herbi eine theoretische Einführung inklusive Kostproben seiner sonstigen Ernährungsvorstellungen. Muttersaumilch konnte er natürlich nicht mitgeben, es blieb nur zu hoffen, dass unser Kleines sich, von einem Tag auf den anderen, an festes Essen gewöhnt. Immerhin hatte er die Ferkel schon mal an Grashalmen knabbern sehen. Seine Vorschläge waren eine Mischung von Hundefutter, Nudeln, Gebäck und Speiseresten. Das erschien mir in dem Moment schon nicht wirklich ausgewogen, aber mangels besserer Informationen nahm ich die angebotenen Hundefutterdosen und ein paar Kekse mit. Als alle Vorgespräche beendet waren, bewachte mein Mann die Schnapskiste mit einer Zigarette, Herbi verschwand im Stall und ich stand etwas planlos auf der Wiese herum. Eine Weile hörte ich nichts außer Ferkelquieken und wartete, dass der Schleusenmeister mit einem Exemplar im Arm wieder herauskäme. Stattdessen ertönte eine irritierende Aufforderung:
»Na, komm mal hier rein und such dir eins aus. Rosa ist ausgesperrt, keine Angst.«
Ich krabbelte durch den langen, engen Schweinetunnel zum Schlafstall. Die Ferkel rasten wild durch- und übereinander, dicht an dem Gitter bleibend, das den zweiten Eingang verschloss. Draußen, auf der anderen Seite der Stäbe, konnte ich die rasende Rosa rennen sehen und schnaufen hören. Ein kleines Stoßgebet, dass Herbi die Absperrung gut gesichert hatte. Meine Augen gewöhnten sich an das Dämmerlicht hier drinnen, im Gewusel versuchte ich Unterschiede zwischen den Ferkeln zu erkennen. Es gab zwei braungestreifte, zwei gefleckte und ein rosafarbenes. Such dir mal eins aus … Die Tragweite der Entscheidung übermannte mich. Auf einmal war ich es, die Tod oder Leben bestimmte. Zu sagen, dieses eine darf leben, hieß gleichzeitig, die anderen vier zum Sterben zu verurteilen. Ich konnte es nicht. Lass den Zufall entscheiden. Plötzlich klebte eins der gefleckten Ferkel nicht mehr wie die anderen sklavisch am Gitter zur Mama. Es kam mir auf fast einen Meter nahe, ohne schreien, seine Augen fixierten meine. Es war nur ein kurzer Moment des gegenseitigen Anstarrens. Mir war, als blicke das Tierbaby in meine tiefste Seele. Wissend und zugleich fragend: »Bist du Gott?«
Ich krabbelte den Gang wieder raus und sagte: »Nimm das, welches du zuerst fangen kannst. Ist mir egal. Nur, falls mehrere gleich schnell zu greifen sind, dann ein geflecktes. Und wenn es zwischen beiden gescheckten geht, dann das mit den größeren Flecken.« Diese Halbwahl schien dem Schleusenmeister nicht genug durchdacht: »Willst du nicht lieber ein Mädchen? Die Schecken sind beide Jungs.« Was ahnte ich denn über die Unterschiede von Schweinegeschlechtern: »Egal, egal, egal. Das erste, das du erwischst.« Herbi nickte und schlüpfte wieder in den Stall. Ich sollte den Krabbeltunnel sichern. Da hockte ich beengt, lauschte dem panischen Quiekkonzert und sah Herbis Silhouette scherenschnittscharf um sich herumgreifen. Das rosa Ferkel entwischte ihm in den Gang: »Halt es auf!« schrie der Schweinefänger. Nicht einfach, in Hockhaltung so ein glattes Zappelwesen zu greifen. Meine beiden Hände umklammerten die vorbeidrängende Schweinehüfte im letzten Moment. Aus dem Augenwinkel erahnte ich, dass Herbi gleichzeitig ein anderes gefasst hatte. Ein geflecktes? Der nachprüfende Blick zu ihm reichte, mich so abzulenken, dass mein eigener Fang sich loswinden und ins offene Gelände entkommen konnte. In derselben Sekunde strampelte sich auch der Schecke wieder frei aus Schleusenmeisterarmen, plumpste unsanft auf den Boden, rappelte sich hoch, raste blind vor Angst auf mich zu und sprang mir direkt in die Arme. Ich hab dich. Und lass dich nie mehr los. Du hast mich vorhin angeschaut und bist jetzt gesprungen. Du willst das Schiffsleben, das wir dir anbieten.
Ein paar Minuten später war ich mir nicht mehr so sicher. Mit wild strampelndem Ferkel unterm Arm, auf den Knien durch den Gang krabbelnd, den Schweinekopf dicht am Ohr, wusste ich ein für alle Mal, was mit markerschütternden Ferkelschreien gemeint ist. Alle beruhigenden Worte gingen in dem Höllenlärm unter. Es schrie, solang ich es trug. Es schrie, als ich es in die Schnapskiste steckte. Es schrie und raste, weil Ben das Gitter drüberlegte. Das hätten wir lieber weggelassen. Die süße Nase stieß sich blutig daran, wieder und wieder. Es schrie und tobte, während wir sein Gefängnis an Bord trugen. Es schrie und bebte, um nicht aus der kleinen Kiste in die große Kiste gehoben zu werden. Ich tat es trotzdem. Erst als der schwere Stahldeckel der Deckskiste verdunkelnd zu ging, wurde es still. Das Schreien stoppte, aber das Zittern hörte nicht mehr auf. So kam das Schwein in seine erste und zweite Kiste. Die nicht die letzten sein sollten.
Seinen Namen hatte der junge Eber erhalten, bevor er an Bord kam. Egal, ob er Mann oder Frau, bunt oder einfarbig sein würde. In der verbleibenden Viertelstunde Schiffsfahrt, als alle Kisten vorbereitet und die Schleuse schon in Sicht war, diskutierten wir darüber. So hitzig wie der sonnige Main. Es gab keine Widerworte gegen den Kapitän, der darauf bestand, dass es was mit aufessen zu tun haben sollte. Mein Part konnte nur sein, dies so weit wie möglich abzuschwächen. Die Vorschläge von deutschen und holländischen Fleischgerichten purzelten auf mich ein: »Schnitzel«, »Karbonade«, »Speklapjes«, »Gulasch«, »Braten«, »Eisbein«, »Kotelett«, »Varkenshaas«, »Steak«, »Biefstuk« oder »Roulade«? Diese Stichworte drehte und wendete ich in meinem heißen Hirn, auf der Suche nach Verniedlichungen mit dem deutschen » …chen«, oder dem entsprechenden holländischen » …je«, die sich weitmöglichst von der Bedeutung entfernten. Bis meine grauen Zellen medium durchgebraten waren. Ich habe keine Lust, mich an diese größtenteils bekloppten Wortfindungen zu erinnern. Nur bei Kombinationen mit dem Wort Speck, holländisch Spek, bestand neben der Speisebedeutung die Möglichkeit, es als liebevoll neckende Bezeichnung für den menschlichen, nicht ganz schlanken Partner zu gebrauchen. Man denke hierbei an den nicht Barbie-fixierten Mann, der ganz verliebt in die Rettungsringe seiner Partnerin ist. Dabei plant er hoffentlich nicht, sie zu grillen, sondern lobt ihre rundliche Figur. Also schlug ich letztlich, bei Einfahrt ins Unterwasser, »Speckchen« oder »Spekje« vor. Mit der Erklärung, dass dies wenigstens zweideutig interpretiert werden könnte. Die holländische Version stieß auf sofortige Begeisterung, das noch unbekannte Ferkel war somit in Abwesenheit getauft.
Die Namensfindung war ein erster Vorgeschmack dessen, was mich in Hinsicht auf die stereotype Betrachtungsweise Dritter kontra unser neues Haustier erwartete. Immerhin hatte mein Mann soviel Anstand, kein direktes Geschwister von Spekje aus demselben Wurf als Spanferkel zu bestellen.
Nach der Einfangaktion tranken wir mit Herbi noch ein Abschiedsbier, mit mehreren Abschiedszigaretten. Immer wieder schärfte er mir ein, das Baby gleich zur Mama zurückzubringen, falls es nichts zu sich nehmen will oder es ihm sonstwie nicht gut geht. Eine wundersame Sorge, da Zurückbringen ja gleichgestellt mit baldiger Schlachtung war. Wir legten ab, verließen die Schleuse und setzten unseren Weg flussaufwärts fort. Nach ein paar schiffsrelevanten Tätigkeiten, vor allem Aufräumen des Tauwerks und Kontrollgang im Maschinenraum, hob ich den Deckel der Deckskiste, um zu sehen, wie unser neuer Mitfahrer auf das Motorgeräusch reagierte.
übergroße Babyaugen starrten mich an. Das kleine Wesen bebte und zitterte immer noch mit allen Teilen seines Körpers. In die hinterste Ecke der Kiste gepresst, sah es mir fragend gerade in die Augen: »Was wirst du mit mir tun? Was hast du mit mir vor? Warum hast du mich noch nicht gefressen? Wann wirst du mich fressen? Was passiert mit mir? Oder wirst du mich ganz vielleicht doch nicht fressen? Bitte nicht!? Vielleicht?«
Was hatte ich getan? Welche Anmaßung, das Leben dieses jungen Tieres so in die Hand zu nehmen! Nun saß es hier, allein in einer kalten Kiste, fern von seiner Mutter und seinen Geschwistern, einsam und hilflos, mir ausgeliefert und sich dessen nur allzu bewusst. Mit großer Todesangst und einem Fünkchen Lebenshoffnung. Der Schiffsmotor dröhnte, der Boden bebte im Takt der Kolben. Wie sollte ein Winzling von fünf Wochen das begreifen? Die Erde, die keine Erde mehr war, wackelte unter den dünnen Beinchen. Dazu kam jetzt noch eine Menschenstimme: »Wenn ich nur wüsste, wie ich dir das Zittern nehmen könnte. Wenn ich dir nur erklären könnte, das alles gut wird. Zumindest so gut wir es eben können. Wenn ich nur wüsste — wie?« Meine Anwesenheit wirkte alles andere als beruhigend. Ich war, in Spekjes Welt, die größte Gefahr. Da stand ich dann, gegen alle Mutterinstinkte kämpfend — wie gern hätte ich ihn einfach auf den Arm genommen, gestreichelt und beruhigt. Aber das wäre Auslöser neuer Panik gewesen. Hochheben und Festhalten sind für ein Schwein nun mal gleichbedeutend mit gefressen werden. An diesem ersten Abend gab es für mich gegen alle meine Gefühle ankämpfend nur eines zu tun. Ihn in Ruhe lassen. Ich schloss die Kiste, bis auf einen Luftspalt mittels dazwischengeklemmten Holzes, um dem Schweinchen Zeit zu geben, sich an sein Gefängnis sowie all die fremden Geräusche und Gerüche zu gewöhnen.
So ging ich ins Steuerhaus, klappte meinen Laptop auf und suchte im Internet nach Fakten über Schweine und Minischweine. Dabei alle paar Minuten mit unterdrückten Tränen und Schuldgefühl durchs Fenster auf die Kiste an Deck schauend, in der das Schweinebaby, verängstigt und einsam, auf sein ungewisses Schicksal harrte. Mein Mann sinnierte: »Wenn es diese Nacht überlebt, ist schon viel gewonnen. Von Angst kann man sterben, Schweine haben ein besonders schwaches Herz. Nicht böse sein, wenn es morgen tot ist. Wir haben unser Bestes versucht.« Das sagt man dann so und glaubt sich selbst nicht.
Schweinefreundeforum
In den endlosen Weiten des WorldWideWeb war endlos viel über unser neues Haustier zu finden. Vor allem jede Menge gequirlte Schweinescheiße. Am frühen Abend, zu Beginn meiner Recherche, hoffte ich, online eine Handvoll Spinner zu finden, die Erfahrung mit so etwas Ausgefallenem haben. Im Verlauf der Nacht stellte ich fest, dass wir keine Exoten, sondern Teil einer großen, ständig wachsenden Gemeinschaft von Minischweineinhabern geworden waren. Minischweine waren absolut hip! Vom Umfang des ausgebrochenen Privathalterbooms in diesem Land hatte ich nie etwas geahnt.
Das Dumme war nur, dass jeder dieser unzähligen Experten eine andere Meinung hatte und es zu jeder Fachinfo auch ein entgegengesetztes Statement gab. Das las sich dann z.B. so: »Schweine müssen vegetarisch ernährt werden, Fleisch ist absolut verboten« versus: »Schweine brauchen tierisches Eiweiß, ich empfehle Hundefutter« oder: »Das Minischwein kann aufgrund seiner Intelligenz wie ein Hund in der Wohnung gehalten und Gassi geführt werden« versus: »Wohnungshaltung ist für Minischweine eine Qual und endet fast immer in der Trennung vom Tier. An der Leine sind ausgewachsene Minischweine nicht zu halten« oder: »Wir züchten Microschweine, Ferkel aus unserem Stall wiegen ausgewachsen 30-40 Kg« versus: »Es gibt keine Microschweine, alle Minischweine werden zwischen 80 und 150 Kg schwer« oder: »Minischweine brauchen im Winter eine geheizte Unterkunft« versus: »Man kann sie problemlos ganzjährig im Freien halten« oder: »Schweine müssen regelmäßig gebürstet und gewaschen werden« versus: »Die Hautpflege erledigen Schweine auf natürlichem Weg, Extrareinigung kann die Haut schädigen« Und so weiter und so fort. Es war zum Schweinemelken, was stimmte nun? Wie sollte ich unser Ferkel am besten ernähren, halten und pflegen?
Je fortgeschrittener die Stunde, umso öfter fiel mir bei all dem Googeln auf, dass ich bei für mich befriedigenden Antworten immer wieder auf derselben Website gelandet war. In den frühen Morgenstunden ließ ich Google endlich Google sein und benutzte nur noch die Suchfunktion von Schweinefreunde e.V., einem echten Schweineretterverein, mit vereinseigenem Schweinetierheim. Nachdem ich deren Hintergrundinformationen über diese Tiere durchgeackert hatte, erforschte ich ihr schier unendliches Forum, in dem wohl jede Frage, die einem Minischweinehalter begegnen kann, irgendwann schon einmal gestellt und beantwortet worden ist. Natürlich gab es auch, wie in jedem Forum, fragwürdige Beiträge, die fundierte Moderation der Vereinsvorsitzenden ließ aber keinen Unsinn unkommentiert. Freundlich und deutlich, kaum mit eskalierten, persönlichen Streitereien, die man auf anderen Seiten so oft ertragen musste. Von Gesetzeslage über Gesundheit bis psychisches Wohlbefinden, was ich hier las, hatte Hand und Klaue.
Es gibt Freunde, die behaupten, wenn ich was anfange, dann mache ich es immer gleich 300%ig. In dieser Nacht begann also meine Ausbildung zur Schweineexpertin. Schon bei der nächsten Sitzung konnte ich in meinem neuen Lieblingsforum ein, zwei Fragen von anderen beantworten. Noch ein paar Nächte und einen steifen Nacken weiter, zählte ich zu den aktiven Nutzern in vielen Fachsimpeleien rund um diese faszinierenden Tiere. Die Schweinefreunde wurden fester Bestandteil meiner digitalen Abendaktivitäten, sowie meines Freundeskreises.
Frau in der Kiste
Mit klopfendem Brustkasten öffnete ich, leise sprechend, am Morgen nach der ersten durchcomputerten Nacht die Kiste. Lebt es noch? Da hob sich das Köpfchen verschlafen aus dem Stroh, blickte ängstlich, aber ohne gleich wieder panisch rundzurennen. Spekje schnüffelte vorsichtig in die Luft. Wir ertrugen den Morgen nebeneinander zusammen. Ich stand an die Kiste gelehnt und erzählte ihm tausend Geschichten, vom Schiff, von uns, vom Hund, von seinem zukünftigen Leben. Sang ihm ein paar Lieder und was mir sonst noch so einfiel. Derweil wurde er langsam tapferer. Das Eberchen fing an, sein Stroh zu untersuchen, die Wände der Kiste abzuschnüffeln, alles zu erforschen. Gegen Mittag ließ ich meine Hand in die Kiste hängen. Er rannte zwei, drei schnelle Runden an den Wänden entlang. Als ihn weiter nichts verfolgte, hockte er wieder in der hintersten Ecke, schaute, fragte … »Na denn«, blinzelten die Äuglein, schon geringer verschreckt: »Wenn du mich immer noch nicht fressen willst, kann ich ebenso gut die Kiste weiter untersuchen. Und danach eigentlich auch deine komische, hängende Pfote mit fünf Klauen.« Am frühen Nachmittag stellte ich langsam und vorsichtig einen Fuß in die Kiste. Als ihn dieser auch nicht mehr zu Fluchtversuchen veranlasste, kam der zweite Fuß dazu, bis ich zur Abenddämmerung so ziemlich meine ganze Lebensgeschichte erzählt, alle Kinderlieder, die ich kenne, zwanzigmal gesungen hatte und ganz bei ihm in der Kiste saß.
Trotz unserer Annäherung hatte Spekje noch kein Futter angerührt. »Wenn er nicht frisst, müsst ihr ihn auf der Rückfahrt gleich wieder hier absetzen!«, dröhnten mir Herbis Abschiedssätze im Hirn. Er war sooo überzeugt, dass dies der Fall sein würde. Grinsend über unsere Schnapsidee vom Ferkel an Bord. Da war sie wieder, die tolle Option, ihn zum Fressen dahin zu bringen, wo er selbst bald gefressen würde. Wie gesagt, manchmal fand ich Herbis Besorgnis leicht befremdlich. Wir riefen lieber einen Freund an, der uns sowieso bei Hafenankunft an Bord besuchen wollte: »Kommst du vorher noch an einem Supermarkt vorbei? Könntest du bitte Kindermilch, eine Babyflasche und Windeln in der größten Größe mitbringen?« Nichts staunte durch die Leitung: »Klar, kein Problem. Welche Sorte Milch?« Die Gegenfrage überforderte mich ansatzweise: »Mmmh, so Pulver für Babys halt.« Das sind die echten Freunde — kein Wieso und Warum. Es ist doch das Normalste von der Welt, wenn kinderlose Schiffer auf einmal dringend Babyartikel haben wollen. Nur eine ganz sachliche Rückfrage, mit anschließender Aufklärung über die unendlichen Welten des Babymilchangebots. Da er anscheinend mehr Milchahnung hatte als ich, überließ ich ihm die Auswahl: »Nimm einfach irgendeine gute Marke. Ruhig für Kleinkinder. Ach ja, vielleicht auch 'ne Packung Brei.« Er war nicht mal sonderlich erstaunt, als ich seinen Einkauf, nach Übergabe in der Küche, gleich wieder nach draußen trug und ihm den Bewohner der Deckskiste zeigte: »Dachte ich mir schon, dass ihr wieder was Beklopptes habt. Ein normales Baby hätte mich jetzt fast enttäuscht.«
Gerüstet mit warmer Breimilch in einer Babyflasche, deren Saugloch grob größer gestochen war, kletterte ich wieder in die Kiste. Schlauschweinchen fand Nuckeln an so einem Plastikding unter seiner Würde. Aber wenn ich mit dem Gummilutscher oder meinem Finger ein paar Tropfen von dem Zeug auf sein Mäulchen schmierte, war das schon ein fesselndes Spiel. Was einen auf die Idee bringen konnte, Hunger zu bekommen. Schnell hatten wir unseren Ablauf gefunden: Man matsche erst mit den Fingern warmen Babybrei auf seine Lippen. Dann tue man dasselbe mit dem Nuckel der Flasche. Das ist ein lecker riechendes Spielzeug, dem Schwein gern folgt. So locke man seinen Rüssel an der langsam bewegten Babyflasche Richtung Futternapf. Und dann reiche man den Körnerbrei aus dem Napf auch mit dem Finger. Spekje kapierte zwar schnell, dass man das Futter auch gleich aus dem Pott schlabbern kann, aber von Fingern blieb es viel schöner. Für alle Zeiten. Später allerdings, nachdem der Napf spritzend leergemampft war. Wie oft war ich dankbar für diese erste Übung, bei der er das so wichtige Wort »Vorsichtig!« lernte. Schweine werden mit nadelspitzen Milchzähnchen geboren, nur zu dem einmaligen Zweck, sich gleich gegen die Geschwister zu behaupten, um die beste Zitze zu erobern. Einmal eingeteilt, ist der Kampf erledigt. Jedes behält seinen errungenen Saugplatz bis zum Abstillen. Spekjes kurze Ferkelwaffen wollten schon mal etwas zu gierig den Brei von meinen Händen kratzen. Dann wich ich nicht aus, sondern ging zum Schein auf seinen Knabberwunsch ein, mehr als er wollte. Als freundlicher Gegenangriff. Indem ich die Finger, sanft aber nachdrücklich, noch tiefer in sein Maul steckte. Bis in den Hals. Was er nicht echt angenehm fand. Das bescherte mir zwar ein paar oberflächliche Schrammen von den scharfen Beißerchen, aber es war äußerst wirkungsvoll. Ohne Streit verstand er meine Botschaft: »Finger bringen zwar Leckeres, aber wenn man versucht, sie mit zu essen, bekommt man ein Würgegefühl.« Seitdem nimmt Spekje alle Nascherei, die mit der Hand gegeben wird, ganz sanft mit gespitzten Lippen an. Nicht unbedingt arttypisch. Von der Hand zum Mund ist ein kurzer Weg. Unseren ersten Kuss erzwang ein Apfelstückchen, das er mit dem Maul zwischen meinen Lippen hervorziehen durfte.
Auch den zweiten und dritten Tag verließ ich mein Schweinchen nur noch zum Essen, Pinkeln und über Nacht. Ich saß von Sonnen- bis Mondaufgang in der Kiste. Auf der begrenzten Fläche hatte Spekje keine andere Möglichkeit, als mich, mehr oder minder zufällig, zu berühren, wann immer er sich bewegte. Was soll er wohl von mir gedacht haben — Liebe mich oder ich fress' dich? Er hatte eigentlich gar keine andere Chance, als schnell zu lernen. Anfassen wurde mehr und mehr geduldet, ohne Weglaufen. Mit jeder Stunde machten wir Fortschritte. Endlich suchte er meine Nähe auch eigenständig. Letztlich lag der kleine Eber, friedlich eingekuschelt, zwischen meinem Bein und meinem Arm. Zum Schlafen. Eine logische Folge, wenn man sich geküsst hat. Dies waren die wunderbarsten Momente, denn nur wenn er döste, stoppte auch dieses fürchterliche Zittern. Was besteht Schöneres, als ein wildes Tierkind, das beginnt dir sein Vertrauen zu schenken? Und was kann schlimmer sein, als wenn du es dann verlassen musst? Allein über Nacht, in der kalten Kiste. Am liebsten hätte ich sitzend bei ihm geschlafen, aber das wäre unweigerlich in einer Ehekrise gegipfelt. Die gibt es auch bei Unverheirateten.
Im Bett ging es nicht viel besser. Von wegen Pennen oder Partnerschaftspflege. Ich wälzte mich in meinen Sorgen: »Wenn ich nur eine Idee hätte, meinen Mann zu überzeugen, dass Spekje nach drinnen muss. Dass er zu allein ist da draußen. Es wird auch zu kalt. Ein junges Schwein braucht doch Wärme. Aber mein kürzlich verstorbener Hund durfte noch nicht mal mehr in die Wohnung, als er alt wurde und Dreck machte. Wie soll ich dem Kapitän das dann für ein Schwein einreden? Für ihn ist es ja ein wildes Tier, das normal auch draußen lebt und, sobald er zahm genug ist, an Deck laufen kann. Da steht schließlich von den zwei Hundehütten noch eine leer.«
In diesen ersten drei Tagen nahm ich ständig dünne Leinen, von unseren Flaggen, mit in die Kiste. Erst ließ ich Spekje diese beschnüffeln und untersuchen. Wenn sie nicht mehr als gefährlich eingestuft wurden, legte ich sie auf seinen Rücken, strich damit über seinen Körper, berührte ihn überall damit. Tauziehen haben wir auch gespielt. Bald konnte ich ihm problemlos eine selbstgebastelte Leinenkonstruktion um Körper und Hals binden. Natürlich hielt er dafür nicht still. Es blieb ein Spiel von Streicheln, Reden, Tauknabbern und im richtigen Moment hier und da einen Knoten schlagen. Einmal angelegt, lief er mit seinem Geschirr, als wäre es nicht vorhanden. Was für ein Meilenstein — denn auf einem Schiff kann es doch lebenswichtig sein, ein Tier, wenn nötig, in eine Richtung zu leiten oder festhalten zu können! Schweinenaiv wie ich war, hoffte ich ja auch, bei geeigneten Liegeplätzen im Grünen mit dem Eber an Land spazieren zu gehen.
Der nächste Abend war deutlich frostiger als die Nächte davor. Unerwartet präsentierte mein Mann die Erlösung, ganz von selbst: »Das arme Schwein muss rein. Das geht so nicht, in der kalten Kiste, allein ist auch nur einsam. Außerdem gehen mir die Funksprüche der Kollegen auf die Nerven, ich würde meine Frau in die Deckskiste sperren. Alle Vorbeifahrenden wollen wissen, warum dein Kopf da rausguckt. Mein jüngster Sohn kommt sowieso kaum noch zu Besuch. Falls doch, kann er auch auf dem Sofa oder in der Lotsenkammer schlafen. Wenn du willst, versuch mal, ob du aus seinem Kinderbett einen Stall bauen kannst.« Meine Blutpumpe machte ungesunde Doppelsprünge vor Freude: »Spekje, wir sind gerettet. Du kommst raus aus der Kiste! Zu uns in die Wohnung!«
Den vierten Tag war unser Schweinchen am Vormittag recht viel allein, denn ich trat meine Laufbahn als Tischlerin an.
Vom Kinderbett zum Schweinestall
Da wir nicht auf Schweineeinzüge vorbereitet waren und handwerkliche Tätigkeiten, die sensiblere Materialien als Stahl oder Motoren betrafen, lieber in Auftrag gaben, hatten wir nur einen altersschwachen Akkubohrer an Bord. Der von Schraube zu Schraube langsamer wurde. Sein letzter Einsatz war Jahre her, damals drehte er Lollis im Mund jenes ehemaligen Kindes, dessen Schlafplatz ich nun umfunktionierte. Zum verträumten Lutschen war seine Höchstgeschwindigkeit gerade ausreichend, bei echter Arbeit hatte ich das Bohrding nie erwischt. Meine mangelnde Stallbauerfahrung wirkte ebenso entschleunigend auf das Vorhaben.
Die Konstruktion war simpel. Zweidrittel Lattenrost riss ich heraus, der Restrost blieb am Kopfende unverändert, darauf eine große Pappe gelegt, fertig war die überdachte Schlafecke. Unter den Latten gab es mal Spielzeugstauraum mit Schiebetüren, von denen noch zwei vorhanden waren. Eine schraubte ich fest, plus ein weiteres Brett, um den Schlafplatz blickdicht zu machen. Die andere blieb gangbar, der perfekte Ferkeleingang. Als Verschluss diente ein kunstvoll drumgewickeltes Schlüsselanhängertau mit Karabinerhaken. Bis hier alles easy. Nun war noch eine Hälfte unter der Bettumrandung offen. Damit der winzige Eber ins Wohnzimmer schauen konnte, wollte ich einige der herausgenommen Bretter vom Lattenrost vorschrauben, mit entsprechenden Guckabständen dazwischen. Mangels Säge kreativschief am Fußende hinausragend. Das ganze Bett war weiches Pressholz, aber die Latten hatten es in sich. Der alte Bohrer jaulte und stöhnte. Hätte er einen Plattenteller gedreht, wäre erst noch eine 17er Single leidlich abspielbar gewesen, dann verlangsamte er über 25er bis zur 30er Langspielplatte, die Frauenstimmen verwandelten sich in Männerbässe, bis nur noch dumpfe Klänge übriggeblieben wären. Die Bohrergeräusche tönten ähnlich. (Für alle nach den Achtzigern Geborenen: Schallplatten waren wie riesige, schwarze CD's, bei denen das Abspieltempo Einfluss auf den Klang hatte. Frag mal deinen LieblingsDJ, der verdient mit unseren Kinderspielen heute viel Geld.) Schließlich kreiselte die Bohrerspitze nur noch in Zeitlupe in der Luft, bei Berührung mit Material blieb sie stehen. Eine Stunde auf dem Ladegerät brachte eineinhalb Minuten 25er Schallplatte, danach brach die Stromversorgung gleich wieder zusammen. Diese Maschine brauchte Hilfe. Ich half ihr. Für die restlichen Schrauben drehte ich den Kopf des Bohrers von Hand. Rum und rum und rum … bis die Finger schmerzten. Spekjes neues Heim war fertig. Ich auch. Der Bohrer auch. Dem half ich nun final. In den Müll.