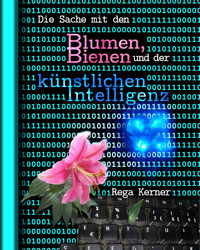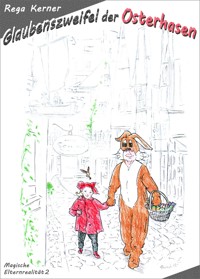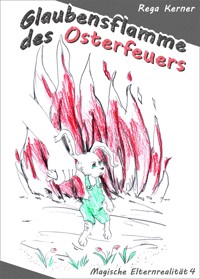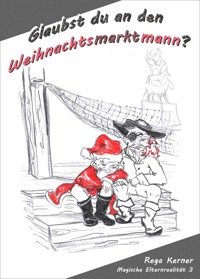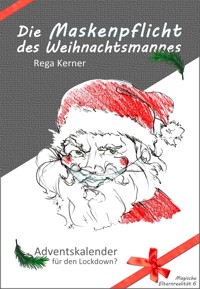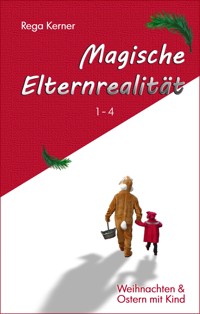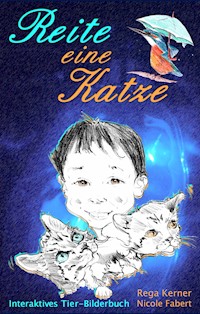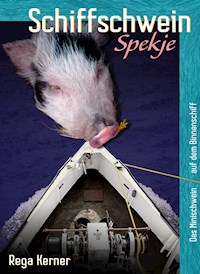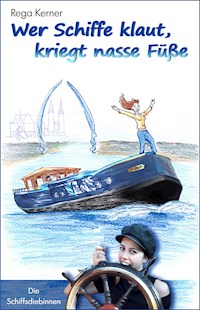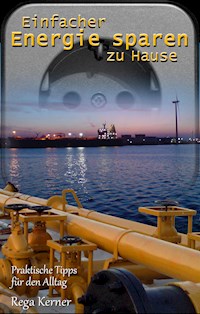
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wir sind über achtzig Millionen, das ist unsere Macht: Schaltet jede*r nur ein Standby aus, wird ein Kraftwerk dichtgemacht! Mit diesen teils verblüffend simplen Kniffen und Tricks sparst du mühelos Strom, Gas, Wasser und dadurch viel Geld. Ohne Verzicht auf Komfort und ohne teure Anschaffungen, kreativ mit vorhandenen MItteln. Garantiert praxiserprobt und alltagstauglich, aus dem Erfahrungsschatz der Binnenschifferin: In Jahrzehnten an Bord ist mir bewusster Umgang mit begrenzten Energiereserven in Fleisch und Blut übergegangen. Und das hat sich nachweislich bewährt: Seit wir an Land wohnen, verbrauchen meine Tochter und ich ungefähr nur die Hälfte des Durchschnitts vergleichbarer Haushalte. Also 50% Strom und Gas weniger! Konstant, Jahr für Jahr. Wenn es mir so leicht fällt, kannst du das auch. Ein großer Teil unserer Haushaltsenergie verpufft ungenutzt. Darum tut Energiesparen gar nicht weh, es kann und sollte sogar Spaß machen. Und ganz nebenbei die Welt retten. Wie das geht, möchte ich dir unterhaltsam erzählen. Komm, schließ dich an!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rega Kerner
Einfacher Energie sparen zu Hause
Praktische Tipps für den Alltag
1. Auflage ©2022
Texte & E-Book: medienschiff.de
Titelbild: Cover dein Buch
♦
♦
Anhang: Leseproben
Schiffschwein Spekje
Autobiographischer Roman
Die Maskenpflicht des Weihnachtsmannes
Adventskalender für den Lockdown? (Ironische Novelle)
♦
♦
Ein Energiespargedicht:
Die Tropfensumme
Viele Tropfen füllen das Fass
und viele Fässer den Tank.
Erst im Ergebnis wird es krass,
die Tropfenmasse macht die Erde krank.
Energie ist die Summe aller Nutzung,
ihre Quellen wandelbar, in jede Form,
ob Lampe, Auto oder Heizung,
kleinste Tropfen helfen enorm.
Nicht nur Strom, Gas, Öl bei dir zu Haus,
auch jedwedes Ding, das du sonst gebrauchst,
benötigt entweder direkt Energie
oder entstand einst durch sie,
gefertigt in der Industrie.
Wir sind über achtzig Millionen,
das ist unsere Macht.
Schaltet jeder nur ein Standby aus,
wird ein Kraftwerk dichtgemacht.
Überleg, ob du heut etwas langsamer fährst
oder der Kollegin Platz im Wagen gewährst,
bei gebrauchten Klamotten gibt es wahre Schätze
und Lichtschalter drückst du ohne Hetze.
Kleinkram sparen können ich und du,
dem Staubsauger gönne einen Tag Ruh
oder heiz ein Grad minder und im Nu
geht eine ganze Pipeline zu.
Ob du arm bist oder reich,
völlig anders oder eher gleich,
in winziger Wohnung oder riesigem Haus,
links, rechts oder in der Mitte geradeaus,
auch egal, welche Partei man wählt:
DEIN Tropfen zählt!
Warum diese Tipps ›echt‹ alltagstauglich sind
Wieso mutiert eine Romanautorin urplötzlich zur Energie-Spar-Ratgeberin?
Der Auslöser kam mit der Post: In Form einer Vergleichsgrafik. Erstellt von unseren Stadtwerken, zeigte das Balkendiagramm den gemittelten Energiebedarf verschiedener Haushaltsgrößen. Im Verhältnis zur eigenen Rechnung.
Demnach verbrauchen meine Tochter und ich nur ungefähr die Hälfte des Durchschnitts in Bremen!
Beim Strom bedeutet unsere Hälfte des Zwei-Personen-Durchschnitts sogar weniger, als ein Ein-Personen-Haushalt verbraucht. Zum Gasverbrauch zeigt die Statistik keine Personenzahl, sondern vergleichbare Wohnungsgröße. Darunter fällt alles unter 60 qm als kleinste genannte Einheit, also auch die Mehrheit der Einpersonenhaushalte.
Umso erstaunlicher, dass wir zu zweit nur halb soviel benötigen.
Dabei haben wir keineswegs das Gefühl, auf irgendetwas zu verzichten oder uns einzuschränken. Wie kann das sein?
Ein Energiesparhaus? Nein, im Gegenteil. Wir wohnen in der Erdgeschosswohnung eines alten Wohnblocks, diese Nachkriegsbauten sind berüchtigt für miserable Energiewerte.
In meinem Haushalt gibt es keine teuren neuen Energiespargeräte. Vom Kühlschrank über Waschmaschine, Geschirrspüler, Fenster und Wasserboiler bis zur Gasheizung ist hier alles mindestens zwei oder mehr Jahrzehnte alt.
Ergo: Unser geringer Verbrauch widerspricht jeder modernen Energiesparlogik!Warum?
Auf der Suche nach Antworten befragte ich ein paar Freunde zu ihren jährlichen Kilowattstunden.
Und bekam Schnappatmung!
Sie nannten schwindelerregende Zahlen, teils über das Dreifache meiner Werte. Was mir bewusst machte, dass der ›Durchschnittswert‹ unserer Stadtwerke kein üblicher Verbrauch ist, sondern beinhaltet, dass viele - rein rechnerisch die Hälfte - sogar da drüber liegen!
Das war der Moment, in dem mir dämmerte, ich sollte diesen Ratgeber schreiben.
Klimawandel, explodierende Energiepreise, Sanktionen gegen Russland … es gibt Gründe genug: Angesichts der Weltlage schien es mir dringend an der Zeit, meine eigene Sparsamkeit näher zu ergründen und das Ergebnis weiter zu verbreiten.
Denn wenn es mir so leicht fällt, kannst du das auch.
Stell dir vor, es wäre wirklich total einfach, 50% Energie zu sparen – und alle machen mit!
Oder wenigstens viele – das würde schon reichen, um Pipelines schmerzfrei dichtzudrehen und einen Haufen weiterer Probleme von einem Tag auf den anderen zu verringern oder sogar nahezu in Luft aufzulösen! Ich weiß, das geht und ist keine Hexerei.
Wie konnte ich quasi unbemerkt sparsam werden?
Der Ursprung ist klar:
In langen Berufsjahren als Binnenschifferin ist mir bewusster Umgang mit begrenzten Energiereserven in Fleisch und Blut übergegangen.
An Bord ist das Lebensgefühl näher an den elementaren Bedürfnissen - Wärme, Wasser, Nahrung - nichts kommt von selbst in die Schiffswohnung: Vor jeder Reise werden die Wasser- und Dieseltanks gefüllt, die Rechnung führt den exakten Verbrauch in Litern und Euros (oft schmerzhaft) vor Augen und unterwegs wird der Bestand am Peilglas des Tanks im Blick behalten. Ohne Diesel erzeugt der Generator keinen Strom, ohne Strom läuft keine Wasserpumpe, alle Lebenssysteme hängen voneinander ab.
Auch muss jederzeit genug Energie- und Nahrungsvorrat vorhanden sein, um technische Ausfälle, Sturm, Hoch- sowie Niedrigwasser irgendwo in der Pampa überbrücken zu können. Bei Strom- oder Wasserausfall krabbelt man seufzend in den Maschinenraum, um an Pumpen und Motoren zu schrauben. Denn es gibt keinen Vermieter, den man bei Problemen anrufen könnte. An Land betrachtet niemand das Drücken eines Schalters als Leistungsanfrage ans Kraftwerk, doch an Bord hört man dies sogar: So mancher Generator brummt bei erhöhtem Stromverbrauch mahnend einen Tick lauter.
In der Summe entsteht ein ständiges Bewusstsein für sparsamen Umgang sowie technischen Erhalt der nötigen Grundversorgung.
Heute lebe ich nicht mehr an Bord. Alleinerziehend in die Wohnung an Land gezogen, gab es jedoch keinen logischen Grund, meine Gewohnheiten zu ändern. Im Gegenteil, plötzlich arg begrenzte Finanzen animierten mich, sparsames Verhalten zu verfeinern und den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Nach erster Analyse komme ich zu dem Schluss, meine niedrige Energie-Rechnung basiert auf der Summe vieler kleiner Bausteine.
Die Basis ist das Bewusstsein, dass alles, aber auch wirklich alles, was man tut: Energie verbraucht.
Einmal überlegt, ändert man kleine alltägliche Handlungen.
Aus wiederholten Handlungen werden nach wenigen Tagen, spätestens Wochen, Gewohnheiten. Und das ist grandios:
Gewohnheiten merkt man nicht mehr. Die führt man automatisch aus, ganz nebenbei. Energiesparen tut gar nicht weh!
Außer, es stört Familienmitglieder, aber nicht ernsthaft:
Meine Tochter und ich lachen zum Beispiel regelmäßig, wenn wir uns gegenseitig das Klolicht ausknipsen. Das passiert unbewusst bei Wahrnehmung von Lichtschein auf dem Flur, im Vorbeigehen. Ein Fluch aus dem Bad zeigt dann den Fehler im Automatismus: Ups, da saß jemand drin.
Für die grundlegenden Tipps bin ich zuerst meinem eigenen Haushalt durchgegangen. Der laut Statistik nachweislich sparsam ist. Dabei erinnerte ich nebenbei die eine und andere Anekdote, ich erzähle also beispielhaft so einiges von mir.
Diese selbst erprobten Sparmaßnahmen ergänzte ich mit überliefertem Wissen. Von meiner Mutter, die im zweiten Weltkrieg aufwuchs und in der Ölkrise bereits Auto fuhr, sowie von meiner Großmutter, die beide Weltkriege und die spanische Grippe überlebte, aber dennoch den Humor bewahrte.
Diese zwei Frauen führten jeweils Haushalte, die Krisen sparsam meisterten. Ich gehöre zu einer Brückengeneration, die mit alten Tricks aufwuchs (oder sie erzählt bekam) und gleichzeitig neue Techniken begeistert mit entwickelte. Obendrauf legte ich einige moderne Recherche, um über meinen Horizont hinaus das Beste aus allen Zeiten zusammen zu führen.
Viele der Ideen sind nicht unbedingt neu, nur teilweise in Vergessenheit geraten und garantiert günstig sowie praxistauglich. Ergänzt durch kreative Kniffe, wie man bekannte Maßnahmen, die manche aus Kosten- oder Zeitgründen aufschieben, erstaunlich einfach mit vorhandenen Mitteln selbst lösen kann.
In dieser umfassenden Zusammenstellung findest du gewiss viele Anregungen, die (gegebenenfalls mit individuellen Variationen) auf deine Wohnung und deinen Alltag übertragbar sind.
Ich empfehle, beim Lesen Zettel und Stift bereitzulegen, um Stichworte zu für dich passenden Ideen festzuhalten. Das kann später als Startliste dienen.
Die Notizfunktion vom Smartphone geht natürlich ebenso. Ich bevorzuge Papier, weil wissenschaftlich erwiesen ist, dass man sich einmal Notiertes besser merkt. Von Forschungen, ob digitales Schreiben gleichwertig aufs Gedächtnis wirkt, weiß ich nichts. (Und bezweifle es, da mir im Moment nicht mal einfällt, was ich gestern in sozialen Medien tippte.)
Hinweis zu möglichen Fehlerchen:
Wegen Dringlichkeit angesichts der Weltlage, habe ich dieses Buch total spontan in wenigen Wochen geschrieben und direkt veröffentlicht. Quasi im Notgang, meine Roman-Manuskripte überarbeite ich normalerweise monatelang mit haufenweise Feedback Dritter. Doch für diesen Ratgeber hätten Verlagsmühlen zu langsam gemahlen.
Ich bitte deshalb um Nachsicht für manche Sätze, die ›wie mir der Schnabel gewachsen ist‹ rauspoltern und eventuell sonstige Unperfektheiten.
Dafür steckt das Büchlein voller Energie, die ich in langen Tag- und Nachtschichten hinein speicherte, damit du sie dir jetzt heraus ziehen kannst.
Aber genug des nervigen Vorgeplänkels, kommen wir zu den echt praktischen Tipps:
Wie spare ich Strom?
Untersuchungen schätzen, der gemeinsame Stromverbrauch von Standby-Geräten in Deutschland braucht die Leistung eines mittleren Atomkraftwerks. Für den einzelnen Haushalt kann eine Ersparnis um die 100,- Euro jährlich drin sein – nach alten Energiepreisen vor den Krisen, jetzt verdoppelt oder vervielfacht sich das vermutlich.
Für Strom, den man gar nicht nutzt!
Groß am Anfang meiner Liste steht deshalb: Standby-Geräte aus! Denn ständiger Wartezustand ist quasi Sinnbild ungenutzt verbrauchter Energie.
Bei mir hängt fast alle Technik auf Schalterleisten, dem Rest wird gnadenlos der Stecker gezogen. Auch Ladegeräte, zum Beispiel vom Handy oder Laptop. Weil die sogar etwas Strom ziehen, wenn gar kein Gerät angeschlossen ist! Das Smartphone hat für meine Bequemlichkeit eine einzeln schaltbare Steckdose. Nebenbei erhöht komplette Abschaltung die Lebensdauer.
Ja, es nervt ein wenig, dass mein Radio sich deswegen keine gespeicherten Sender merken kann. Aber davon lasse ich mich nicht zur Stromverschwendung zwingen. Stattdessen liegt daneben ein Zettel mit den mir wichtigsten Sendefrequenzen. Das Radio ist ein Erbstück. Bei eigener Anschaffung achte ich seit jeher auf Geräte, die ohne Dauerstandby funktional bleiben.
Ich mag mechanische Schalter am Stecker, die werden einem in allen Größen per Sonderangebot quasi nachgeworfen. Für Digitalfreunde eignen sich dagegen die neueren WLAN- oder Funkversionen.
Apropos WLAN – das braucht daheim ebenfalls niemand, wenn alle schlafen, beziehungsweise zur Schule, in die Firma oder spazieren gehen.
Akku- und batteriebetriebene Geräte lassen mangels Kabel gern vergessen, dass ihr Verbrauch später wieder geladen werden muss. Nachts läuft bei uns nur ein Handy wegen der Weckfunktion. Alles andere ist final aus. Bei selten genutzten Teilen wird zudem der Akku gelöst, um Kriechverbrauch zu vermeiden.
Angewöhnte Routine beim Smartphone ist, nach dem Abziehen vom Ladegerät grundsätzlich den Energiesparmodus zu aktivieren.
Nebenfunktionen wie Standort, Hotspot, Bluetooth et cetera sind bei mir im Normalbetrieb aus. Alle Apps werden nach Gebrauch komplett geschlossen, statt im Hintergrundmodus geöffnet zu verweilen. Denn selbst unsichtbar offene Apps erhöhen den Stromverbrauch.
Außer, man benötigt die App bald erneut. Dann kann der energieintensivere Startvorgang mehr verbrauchen als kurzes Warten im Hintergrund.
Meine kleinen Batterien für Spielzeug, Uhren etc. sind inzwischen (bis auf eine Notfallreserve) fast alle wiederaufladbar. Was theoretisch zwar meine eigene Stromrechnung höher ausfallen lassen sollte, aber das scheint hier ja laut Statistik nicht ins Gewicht zu fallen. Und langfristig reduziert es sowohl meine Beschaffungskosten als auch Produktionsenergien bei Batterieherstellung und Entsorgung.
Kein Licht in ungenutzten Räumen.
Beim Reinkommen an, beim Rausgehen aus, bei Lichtschein im Vorbeigehen evtl. Vergessenes ausschalten:
Lichtschalter gehören zu den kinderleicht trainierbaren Gewohnheiten.
Das weiß ich sicher, da meine Tochter es beherrschte, sobald das Händchen hoch genug reichte. Ich selbst haue sogar in fremden Wohnungen an Wände neben Türrahmen und merke das nur, falls an der Stelle gar kein Schalter ist.
Natürlich kann man in Durchgangsräumen wie Flur oder Toilette Bewegungsmelder nutzen, das ist oft sinnvoll. Die gibt es heutzutage, neben Einbauvarianten, sogar in Birnen integriert, simpel beim nächsten Wechsel in jede Art Lampe zu drehen.
Mich persönlich irritiert eine festgelegte Leuchtdauer allerdings: Ausschalten ist mein unbewusster Reflex. Erst wenn ich nicht schalten kann, also den erleuchteten Raum im Vertrauen auf automatische Abschaltung verlassen muss, dringt der fehlende Vorgang ins Bewusstsein.
Alle Leuchtmittel waren hier Energiesparbirnen, seit die vor Jahrzehnten erfunden wurden. Aufgrund deren Langlebigkeit findet der Austausch zur neuesten Generation - den LEDs - jetzt nur langsam, aber stetig statt.
Kein Glühbirnenkauf ohne vergleichenden Blick auf Watt- und Lumen Zahl. Klare Abwägung zwischen helleren Lampen als Arbeitslicht (meist Deckenlampen sowie Schreibtisch) und weniger Leistung für gemütliche Dauerbeleuchtung (beispielsweise für die Sitzecke).
Im Zweifel für die geringere Wattzahl, dennoch sollte in jedem Raum eine hellere Lampe vorhanden sein.
Noch ein paar Worte zum Smart Home:
Ja, digitaler Automatismus kann Energieverbrauch reduzieren, insbesondere wenn man wenig Lust hat, seine manuellen Gewohnheiten zu trainieren, oder die familiäre Situation das einfach nicht hergibt.
Aber nein, nicht jede Funktion spart mehr, als sie selbst verbraucht und viele dienen pur der Bequemlichkeit. (Deren Folgen manche dann wieder im Sportstudio bekämpfen.)
Es gilt jeweils abzuwägen:
Will ich das, weil es schick ist oder echten Nutzen hat? Kann ich es womöglich selbst besser als die Technik? Spart es unter dem Strich – von Herstellung über täglichen Stromverbrauch bis Entsorgung – tatsächlich mehr Energie, als es benötigt?
Und nebenbei ganz energieunabhängig eine Grundregel aus der Schifffahrtspraxis:
Hat es ein mechanisches Backup?
Es wäre zum Beispiel ziemlich blöd, wenn du bei Stromausfall oder Computerfehler, die bekanntlich immer mal wieder und im ungünstigsten Moment auftreten, ratlos vor der eigenen Haustür stehst, weil das Schloss nicht mehr mit dir redet. Klatschen oder Befehlen, anstatt an- und ausknipsen, ist einerseits potentiell geeignet, motivierter ans Schalten zu denken. Andererseits sollte alternativ ein Schalter vorhanden bleiben, für den garantiert kommenden Tag, an dem die Platine anfängt zu spinnen.
Mein Kühlschrank steht im Winter auf Stufe 1, im Sommer zwischen 1½ bis zu 2. (Erst beim Nachschauen für diesen Text entdeckte ich, dass das Rädchen bis Stufe 5 geht – wer braucht denn sowas?)
Wann im Frühling beziehungsweise Herbst Zeit zum Nachregeln ist, spüre ich an der Temperatur der Milch. (Klingt komisch, ist aber so. Vermutlich bemerke ich diese Veränderung, weil ich für meinen Milchkaffee täglich mehrfach danach greife. Und verschärft drauf achte, da die Biovollmilch im Hochsommer nur knapp ihr Haltbarkeitsdatum schafft, wogegen sie im Winter meist ein paar Tage darüber hinaus hält.)
Statt Milchtemperaturgefühligkeit zu entwickeln, kann man natürlich die empfohlenen Temperaturen messen (+7 Grad im oberen Fach). Oder pauschal festlegen, wenn sommerliche Hitze über die im Winter übliche Heizungstemperatur steigt – es in der Wohnung also wärmer als circa 21 Grad wird – braucht ein nicht digital gesteuerter Kühlschrank etwas mehr Power, darunter weniger.
Hauptsache ist wohl (wie bei fast allen Punkten hier), überhaupt auf die Einstellung zu achten.
Und die Belegung: Wärme steigt nach oben, aber geschlossene Fächer (Gemüse, Butter etc.) sind ebenfalls wärmer. Leichter verderbliches (wie Fisch, Fleisch etc.) gehört folglich in den unteren, aber offenen Bereich.
Was auf den ersten Blick absurd scheint, aber wahr ist: Ein voller Kühlschrank braucht weniger Strom als ein eher leerer. Warum? Die enthaltenen Lebensmittel speichern Kälte. Nach jedem Luftaustausch durch Türöffnen muss das Gerät nachkühlen. Je weniger Luft im Schrank, umso geringer dieser Nachkühlbedarf.
Klar, es wäre kontraproduktiver Unsinn, deswegen Dinge hineinzustellen, die gar nicht gekühlt werden müssen.
Aber es lohnt beispielsweise, die Lücken mit Kaltgetränken zu füllen, die man sonst oft erst einzeln austauscht, wenn die offene Flasche leer ist. Oder mit haltbaren Lebensmitteln, die zwar im Regal lagern könnten, aber nach dem Öffnen der Kühlung bedürfen, sprich dort verbleiben.
Ziel ist, jedes Teil nur einmal energieaufwendig runter zu kühlen. Danach dient es dem Kühlschrank als Kältespeicher, bis es verzehrt wird.
In diesem Zusammenhang ist es ebenso hilfreich, Kühlschrankinhalte nach Benutzung schnell zurückzustellen, damit sie möglichst kalt bleiben.
Ein alter Hut, aber weil es so wichtig ist: Niemals heiße Speisen in Kühlschrank oder Tiefkühler stellen. Ob Essensreste für morgen oder frisch gekochter Pudding, lass was vom Herd kommt vorher mindestens auf Zimmertemperatur abkühlen.
Von Herbst über Winter bis Frühling, sofern es draußen kälter ist als drinnen, kannst du deinen Kühlgeräten die Arbeit noch mehr erleichtern. Indem du Warmes auf dem Gartentisch, dem Balkon oder einem Fensterbrett im Freien vorkühlst. (Mit Deckel, sonst freuen sich Vögel und Insekten.)
Was kalt ist, wenn es in den Kühlschrank kommt, muss nicht runter gekühlt werden. Warum mehr Strom verbrauchen für etwas, das (teilweise) von alleine geht?
Neben dem direkten Kühlaufwand gibt es eine weitere Folge: Heißes erzeugt vermehrt Kondenswasser, was Vereisung fördert. Die entstehenden Eisschichten im Eisfach oder an Tiefkühlerwänden erhöhen ihrerseits den Stromverbrauch des Geräts.
Und höre auf deine Lebensmittel: Wenn der Salat außen matschige Frostblätter bekommt, ohne die Wand berührt zu haben, oder wenn das Getränk geschmacklos wird und an den Zähnen schmerzt, ist dein Kühlschrank zu kalt!
(Erst recht, wenn es gar stellenweise feine Eisbildung gibt. Das darf nur der Tiefkühler.)
Beim Tiefkühler muss ich gestehen, regelmäßiges Abtauen zwar zu planen, aber oft aufzuschieben. Meist mit der Ausrede, auf Schnee oder mindestens Frost zu warten, um den Inhalt derweil auf dem Balkon zu lagern. Obwohl ich doch weiß, dass eine innere Eisschicht bis zu 45% Mehrverbrauch bedeuten kann.
Na ja, nobody is perfect.
Der Übergang zum nächsten Kapitel ist fließend:
Bei uns wird Warmwasser mit Strom erzeugt, der folgende Abschnitt enthält also weitere Stromersparnis.
Ich habe dem Wasser trotzdem eine eigene Überschrift gegönnt, denn andere erhitzen ihr Wasser mit Gas- oder Ölheizung und, von der Energie abgesehen, sind sinkende Grundwasserspiegel sowie Dürre auch in Deutschland ein wachsendes, ernstes Problem.
Wasser verdient besondere Aufmerksamkeit.
Über das eigene Haus hinaus gedacht:
Selbst der Druck fürs kalte Wasser muss von den Stadtwerken mit Energieaufwand erzeugt werden und Klärwerke klären ebenfalls nicht ohne Energiezufuhr. Auch das zahlen wir mit Wasser- und Abwassergebühren.
Alles fließt?
Ja, alles mischt sich in der großen Energie-Wassersuppe.
(Warm-) Wasser sparen leicht gemacht
Mein Geschirrspüler hat ein ›Bio 50 Grad‹ Sparprogramm, da kommt alles sauber raus. Die höhere Stufe hab ich folglich nie benutzt. Und klar, er wird erst angeschmissen, wenn er geschickt gestapelt bis zum Anschlag voll ist. Bei uns beiden ist das circa alle drei bis vier Tage.
Der kleine Küchenboiler ist ein Vorratsgerät, das bedeutet, er hält automatisch ein paar Liter in seinem Reservoir heiß. Das ist folglich eine Art Standby. Die ersten Jahre in der Wohnung schaltete ich ihn nach Bedarf an- und aus, damit er nicht ständig Wasser warm hält, das vielleicht erst morgen gebraucht wird.
Wenn du ebenfalls solch einen älteren Dauerwarmhalter hast, der unbeachtet unter oder über irgendeinem Waschbecken vierundzwanzig Stunden am Tag seinen Vorrat heizt: Zwischendurch Ausmachen ist sehr effektiv. Mindestens nachts und bei längerer Abwesenheit.
Für wenige Stündchen könnte es nach geringer Wasserentnahme gegenteilig wirken, da die Isolation recht gut ist. Hat man aber soeben nahezu den kompletten Inhalt genutzt, lohnt es trotzdem, das Aufheizen zum nächsten Bedarf zu verschieben.
Wie sich mein Umgang mit dem Boilerchen später weiterentwickelte, ist dagegen vermutlich eher weniger für andere tauglich: Nachdem ein Geschirrspüler eingebaut wurde, nutzte ich in der Küche plötzlich arg selten warmes Wasser. Manchmal lief ich für kurzen Bedarf - zum Beispiel um ein selbstgemachtes Eis fürs Kind aus der Plastikform zu lösen – schnell ins Bad, statt den Boiler hochzufahren. Das wurde ungeplant Gewohnheit, inzwischen war der kleine Küchenboiler schon lange gar nicht mehr an. (Ich frage mich gerade, ob er wohl noch funktioniert?)
Mein Durchlauferhitzer im Bad hat kein Sparprogramm und ist vermutlich mein einzig nicht extra geregeltes Gerät. Aber immerhin läuft er nur bei Nachfrage und die findet sehr wohl bewusst statt: Die Mischhähne stehen standardmäßig auf kalt. Ob ich wirklich warmes Wasser brauche, kostet also jedes Mal den Gedanken des Umstellens. Danach stelle ich den Hahn automatisch wieder auf kalt. Diese klitzekleine Gewohnheit verhindert versehentliche Warmwassernutzung, wenn Kühles reichen würde.
Selbstverständlich lernte meine Tochter auf dem Schiff mit begrenztem Tankvorrat ebenso von klein auf, nie Wasser ungenutzt laufen zu lassen, egal bei welcher Temperatur. Zum Beispiel beim Einseifen der Hände und allen ähnlichen Zwischentätigkeiten ist der Hahn aus.
»Dreh beim Zähneputzen den Hahn zu«, bekamen wir früher fast alle zu hören.
Was für die meisten Kinder abstrakte Elternermahnung bleibt, gegen die man sich später gern auflehnt, war für meine Tochter am Peilglas des Tanks direkt sichtbar. Sie wusste, wenn der leer ist, gibt es nichts mehr.
Nicht jeder kann sich eine Schiffs- oder Wohnmobilreise erlauben, um Kindern den Verbrauch plastisch vor Augen zu führen. Im Kapitel ›Spiele und Challenges‹ habe ich deswegen alternative Ideen zur Sichtbarmachung notiert.
Tropfende Hähne füllen Fässer und bei Toiletten sollte man ebenfalls im Blick behalten, ob die Spülung noch gut schließt. So manche lässt fast unsichtbar ständig etwas Wasser laufen. Auch Leitungsverbindungen und Anschlüsse mutieren gerne zu Tropfstellen. Derart unbemerkte Verluste summieren sich übers Jahr gewaltig!
Wer sich keine moderne Sparspülung leisten kann, legt einen Backstein oder Ähnliches in den alten Toilettenkasten. Der verbleibende Wasserinhalt genügt völlig.
Feinere Siebe beziehungsweise Druckregler im Wasserhahn reduzieren die Wassermenge bei gleichem Druckeffekt. Auch ohne solche muss der Hahn selten komplett aufgedreht werden, oft spült weniger Druck die Hände (oder sonst was) genauso schnell ab.
Der wassersparende Duschkopf sollte inzwischen in allen Haushalten Standard sein. Falls nicht, ab in den Baumarkt: Es gibt genug günstige Modelle, die sich nach kürzester Zeit zurückverdienen. Darauf verzichten wäre sparen am falschen Ende. (Außer, man duscht nie.)
Dass die Badewanne wesentlich mehr Warmwasser schluckt als kurzes bis mittellanges Duschen, hat sich allgemein rumgesprochen, oder? Sofern man beim Einseifen und Shampoonieren das Wasser abstellt. Wobei das ausgerechnet bei mir nur bedingt zutrifft, da ich bloß eine kleine Sitzbadewanne habe und zum gedankenverlorenen Dauerduschen neige. Darum bade ich lieber.
In meiner Küchenspüle nutze ich keinen Stöpsel, sondern eine Waschschüssel. Die fängt überschüssiges vom Hahn, verringert den Bedarf beim Gemüsewaschen oder bewahrt noch taugliches Seifenwasser nach dem Abwasch. Geleert wird sie erst, wenn das Wasser dreckig wirkt. So steht da fast immer was drin zu kurzen Nebenzwecken, wie zum Beispiel grobes Vorspülen für längere Wartezeit im Geschirrspüler.
Auf meinem kleineren Boot Noortje habe ich (noch) keinen Wassertank. Im Ferienleben mit nur einem 10- plus einem 20-Liter-Kanister entwickelte ich extreme Spartechniken, die sind allerdings grenzwertig und absolut nicht für normale Haushalte geeignet. Ich beschreibe sie hier trotzdem, primär zum Schmunzeln. Außerdem, weil sie Wasserverbrauchsmengen sichtbar aufzeigen und eventuell Anregungen für den ›Kanister- und Kerzentag‹ im Kapitel ›Spiele und Challenges‹ liefern können. Zudem ist unvorhersagbar, welche der eigenen Gedankengänge bei Fremden zu völlig neuen Ideen führen. Auf die ich selbst nie gekommen wäre.
Ein Schiff ist üblicherweise umgeben von Wasser. Mit der Pütz – das ist ein Eimer mit Tau daran – geschöpft, kann dieses Hafen- oder Flusswasser kostbares Trinkwasser überall dort ersetzen, wo es nicht getrunken wird. An allererster Stelle: in der Toilettenspülung. Mein altmodischer Klokasten ist zum Befüllen oben zu öffnen, hinein passt etwas mehr als ein Eimer, das heißt über zehn Liter.
Aus Faulheit bezüglich Wasserschleppen lernte ich dabei grundsätzlich, wie variabel Toiletten das teure Nass verschleudern: Per Druck auf den großen Knopf rauscht alles auf einen Schlag durch, aber mit schnellstmöglicher Betätigung des Stopschalters reicht eine Kastenladung mindestens für drei bis maximal fünf Spülungen. Einmal oder fünfmal am Tag die Pütz über Bord werfen, aus dem Fluss hieven, quer durchs Boot buckeln und in den Kasten kippen, inklusive gelegentlicher Missgeschicke, die des Feudels bedürfen? Das ist ein großer Sparanreiz. Meine Tochter und ich wetteifern im Klostopknopfdrücken.
Diese gute Gewohnheit begleitet uns logischerweise mit in die Wohnung, denn ›sich nicht abschütteln lassen‹ haben Gewohnheiten so an sich. Dort bedeutet es, wir sparen (grob überschlagen) täglich circa vierzig Liter reinstes Trinkwasser. Mit nur einem Knopf. Kein Pappenstiel, oder?
Alternativ zur an Bord eingebauten, normalen Wassertoilette haben wir zudem ein Campingklo. Das kommt zum Einsatz, wenn jegliches Abwasser vermieden werden soll. Ohne Chemie, es ist im Grunde nicht mehr als ein hoher Eimer mit Brille und Deckel. Man kann es wahlweise pur, mit Tüte, mit Granulat oder mit abbaubarem Biomaterial nutzen. Ich bevorzuge Letzteres. Gut gegen Geruch wirkt beispielsweise Torf oder überall verkäufliche Kleintierstreu.
Da wir im Sommer bedenkenlos in der Weser schwimmen gehen, sehe ich keinen hygienischen Unterschied, das Weserwasser zeitweise zur groben Körper- und Handwäsche einzusetzen. Das reduziert Trinkwassergebrauch beim Händewaschen auf kurzes Nachspülen.
Geschirr bekommt ebenfalls grobe Vorwäsche im Eimer. Daraus entnommen, wird es Stück für Stück mit dem Schwamm eingeseift und in der (noch trockenen) Spülschüssel gestapelt. Anschließend spült ein dünner Strahl aus dem Trinkwasserkanister das Spülmittel ab, dabei füllt sich gleichzeitig die Spülschüssel. Hinterher ist sie meist ungefähr ⅓ voll, sofern die Seife noch Blasen bildet, also aktiv ist, bleibt diese Seifenlauge stehen für spätere Zwischenspülungen.
(Disclaimer für notorische Nörgler und FehlersucherInnen: Ich nutze dasselbe Spülmittel wie die Schiffe von Greenpeace, dennoch wird jede Art Ausleitung tunlichst vermieden. Und nicht alles, was ich hier beschreibe, ist aktuell oder findet überall statt. Es sind Ideenanreize aus verschiedenen Zeiten.)
Alternativ zum Flusswassereimer geschieht die Vorreinigung des Geschirrs manchmal mit Küchenpapier. Insbesondere bei hohem Fettanteil auf den Tellern, damit eine Spülschüsselfüllung für alles genügt. Das ist beim Camping oder in Notsituationen zwar praktisch, global gesehen jedoch nicht empfehlenswert, denn Papierherstellung hat hohen Wasser- sowie Energiebedarf.
Doch zurück von meinem Boot zu deinem Haushalt:
Bei aller gebotenen Wassersparsamkeit sollte man es trotzdem nicht übertreiben. Denn Leitungen müssen gespült werden, damit sich keine Ablagerungen und Keime ansammeln.
Insbesondere wenn man Leitungswasser trinken möchte, ist es völlig okay und sogar ratsam, den Hahn laufen zu lassen, bis es kühl wird. Die Temperaturänderung zeigt an, dass man kein in den Hausleitungen abgestandenes, sondern frisches Wasser ins Glas bekommt. (Wer dennoch nichts ungenutzt verlieren möchte, fängt den Anfang auf, für die Blumen. Oder wischt mit der Hand aus dem Strahl schöpfend grob das Waschbecken durch – mein Favorit, um seltener ›richtig‹ putzen zu müssen.)
Apropos Trinken: Wasser in Plastikflaschen rund um den Erdball zu verschiffen ist inzwischen allseits bekannter Irrsinn. Zumal Leitungswasser in Deutschland fast überall bessere Werte hat als die Mehrheit der käuflichen Mineralwasser.
Nur für Babynahrung gelten andere Regeln, dafür bitte unbedingt die empfohlenen niedrigen Natriumwerte prüfen. Und keinesfalls sollten alte Bleileitungen im Haus verlegt sein. Die sind zwar schon länger verboten, aber wer dem Vermieter nicht traut, kann sein Wasser bei Verbraucherzentralen, freien Laboren oder ähnlichen Institutionen testen lassen.
Du hast zufällig kein Baby und keine Bleileitung?
Dann gilt für dich: Leitungswasser ist das beste Trinkwasser. Es wird häufiger und strenger kontrolliert als jeder kommerzielle Hersteller und gewinnt regelmäßig sämtliche Vergleichstests bezüglich Reinheit sowie gesunder Zusammensetzung der Mineralien. Und on top: Es ist unschlagbar günstig.
Zum selbst Erzeugen von Sprudelwasser und Limonade daheim, statt Kisten schleppen, hat sich Soda Stream bewährt.
Aber bei der Anschaffung lauern Energiefallen:
Es gibt diese Sprudel-Geräte pur mit Druck aus der Druckflasche oder plus Strom. Davon ist die mechanische Variante ohne Stecker gewiss energiesparender. Ja, manche bestechen gar durch bunte Displays und blinkende Lämpchen. Sieht hypermodern aus. Aber brauchst du die wirklich?
Das Ergebnis ist identisch: Kohlensäure im Wasser.
Wäsche sparsam waschen
Meine Waschmaschine läuft grundsätzlich im Programm ›30 Grad pflegeleicht‹ plus die Taste ›Zeit sparen‹. Nach 56 Minuten ist meine Wäsche sauber, wozu also länger oder heißer?
(Bis auf extrem verschmutzte Ausnahmen, wie Arbeitsoveralls die im Maschinenraum getragen wurden. Denen gönne ich mit ›Vorwäsche‹ rund 20 Minuten extra. Damit sie nicht bis zum Schluss im gelösten Öl rumschwabbern.)
Zum Ausgleich fehlender Desinfektionshitze kommt Essig ins Weichspülfach, das zusätzlich entkalkt und die Wäsche weicher macht. Dazu gelegentlich einen Schuss Hygienespüler.
Die Schleuder der Waschmaschine steht hier auf 800 Umdrehungen. Dann tropft nichts mehr, der Stoff ist aber noch feucht genug, um nachher beim Aufhängen Falten glattzuziehen. (Und falls mir mal echte Wolle dazwischen rutscht, hat sie bei 30 Grad und niedriger Drehzahl jederzeit eine Überlebenschance.)
Die Mehrzahl moderner Gewebe lässt sich durch kurzes Stretching in alle Richtungen glätten! Wie es nass auf die Leine kommt, so trocknet und bleibt es – mit oder ohne Falten. Ich hab nur wenige Blusen, die Glattziehen verweigern, doch die gefallen mir im Knitterlock. Und den größten Blödsinn finde ich geplättete oder gemangelte Bettwäsche, denn die wird in der ersten Nacht sofort zerknüllt.
Zusammengefasst bleibt bei mir kein Teil zum Glätten übrig, das den Energieaufwand rechtfertigen würde:
Darum brauche ich nie bügeln.
Aber Achtung: Wer statt Wäscheständer einen Trockner nutzt, sollte (genau andersherum) die Schleuderkraft der Waschmaschine maximal nutzen, um Trocknerzeit zu kürzen. Denn der braucht noch viel, viel mehr Strom.
Ich habe keinen Wäschetrockner.
Ein Gerät für etwas, das von alleine ebenso passiert?