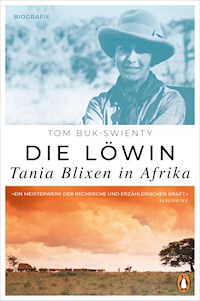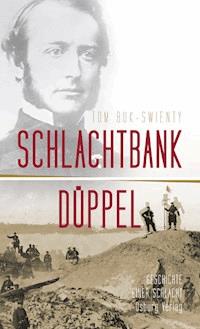
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Sachbuch über eine Schlacht zugleich ein literarisches Ereignis. Wie schafft man es in der heutigen Zeit, mit einem Buch über eine Schlacht den erfolgreichsten Non-Fiction-Titel des Jahres zu schreiben? Tom Buk-Swienty ist dies 2008 in Dänemark gelungen, indem er das Kriegsleiden eindringlich aus der Perspektive des einfachen Soldaten, der Offiziere, Feldärzte und Kriegskorrespondenten erzählt. Was so entstanden ist, ist ein mitreißender, dokumentarischer Bericht über die Schlacht, für die die Soldaten den "Kosenamen" "Schlachtbank" Düppel erfanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tom Buk-Swienty
Schlachtbank Düppel
Tom Buk-Swienty
SCHLACHTBANK DÜPPEL
18. April 1864Die Geschichte einer Schlacht
Aus dem Dänischenvon Ulrich Sonnenberg
Titel der dänischen Originalausgabe:
Slagtebænk Dybbøl
© Tom Buk-Swienty og Gyldendal 2008
Die Übersetzung wurde gefördert
vom Statens Kunstråds Litteraturudvalg.
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Osburg Verlag Berlin 2011
www.osburgverlag.de
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Herstellung: Prill Partners producing, Berlin
Umschlaggestaltung: Toreros, Lüneburg
Satz: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN Print: 978-3-940731-72-2 ISBN E-Book: 978-3-955101-01-5
Für meine Eltern, die mich gelehrt haben,dass man in diesem Lebenseine Schlachten schlagen muss.
Die Schlacht war von einer eigentümlichen Schönheit. Im Osten sah man, wie die Strahlen der Morgensonne ihren Glanz über die Anhöhe von Düppel warfen. Entlang des Sunds stiegen rechts gewaltige Rauchsäulen von den brennenden Hütten bei Ulkebøl Vestermark senkrecht in den Himmel. Auf der linken Seite sah man die Uferböschungen des Vemmingsbund eingehüllt in den Nebel der schneeweißen Explosionswolken, die unablässig von den Batterien auf Broager ausgespuckt wurden. Am Fuß des Hügels blitzte konstant ein Flammengürtel auf; der klare, blaue Himmel und das ruhige, dunkelblaue Meer rahmten dieses Bild von Flammen und Rauch ein, das einen grandiosen Anblick bot. Der Lärm war furchteinflößend, ohrenbetäubender, als ich es jemals gehört hatte.
Edward Dicey, britischer Kriegskorrespondent,Düppel, 18. April 1864
INHALTSVERZEICHNIS
Personengalerie
Vorwort
Einleitung: Der Veteran
Teil 1 Der Tag davor
1. Düppel, Sonntag, 17. April 1864
2. Der Ausgewählte
3. Der Schlachtplan
4. Schlachtbank Düppel
5. Das Panzerschiff
6. Der Kriegskorrespondent
7. Der kranke General
8. Der Gesandte des Roten Kreuzes
9. An der Front
10. Ein letzter Brief
11. Wachablösung
12. Die Verdammten
13. Der schlaflose Dichter
Teil 2 Der Weg nach Düppel
14. Die Handschuhe werden geworfen
15. Dänemarks Krieg
16. Nationalromantik
17. Der Eiserne Kanzler
18. Der tote König
19. Thyras Wall
20. Die ersten Tage
21. Der Leichenzug
22. Sankelmark
23. Der Sündenbock
Teil 3 Die Belagerung
24. Ströme vom Blut
25. Der Beschuss
26. Die letzte Woche
Teil 4 Die Entscheidung
27. Nacht
28. Die letzte Stunde
29. Der Augenblick
30. Die linke Flanke
31. Der Gegenstoß
32. Verbrannte Brücken
Teil 5 Das Feld der Ehre
33. Die Toten
34. Die Sterbenden
35. Die Gefangenen
36. Berlin
37. Das Geisterschiff
Epilog: Nachwirkungen
Danksagung
Ein Wort zu den Zitaten
Quellenmaterial und Archive
Literaturverzeichnis
PERSONENGALERIE
In diesem Bericht tritt eine Vielzahl von Personen auf. Vielen begegnen wir nur flüchtig – vielleicht nur in einer Passage, in der diese Person von einer Begebenheit des Krieges berichtet oder einen Augenzeugenbericht liefert. Andere lernen wir näher kennen, mit ihnen ziehen wir nach Düppel, in die Schlacht am 18. April 1864. Wir hören von ihren Gedanken und ihren Gefühlen, wir sehen mit ihren Augen und fühlen mit ihren Sinnen. Einigen Personen folgen wir durch das ganze Buch. Manchen bis in den Tod. Hier nun einige kurze biografische Skizzen der Männer, deren persönliche Geschichten ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichte sind:
OTTO VON BISMARCK, 49 JAHRE:
Preußischer Ministerpräsident, Außenminister und engster Ratgeber König Wilhelms I. Sein Interesse galt der Stärkung und Bewahrung der Königsmacht, der konservativen Kräfte und des Militärs. Den Krieg des Deutschen Bundes gegen Dänemark, dessen Ausbruch er befördert hatte, sah Bismarck als Mittel, um dieses Ziel zu erreichen.
J. BUBBE, ALTER UNBEKANNT:
Gemeiner preußischer Soldat des 24. Regiments. Teilnehmer der Sturmkolonne 5, die am 18. April die Schanze 5 angreifen sollte. Nahm außerdem an den Kämpfen bei Missunde am 2. Februar 1864 teil und wurde danach mit seinem Regiment am 17. März in das Dorf Düppel verlegt – in der Endphase der heftigen Kämpfe, die an diesem Tag dort stattfinden sollten.
C. BUNGE, ALTER UNBEKANNT:
Hauptmann des 11. preußischen Regiments und Teilnehmer der zweiten Angriffslinie am 18. April. Mit seinen Männern rückt er bis zur Schanze 2 vor, geht weiter bis zur zweiten Verteidigungslinie und stößt dort auf die dänische 8. Brigade. Teilnehmer im Kampf bei Missunde am 2. Februar und beim Angriff in der Nacht auf den 14. April 1864, bei dem das letzte Stück Niemandsland vor den Schanzen erobert wird.
EDWARD DICEY, 32 JAHRE:
Britischer Kriegskorrespondent des Daily Telegraph. Er sucht das Abenteuer, schrieb als Kriegskorrespondent über den amerikanischen Bürgerkrieg und zögert nicht, nach Dänemark zu reisen, um über den dänisch-deutschen Krieg 1864 zu berichten. Sympathisiert mit dem dänischen Heer. Wie alle Beteiligten in Düppel und auf der Insel Alsen ist er über die Gewalt an der Front erschüttert, seine Reportagen sind geprägt von dem alltäglichen Grauen, dessen Zeuge er wird.
WILHELM DINESEN, 18 JAHRE:
Dänischer Unterleutnant des 9. Regiments (und der 8. Brigade), einer der jüngsten Offiziere des dänischen Heeres. Teilnehmer des selbstmörderischen Gegenangriffs der 8. Brigade beim Sturm der Preußen auf die Schanzen am 18. April. Kommt am 14. April 1864 in Düppel an.
WILHELM GATHER, 26 JAHRE:
Gemeiner Soldat des 4. preußischen Garderegiments, 4. Kompanie. Am 16. April wird er der 6. Sturmkolonne zugeteilt, die am 18. April Schanze 5 stürmen soll. Geboren und aufgewachsen in der preußischen Rheinprovinz. Gather hasst den Krieg und das Soldatenleben und träumt nur davon, auf den elterlichen Hof zurückkehren zu können. Fürchtet ständig um sein Leben.
GEORG DANIEL GERLACH, 65 JAHRE:
Generaloberst der dänischen Armee, nachdem der ehemalige General de Meza entlassen wurde. Gerlach ist nicht an der Sitzung des Kriegsrats beteiligt, auf der beschlossen wird, die dänischen Truppen vom Dane werk abzuziehen. Weil er für den Rückzug nicht mitverantwortlich zu machen ist, wird er am 29. Februar 1864 zum Generaloberst ernannt. Gerlach ist kein starker Führer.
PETER VILHELM GROVE, 31 JAHRE:
Kriegskorrespondent des dänischen Dagbladet. Folgt dem dänischen Heer vom Danewerk nach Düppel, schreibt mitreißend und mit Einfühlungsvermögen. Dänemarks erster moderner Kriegskorrespondent.
PRINZ FRIEDRICH KARL VON PREUSSEN, 37 JAHRE:
Bei Ausbruch des Krieges Oberbefehlshaber des 1. preußischen Armeekorps und ab März Oberbefehlshaber der Truppen bei Düppel. Ein unentschlossener und wankelmütiger Anführer – allerdings wächst sein Mut ab Mitte April, als die dänischen Stellungen durch den preußischen Granatenbeschuss stark beschädigt sind. Der Stratege hinter dem Sturm auf die Düppeler Schanzen.
NIELS CHR. LARSEN, 30 JAHRE:
Landwehrmann und Infanterist des 22. dänischen Regiments. Er hat eine vielversprechende Zukunft als Müller in Hellum/Nordjütland vor sich; verheiratet mit Inger Marie, die beiden haben einen Sohn und eine neugeborene Tochter. Larsen kommt am 17. April 1864 in die Schanzen, wo er beim preußischen Angriff in der vordersten Linie liegt.
JOHAN PETER LARSSEN, 42 JAHRE:
Artilleriekanonier der 4. dänischen Verstärkungskompanie. Der älteste gemeine Soldat des Heeres. Kapitän eines Feuerschiffs, den die schwierige Lage der Dänen bei Düppel so aufwühlte, dass er sich im April 1864 freiwillig an die Front meldet.
CARL CHRISTIAN LUNDBYE, 51 JAHRE:
Dänemarks Kriegsminister. Ausgebildeter Artillerieoffizier und aktiv im Feld während des dreijährigen Krieges zwischen Dänemark und Deutschland 1848–1851. Als der Krieg 1864 ausbricht, erweist er sich als ein pedantischer und ruhmsüchtiger Schreibtischgeneral, dem das Verständnis für die tatsächlichen Verhältnisse an der Front fehlt und der sich in den falschen Momenten einmischt. Entlässt de Meza als Generaloberst, nachdem der die Truppen vom Danewerk abgezogen hat.
GENERAL CHRISTIAN JULIUS DE MEZA, 72 JAHRE:
Generaloberst bei Kriegsausbruch. Ein älterer exzentrischer, aber kompetenter und entschlossener Heerführer. Obwohl er weiß, dass diese Entscheidung in Kopenhagen auf Unverständnis stoßen wird, lässt er das dänische Heer vom Danewerk abziehen, da er fürchtet, dass es vom Feind überrannt wird.
DITLEV GOTHARD MONRAD, 52 JAHRE:
Dänemarks Konseilpräsident (Ministerpräsident). Nationalliberaler Politiker, Bischof und einer der führenden Köpfe bei der Ausarbeitung des dänischen Grundgesetzes von 1849. Bekannt für seinen außerordentlich großen Arbeitseinsatz, aber gleichzeitig bei Kriegsausbruch psychisch geschwächt. Er hat keinerlei Kenntnisse von den Verhältnissen an der Front bei Düppel und erwartet, dass das dänische Heer die Stellung hält.
RASMUS NELLEMANN, 34 JAHRE:
Korporal des 2. dänischen Regiments. Gutsverwalter bei Frijsenborg in der Nähe von Hammel bei Århus. Familienvater und nur notgedrungen Teilnehmer des Krieges, über dessen Schrecken er in seinen Briefen berichtet. Am 17. April wird er in die Laufgräben bei Schanze 2 verlegt, in denen er sich dann auch befindet, als der Sturm auf die Schanzen beginnt.
PETER HENRIK CLAUDE DU PLAT, 54 JAHRE:
General und Anführer der 2. Division des dänischen Heeres bei Düppel. Gentleman-Offizier: gut ausgebildet, gebildet, rechtschaffen, loyal und mutig. Am 16. April 1864 bietet er Generaloberst Gerlach an, die Verantwortung für einen Rückzug des dänischen Heers zu übernehmen. Gerlach lehnt ab.
ERNST SCHAU, 41 JAHRE:
Major und Offizier in General du Plats Stab. Bekannt als kompetenter Offizier. Hat heftige Vorahnungen, dass er den Krieg nicht überleben wird. Schreibt täglich einen Brief an seine geliebte Frau Friede. Hält sich in Düppel auf, als der Sturm auf die Schanzen losbricht.
CHARLES VAN DE VELDE, 46 JAHRE:
Entsandter des Roten Kreuzes, Beobachter des Krieges von 1864. Sein Kollege Louis Appia ist Beobachter auf der preußischen Seite der Front, während van de Velde sich bei den Dänen auf Alsen aufhält. Ein sensibler Mann und Hypochonder, dessen Nerven nur schwer ertragen, was er bei Düppel zu sehen bekommt.
Abb. 1: Die Düppeler Mühle, fotografiert am 19. April 1864.
VORWORT
Viele der Teilnehmer, die später die Schlacht an den Düppeler Schanzen am 18. April 1864 beschrieben, konnten sich ebenso genau an das Wetter erinnern wie an das Kampfgetümmel, die Granatexplosionen, die Verstümmelten, die Schreie, die Leichen, die blutverschmierten Verwundeten und die aufgerissene Erde. Sie erinnern sich verblüffend gut an den Duft des Frühjahrs. Ein gewaltiger Mond hatte in dieser milden und windstillen Nacht zum 18. April am Himmel gestanden. Und als die Sonne sich bei Tagesanbruch zeigte, geschah dies bei wolkenlosem Himmel über den geschwungenen Hügelkämmen, den sanften Buchten und dem glänzenden Meer von Düppel, Alsen und Sundeved, die man von beinahe jedem Punkt in der Landschaft aus sehen kann.
Die Soldaten hörten auch den Gesang der Lerchen, und das ist das Unglaublichste an ihren Erinnerungen. Die ganze Nacht über, bis weit in den Vormittag hinein, hatte der bis dahin intensivste Beschuss der Kriegsgeschichte stattgefunden. Achttausend Granaten explodierten zwischen den in Schanzen, Schützenlöchern und Laufgräben eingegrabenen dänischen Soldaten. Die Landschaft, die von den Dänen passenderweise Schlachtbank Düppel getauft worden war, bebte, der Lärm war infernalisch.
Dennoch gab es zahlreiche Soldaten, dänische wie deutsche, die später schworen, Lerchengesang gehört zu haben – trotz der Explosionen, trotz der unablässigen Gewehrsalven. Und vor allem hatten sie den Gesang in dem Moment gehört, als die Kanonen exakt um zehn Uhr vormittags schwiegen. In diesem Moment wurde die Hölle entfacht, der Sturm auf die dänischen Stellungen begann.
Vielleicht haben die Lerchen nur in den Köpfen der Soldaten gesungen, als Ausdruck ihrer noch immer vorhandenen Menschlichkeit, die sich nach Leben sehnte und die Gewalt derart destruktiver Kräfte nicht akzeptieren mochte. Vielleicht handelte es sich auch um eine Art von höherem göttlichem Gleichgewicht: Wo es zu Grausamkeiten kommt, gibt es auch eine entsprechende Schönheit. Nachdenklich stimmt in jedem Fall, dass auch viele Veteranen einer der größten und blutigsten Schlachten der Weltgeschichte – der Schlacht an der Somme am 1. Juli 1916 – berichteten, dass sie direkt vor dem Angriff die Vögel singen hörten oder sich daran erinnerten, wie ungewöhnlich schön das Wetter an diesem Tag gewesen war. Auch der 11. September 2001 war in New York ein so durchsichtig klarer und schöner Tag, dass man meinen könnte, Engel wären im Spiel gewesen.
Der 18. April 1864 war kein himmlischer Tag. Es war ein höllischer Tag. Für die deutsche Seite ist es sicherlich ein Tag des großen Triumphs gewesen, doch auch auf der Seite der Sieger hatte es Angst gegeben: das Adrenalin der Furcht, das Röcheln der Sterbenden, Verstümmelungen und überfüllte Lazarette.
Für die andere Seite war der Tag eine Menschenschlächterei, wie es sie in der dänischen Geschichte noch nie gegeben hatte. Niemals waren dänische Truppen in einen so rasenden – und hoffnungslosen – Kampf geschickt worden. Natürlich hatte es in der Geschichte des dänischen Königreichs große Schlachten gegeben. Die Schlacht an der Kopenhagener Reede am 2. April 1801 war aus dänischer Sicht ausgesprochen blutig und heftig gewesen. Die Schlacht bei Isted am 24. und 25. Juli 1850 gegen die schleswig-holsteinischen Aufständischen oder – je nach Standpunkt – Freiheitskämpfer war die bis dahin größte Schlacht in der Geschichte des Nordens. Doch am 18. April 1864 kämpfte man gegen einen Gegner, dem an den meisten Frontabschnitten viermal so viele Soldaten zur Verfügung standen. An Intensität und Verlusten pro Einheit gibt es aus dänischer Sicht nichts, was sich mit dem 18. April 1864 messen kann. Ganze Kompanien wurden ausgelöscht, ganze Regimenter aufgelöst.
Drei Brigaden waren todgeweiht, als sie am Abend des 17. April ihre Positionen im Niemandsland von Düppel bezogen, und gut die Hälfte der insgesamt 12000 dänischen Soldaten, die sich in der eigentlichen Kampfzone befanden (weitere 15000 lagen auf der Insel Alsen als Reserve), kam am 18. April nicht zurück nach Alsen. Sie standen annähernd 40000 Angreifern gegenüber.
Der 18. April hat eine große historische Bedeutung, nicht nur, weil es ein makabrer Tag war, der Tausende von Familien in Trauer stürzte. Für Dänemark bedeutete dieser Tag den Anfang vom Ende des dänischen Gesamtstaats – der Tag wurde zum Inbegriff des Niederlagenkomplexes, der bis heute den nationalen Charakter Dänemarks beeinflusst. Man mag diskutieren, ob Dänemark, das 2003 mit großem Getöse in den Irak-Krieg zog, nicht allmählich den Schatten von 1864 hinter sich gelassen hat. Aber es ist unbestritten, dass sich Dänemark kurz nach dem 18. April in einen Kleinstaat verwandelt sah – in eine Mikroeinheit, die auf der europäischen Bühne machtpolitisch ohne Bedeutung war.
Das Gegenteil geschah in Deutschland – das heißt, Deutschland im heutigen Sinn gab es 1864 noch nicht, sondern lediglich einen lockeren Verbund von neununddreißig kleinen und größeren Staaten, in dem Preußen mit Österreich um den größten Einfluss kämpfte. König Wilhelm I. und vor allem der preußische Ministerpräsident und spätere Kanzler Otto von Bismarck träumten von einem vereinten deutschen Reich unter der Führung Berlins. Es waren gewagte Ambitionen, denn in Preußen gab es einflussreiche Kräfte von demokratischer Gesinnung, die einem Krieg skeptisch gegenüberstanden. 1864 war Preußen geprägt von seinem eigenen Niederlagenkomplex aus den Napoleonischen Kriegen. Napoleons nachhaltige Siege bei Jena und Auerstedt 1806 hatten das Selbstvertrauen der preußischen Militärs erschüttert und Selbstzweifel gesät, obwohl das preußische Heer an den Siegen über Napoleon bei Leipzig 1813 und Waterloo 1815 beteiligt gewesen war.
Auf preußischer Seite war man sich 1864 keineswegs so sicher, Dänemark besiegen zu können, wie es in der historischen Rückschau gewöhnlich dargestellt wird. Als der Krieg ausbrach, war Dänemark kein Kleinstaat – und die Dänen galten in weiten deutschen Kreisen als widerborstige Unterdrücker der deutschen Freiheit in den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Viele Deutsche sprachen mit ebenso viel Verachtung wie Furcht über ›Das Dänenthum‹, das heißt, die Unterdrückung von Deutschen durch die Dänen. Rein militärstrategisch wurden die dänischen Verteidigungsanlagen – zunächst das Danewerk, später die Düppeler Schanzen – als mächtige Bastionen angesehen. Zumal die militärische Bewegungsfreiheit der Preußen durch die erhebliche Überlegenheit der Dänen zur See behindert wurde. Ministerpräsident Bismarck, König Wilhelm I. und die Generäle waren der Ansicht, dass es eine nationale und militärische Katastrophe wäre, wenn die entscheidende Schlacht bei Düppel nicht gewonnen würde. Sollte es nicht gelingen, könnten sich ihre Pläne von Preußen als dominierender Macht im Deutschen Bund – und in Europa – leicht in Luft auflösen.
So gesehen stand für die Gegner der Dänen alles auf dem Spiel. Als der Sieg bei Düppel nach einer langen und verlustreichen Belagerung endlich errungen wurde, löste er in Berlin eine Welle der Erleichterung und Euphorie aus – und stärkte die konservativen und militärischen Kräfte, während die demokratisch-liberale Bewegung an Boden verlor. Ohne den 18. April ist es keineswegs sicher, ob Bismarck die siegreichen Kriege gegen Österreich 1866 und Frankreich 1870–71 geführt hätte, die Deutschland schließlich vereinten. Kriege, die eine neue und bis 1914 im Übrigen relativ friedliche Weltordnung schufen. Eine Ordnung, in der Deutschland ein machtpolitisches Schwergewicht in Europa bildete.
Der 18. April 1864 änderte die europäische Geschichte – mit einem Schlag.
Der Autor dieses Buches ist in Sønderborg in der Nähe von Düppel aufgewachsen. Als Junge habe ich zwischen den zahlreichen Gedenksteinen für die gefallenen Soldaten gespielt, die an der berühmten Mühle über die alte Front verstreut stehen. Und häufig habe ich – auch wenn ich als Erwachsener zurückkam – gedacht: Wer waren diese Männer? Was haben sie wirklich in diesen Apriltagen 1864 erlebt? Was heißt es, sich mitten auf einem Schlachtfeld zu befinden – noch dazu einem Schlachtfeld, das unsere Geschichte so nachhaltig verändert hat?
In den vergangenen einhundert Jahren wurden unzählige Beschreibungen des Krieges veröffentlicht. Nach dem Jubiläumsjahr 1964 schien es allerdings, als hätten die Chronisten genug, sie schwiegen. Abgesehen von Spezialwerken und einigen Büchern, die einen allgemeinen Überblick über den gesamten Kriegsverlauf geben, gibt es für den heutigen Leser kaum Texte, die sich direkt mit der eigentlich entscheidenden Schlacht bei Düppel und ihrer Geschichte beschäftigten. Dass dieser Tag seine Chronisten nicht gefunden hat, ist besonders bemerkenswert, da eine unglaubliche Anzahl von Schilderungen aus erster Hand vorliegt. In den Archiven gibt es Tausende von Briefen und Tagebuchaufzeichnungen aus dem Krieg. Dieses Buch ist dokumentarisch. Alle Zitate und Beschreibungen basieren auf dänischen und deutschen Briefen, Tagebüchern, Erinnerungen und zeitgenössischen Fotografien von der Front – Material, das uns in die damalige Zeit zurückführt und uns mitnimmt ins Kampfgetümmel.
Der 18. April 1864 nagt an unserem kollektiven Unterbewusstsein. 2006 wurde das Datum vom offiziellen Dänemark sogar als ›epochal‹ kanonisiert. Allerdings ohne dass allzu viele Menschen wussten, was sich an diesem Tag im April an den Düppeler Schanzen tatsächlich abgespielt hatte.
Von diesem Tag – und von denen, die ihn erlebten – handelt dieses Buch.
Abb. 2: Schlachtszene aus dem Stummfilm En rekrut fra 64 (»Ein Rekrut des Jahres 64«). Regie: Urban Gad, 1910.
EINLEITUNG: DER VETERAN
Als das Dampfschiff Kegnæs passiert, einen halbinselartigen Vorsprung der Insel Alsen, blickt der berühmte dänische Dichter und Autor Holger Drachmann über den Horizont und sieht in der Ferne die Düppeler Höhe, die, wie er meint, »einem gestrandeten Riesen-Wal ähnlich sieht, der dort liegt und mit dem Tode ringt«.
Es ist der späte Nachmittag des 18. April 1877. Drachmann ist auf dem Weg nach Sønderborg und Düppel, um sich mit eigenen Augen das Schlachtfeld anzusehen, auf dem das dänische Heer dreizehn Jahre zuvor ums Überleben gekämpft hat. Für Drachmann und seine dänischen Zeitgenossen haben ›Düppel‹ und ›18. April‹ einen schicksalsträchtigen Klang. Einen Klang nach Tod und Schmerz.
Als er kurz nach seiner Ankunft in Sønderborg in dem alten Schanzengelände umherwandert, begleitet ihn ein einheimischer dänischer Kriegsveteran als Führer. Der ehemalige Soldat hatte sich während des Granatenbeschusses in den Apriltagen 1864 in der dänischen Stellung aufgehalten und auch den Beginn der Erstürmung erlebt. Am 17. April war er mit seinem Regiment in eine Schanze an die lädierte linke Flanke verlegt worden, wo er bis zum 18. April bleiben musste.
»Und wie haben Sie sich damals gefühlt?«, möchte Drachmann wissen. Der Soldat ist journalistische Fragen offensichtlich nicht gewohnt, und schon gar keine Fragen, bei denen es um Gefühle geht.
»Sie fragen so seltsam!«, antwortet er. Und doch löst die Frage eine ganze Reihe an Erinnerungen an diese Stunden und Tage aus, an denen er gerade nichts gefühlt hatte. Erst zögernd, dann in einem Redestrom, erzählt der Veteran von den Stunden bis zum Angriff, in denen die preußischen Kanonen unablässig die dänischen Stellungen beschossen.
»Wir waren jetzt so taub, und wir sahen aus, als hätten wir in einem Misthaufen gelegen – was ja auch der Fall war. Nachts hörten wir, wie die Preußen gruben und in der Erde wühlten, nur ein paar hundert Schritte vor unserer Brustwehr. Am Tag zuvor hatten sie unsere Schützengräben eingenommen, und wir hatten sie nicht verjagen können. Sie rückten uns direkt auf den Leib, das wussten wir. Und wir wussten auch, dass es nun bald losgehen würde. Das war auch gut so, denn wir hielten es nicht mehr aus. Wir saßen, lagen oder trödelten herum und waren so dreckig wie die Kehrichtfahrer. Niemand hätte uns für dänische Soldaten gehalten. Mir selbst war warme Gehirnmasse ins Gesicht gespritzt, als beim letzten Schuss meinem Nebenmann der Kopf weggerissen wurde … Wir feuerten nachts mit unseren letzten Granaten ein paar Schuss in die Schützengräben, dorthin, wo wir die Preußen vermuteten … Wir glaubten, nun kämen sie, und ich kann mich erinnern, wie meine Finger juckten. Aber sie kamen noch nicht. Sie deckten uns nur mit ihren Granaten ein. Bis der Tag graute, das war das Furchtbarste, was wir je erlebt hatten. Sie machen sich keinen Begriff davon, was sie auf uns herabregnen ließen. Und ich kann Ihnen das wirklich nicht erklären, weil Sie es einfach nicht verstehen können.«
Der Veteran macht eine Pause, als würde er nach Worten suchen. Dann fährt er fort: »Es war, als würde sich ein Schleifstein in meinem Kopf drehen, und er dreht sich immer noch, wenn ich daran denke.«
Drachmann und der Veteran schweigen eine Weile, der Satz bleibt in der Luft hängen.
Drachmann bricht das Schweigen. Zusammen blicken sie über die Landschaft. Die Sonne geht allmählich unter, und lange Schatten legen sich über das Land: »Und was haben Sie empfunden, als die Deutschen angriffen?«
Wieder sieht der alte Soldat Drachmann verblüfft an. »Das weiß ich nicht …«
Aber wieder ist es laut Drachmann offensichtlich, dass innere Bilder in dem Veteranen aufsteigen. Und plötzlich spricht er, als müssten diese Erlebnisse einfach heraus: »Sie kamen in langen Reihen vor uns aus dem Boden, sprangen ebenso schnell auf, duckten sich und stürmten los; die Vordersten mit gefällten Gewehren, die anderen hielten sie vor der Brust … Wir schossen ihnen mit unseren Gewehren ins Gesicht, und dann waren sie unter uns.«
Der Veteran hält in seiner Erzählung inne, holt tief Luft und fährt fort: »Wir schlugen sie nieder, aber sie standen wieder auf. Sie kämpften hart und es waren so entsetzlich viele. Ich weiß, dass ich ihnen direkt ins Gesicht gesehen habe, und doch erinnere ich mich nicht an ein einziges Gesicht wirklich. Sie knirschten mit den Zähnen und brüllten, und wir haben vermutlich dasselbe getan. Aber, und das würde ich beschwören: Wir waren nicht betrunken. Aber vielleicht verhalten sich bei so einer Gelegenheit alle wie Betrunkene. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Denn das Ganze ist wie ein Brei. Wir kämpften auf der Brustwehr und unten in der Schanze. Solange wir noch Gewehre hatten, benutzten wir sie wie richtige Soldaten. Ich behielt meins, aber ich sah andere neben mir, die mit geballter Faust zuschlugen oder sich gegenseitig in die Kehlen bissen. Ein großer hübscher preußischer Kerl sprang mit seinen Stiefeln auf die Brust eines unserer Männer und zertrampelte sein Gesicht. Ich jagte ihm mein Bajonett in den Bauch, er fiel auf mich, und ich musste mich mit einem Stiefeltritt befreien. Tritt um Tritt, aber im Grunde mag ich nicht daran denken … So war das, bis einer mir mit einem richtig dicken Knüppel einen ordentlichen Hieb auf den linken Arm verpasste … das Blut rann mir über die Finger … Um mich herum wurde geschossen, geschrien und in Hörner geblasen, aber das weckte mich auch nicht auf. Ich war in einem totalen Dämmerzustand.«
Abb. 3: Eingegrabene deutsche Batterie vor den Düppeler Schanzen.
TEIL 1DER TAG DAVOR
… er stand ganz ruhig da und redete mit mir,
und plötzlich kam eine Granate und der Kopf war weg.
Ein unheimlicher Anblick, aber mit so etwas
müssen Soldaten sich abfinden.
Korporal Rasmus Nellemann in einem Briefan seinen Bruder, 17. April 1864
Abb. 4: Karte der Stellungen von Düppel. Auf der linken Seite preußische Laufgräben, davor dänische Schanzreihen.
1. Düppel, Sonntag, 17. April 1864
Wenige hundert Meter Niemandsland, an einigen Stellen maximal hundertfünfzig Meter. Mehr trennte die beiden Heere nicht, die sich einander gegenüber eingegraben hatten. Das dänische Heer sah sich in die Defensive gedrängt. Es verschanzte sich hinter einer Festungslinie aus großen Erdwällen, Schützenlöchern und Laufgräben, in Pulvermagazinen und Granattrichtern – wo immer man Deckung vor den gegnerischen Granaten finden konnte. Das andere Heer, des preußische, hatte sich in einem gigantischen Netz von Schützengräben – sogenannten Parallelen – systematisch an die Schanzen herangegraben. Mehr als einhundert Belagerungskanonen hatten die Preußen in das Gebiet geschafft, um den Feind zu destabilisieren und ihn dann in einem groß angelegten Sturmangriff zu besiegen.
Keine der beiden Parteien war sich am 17. April 1864 bewusst, welche Pläne das jeweils andere Heer hatte. Die Dänen erwarteten einen Angriff, nur wann würde er kommen? Die Deutschen ließen große Truppenverbände aufmarschieren. Am kommenden Tag wollten die Preußen die dänischen Stellungen überrennen, allerdings wussten sie nicht, ob der Feind die Stellungen halten und den Angriff parieren würde. Käme es zu einem plötzlichen Rückzug beziehungsweise vielleicht sogar zu einem Ausfall? Wir hingegen können in den historischen Rückspiegel blicken und wissen, dass an diesem Tag eine Entwicklung angestoßen wurde, die sich nicht mehr aufhalten ließ.
Abb. 5: Ein preußischer Leutnant des 4. Regiments, 4. Kompanie. Wilhelm Gather gehörte diesem Regiment an, das die Schanze 6 erstürmen sollte.
Am 20. April 1864 sollte in London eine internationale Friedenskonferenz stattfinden. Bis dahin wollten die kämpfenden Parteien die bestmöglichen Verhandlungspositionen erreichen. In Berlin wurde offen von der Notwendigkeit eines großen Sieges gesprochen, um in den Verhandlungen entsprechend offensiv auftreten zu können; und die Politiker in Kopenhagen forderten die Heeresleitung auf, einem feindlichen Angriff standzuhalten, egal, ob es, wie man es den Generälen gegenüber ausdrückte, zu »bedeutenden Verlusten« kommen würde.
2. Der Ausgewählte
»Und sollte es nun morgen oder früher oder später losgehen, soll ich dann untergehen?«, fragte sich der sechsundzwanzigjährige preußische Soldat Wilhelm Gather. Es war ein kalter, aber klarer und sonniger Aprilmorgen, an dem Gather mit seiner Kompanie den Gottesdienst unter freiem Himmel besuchte. Während die Soldaten mit gebeugten Köpfen das Sakrament empfingen, kreisten Gathers Gedanken weiterhin um den Tod. »Für manch einen von uns wird bald die Stunde des Abschieds von dieser Welt geschlagen haben, und wer weiß, vielleicht auch für mich?«, überlegte er.
In der Ferne dröhnte anhaltender Kanonendonner. Wilhelm Gather, der der 4. Kompanie des 4. Regiments angehörte, lag im Dorf Nybøl, nur wenige Kilometer westlich der dänischen Festungsanlagen bei Düppel. Gather und seine Kameraden waren in einem Lager bei Varnæs in der Nähe von Åbenrå stationiert gewesen, weit entfernt von der Düppeler Front. Am 16. April hatten sie plötzlich den Befehl erhalten, die zwanzig Kilometer bis Nybøl zu marschieren, dort hatte man sie nun einquartiert. Den Soldaten war bewusst, dass der Marschbefehl nach Nybøl einen unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die dänischen Stellungen bedeutete.
Vor einer Woche hatte die Heeresleitung entschieden, Gathers Kompanie in der ersten Angriffswelle einzusetzen. Einzelne Kompanien wurden ausgewählt, als Sturmtruppen zu fungieren: Diese Truppen sollten die Dänen überwältigen und einem eventuellen Gegenangriff standhalten, bis die preußischen Reservetruppen eingesetzt wurden. Dass die ausgewählten Kompanien große Verluste erleiden würden, war allen Beteiligten klar.
Gather hatte Angst, seit er am 13. April erfahren hatte, unter den Ausgewählten zu sein. In einem Brief an seine Eltern schrieb er an diesem Tag, »ein eigentümliches Gefühl herrscht schon in uns, das Bewusstsein zu haben, die Ersten zu sein«. Und einige Tage später heißt es: »Wenn der einzige Trost, die Hoffnung, nicht wäre, dass die Sache nicht so ganz schlimm ausfallen möge, oder der Gedanke, dass von der schlimmsten Todes-Ernte auch immer noch einige übrig bleiben und unter diesen Glücklichen zu sein, dann würde uns der Mut sinken.«
Als er von seinem Befehl erfuhr, war sein erster Gedanke: »Heute und morgen stürmen wir noch nicht und hoffen und hoffen noch immer auf ein womögliches Verlassen der Schanzen [durch die Dänen] oder auf eine glückliche [internationale Friedens-]Konferenz.«
Es handelte sich um Wunschdenken, und er wusste es. Stattdessen setzte Wilhelm Gather seine ganze Hoffnung darauf, während des Angriffs als Schütze eingesetzt zu werden. Zumindest, so schrieb er seinen Eltern, könnte man als Schütze Deckung suchen und müsste nicht in engen Reihen vorrücken und auf die gefürchteten Kartätschen warten, die mit Eisensplittern und Kugeln gefüllten Granaten.
Und mit einem weiteren Gedanken versuchte er sich in seinem Brief an die Eltern zu beruhigen: Auch bei den blutigsten Verlusten standen einige der anstürmenden Soldaten doch immer wieder auf. Stets gab es Überlebende. Er könnte doch ebenso gut einer von ihnen sein.
Gather war ein gut ausgebildeter Soldat, der wie die meisten Männer in Preußen eine dreijährige Wehrpflicht absolviert hatte. Seine Dienstzeit endete eigentlich im Jahr 1862, doch als sich der Krieg mit Dänemark abzeichnete, wurde er erneut einberufen und musste 1863 die Uniform wieder anziehen. Als Krieger fühlte er sich trotz seines ganzen Waffentrainings indes nicht. Im Gegenteil. Er hasste den Krieg und hatte es vom ersten Tag an getan, zumal er die Strapazen und Gefahren im Feld nicht ertragen wollte. Am liebsten hätte er ein friedliches Leben als Landwirt geführt. Er liebte seine Heimat und den Hof seiner Eltern. Sie waren Bauern und betrieben eine Gastwirtschaft in Hohenbudberg in der preußischen Rheinprovinz, im westlichen Teil des Deutschen Bundes – weit entfernt von Berlin, direkt am Rhein. ›Vater Rhein‹ nennt ihn Gather in seinen Briefen.
Bisher hatte Wilhelm Gather Glück gehabt und konnte seinem Schöpfer dankbar sein, als er sich am 17. April mit seinen Kameraden zum Feldgottesdienst einfand. Noch hatte er an keiner Schlacht teilnehmen müssen, obwohl der Krieg bereits am 1. Februar ausgebrochen war. Das 3. Armeekorps, zu dem sein Regiment gehörte, war im Gegensatz zu anderen Einheiten, die die Preußen und ihre Verbündeten, die Österreicher, ins Feld geschickt hatten, bisher von größeren Auseinandersetzungen verschont geblieben. Aber sonderlich erfreulich waren die Monate, die der Feldzug gegen Dänemark nun dauerte, Gathers Meinung nach dennoch nicht gewesen.
Die Tage, an denen sie vor dem Danewerk – der großen dänischen Verteidigungsanlage nördlich der Eider – gelegen hatten, waren eisig kalt gewesen. Das Danewerk einzunehmen hätte zu viele Menschenleben gekostet. Doch als sie am 5. Februar den Befehl bekamen, über die Schlei zu rudern, um die dänische Stellung von der Flanke her anzugreifen, lagen Gathers Nerven blank. In den Tagen davor war entlang der langen Frontlinie unablässiger Kanonendonner zu hören gewesen, und die ersten Scharmützel zwischen Dänen und Deutschen hatten bereits stattgefunden – man sprach mit Ehrfurcht und Schrecken über die Toten und Verletzten, die es auf beiden Seiten gegeben hatte. Zu Gathers großer Erleichterung kam es zu keinem Angriff auf das Danewerk, denn unversehens räumten die Dänen die Stellung.
In den folgenden Wochen lag Gather in Jütland, zuerst südlich des Flusses Kongeå, später vor der dänischen Festung bei Fredericia, die von preußischen und österreichischen Truppen belagert wurde und im März einige Tage unter schwerem Artilleriebeschuss stand.
Wilhelm Gather erhielt seine Feuertaufe in einem kleinen Gefecht vor Kolding, in dem er miterlebte, wie ein deutscher Soldat mit einer Schussverletzung in der Brust davongetragen wurde. Doch auch diesmal kam Gather unbeschadet davon. Dies änderte sich erst, als sein Regiment Ende März südlich der Düppeler Schanzen verlegt wurde, um an der Belagerung der dänischen Stellungen teilzunehmen. Nun wurde er häufig in den preußischen Laufgräben vor den dänischen Positionen eingesetzt: Immer dichter grub sich das preußische Heer an die Dänen heran, und Wilhelm Gathers Uniform war in den feuchten Gräben ständig durchnässt, er fror. Dazu kam die miserable Verpflegung der preußischen Soldaten. In den Briefen an seine Eltern berichtete er von kleinen Portionen, die bisweilen nicht einmal Tabak enthielten, wie er verärgert hinzufügte. Der Sold sei lächerlich gering und die Dinge, die sie in den dänischen Dörfern Nordschleswigs oder bei den Marketendern kaufen konnten, die dem Heer folgten, waren laut Wilhelm Gather noch lächerlicher. Am schlimmsten allerdings wäre, so betonte er in seinen Briefen, dass es in Dänemark weder ordentliches Bier noch anständigen Branntwein gebe.
Einen Schreck fürs Leben bekam Gather Anfang April, als die Preußen sich darauf vorbereiteten, die Insel Alsen anzugreifen. Ursprünglich hatte die Heeresleitung geplant, massive Truppeneinheiten in Hunderten von Ruderbooten über das breiteste Stück des Sunds nach Alsen zu transportieren. Der Gedanke, ungeschützt in einem Ruderboot zu sitzen, während der Feind mit Kanonen schoss, jagte Gather und den übrigen deutschen Soldaten einen gehörigen Schrecken ein. Zumal jeden Moment große Kriegsschiffe auf dem Sund auftauchen konnten. Die meisten Soldaten konnten nicht schwimmen und beobachteten daher jeden Tag ängstlich die dänischen Kriegsschiffe, die auf dem Sund kreuzten. In den Briefen an seine Eltern gab Wilhelm Gather seine Angst unverhohlen zu. Groß war daher die Erleichterung – bei ihm wie bei allen anderen Infanteristen –, als er erfuhr, dass der Angriff wegen der schlechten Wetterverhältnisse abgeblasen werden musste.
Doch von der Teilnahme an einer großen Schlacht würde er nicht länger verschont werden, das war Wilhelm Gather an diesem 17. April klar. Überall um ihn herum gab es Anzeichen, die auf einen baldigen Angriff hindeuteten. Die nahe liegenden Dörfer, die Namen wie Vester Sottrup, Avnbøl, Smøl, Stenderup, Skodsbøl und Bøffelkobbel trugen, füllten sich mit Uniformierten. In allen Höfen und Ställen waren Soldaten einquartiert. Überall wurden Barackenlager errichtet, darunter ein besonders großes Lager im Wald von Bøffelkobbel nahe Nybøl; dort stellten auch die Marketender ihre Buden und Handelszelte auf. Zwischen den Bäumen und auf den Lichtungen lagerten Soldaten in kleinen Gruppen, überall gab es Pferde, Wagen, Karren, Zaumzeug, in Pyramiden zusammengestellte Gewehre, Lagerfeuer und galoppierende Ordonnanzen.
Wilhelm Gather gehörte zu den elftausend Soldaten, die man für die erste Angriffswelle ausgewählt hatte. Bei diesen Truppen handelte es sich allerdings lediglich um einen kleinen Teil des gesamten preußischen Aufmarschs. Weitere dreißigtausend Mann wurden als Reserve vorgehalten. Dazu kamen mobile Feldbatterien und Reitereinheiten, die ebenfalls bei Düppel zusammengezogen wurden.
Als ein weiteres Anzeichen für den unmittelbar bevorstehenden Angriff galten die langen Reihen von Ambulanzwagen und Karren mit Heu für die Verwundeten, die an der Chaussee standen. Außerdem wurden die Truppen mit einer doppelten Ration Fleisch verwöhnt. Die Soldaten wussten genau, warum. Mit ihrem Sinn für Galgenhumor bezeichneten sie die größeren Portionen als ›Henkersmahlzeit‹.
Und es wurden besonders viele Gottesdienste abgehalten, darunter der, an dem Gather teilnahm. Doch trotz all dieser Hinweise auf den bevorstehenden Angriff hielt der Generalstab die Information über den genauen Zeitpunkt der Schlacht noch immer zurück. Würden sie bereits in der kommenden Nacht angreifen? Am nächsten Morgen? Oder erst in zwei Tagen? Wie lang würde Gather noch leben? Er wusste es nicht.
Nach dem Gottesdienst ging er zurück in sein Quartier, einen Kuhstall in Nybøl, in dem seine Kompanie einquartiert war. Er legte sich auf den Bauch, griff zum Briefpapier, »der Tornister dient als Schreibpult«, wie er mitteilte, und schrieb: »Haben wir diese Tage überstanden, dann wollen wir zuerst Gott danken und jeder von uns wird dann bald in die Heimat zurückgekehrt sein. Schöne Gedanken, und möge der liebe Gott unsere Wünsche in Erfüllung gehen lassen.«
3. Der Schlachtplan
Ein großer schlanker Mann mit hohen Schläfen und einem gepflegten Bart, der sich um sein Kinn zog, traf um genau zwölf Uhr mittags am Hvilhøj Kro in der Nähe von Nybøl ein. Bereits anwesend waren die preußischen Generäle Canstein, Raven, Schmidt und Goeben, darüber hinaus die Kommandeure der Angriffstruppen, der Artillerie und der Pioniereinheiten. Ergeben begrüßten sie den Mann mit der ranken Figur, der aufgrund seiner Kleidung, die er auch an diesem Tag trug, kaum zu verwechseln gewesen sein dürfte: eine rote Husarenuniform mit weißen Schnüren, weißen Schulterriemen, weißem Gürtel und langen schwarzen Stiefeln mit schimmernden Sporen. Es handelte sich um den sechsunddreißig Jahre alten Prinzen Friedrich Karl von Preußen, bekannt als ›Der Rote Prinz‹. Den Beinamen hatte er bekommen, weil er stets eine rote Husarenuniform trug. Er war der Oberbefehlshaber des preußischen Heeres und hatte diese Unterredung einberufen. Er kam direkt zur Sache.
Abb. 6: Prinz Friedrich Karl von Preußen, preußischer Oberbefehlshaber bei Düppel.
»Morgen, meine Herren, erhalten Sie die Ehre«, sagte er, »die Schanzen einzunehmen, Seine Königliche Hoheit der König hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass er im Geiste mit uns ist und für uns beten wird.«
Während des Feldzugs gegen Dänemark hatte sich der Prinz mehrfach unsicher und nervös gezeigt. An diesem Tag jedoch wirkte er gelassen und selbstsicher. Am 18. April sollte die Entscheidung fallen. Der Zeitpunkt schien richtig gewählt zu sein.
»Ich wurde«, erklärte der Prinz später, »während des Feldzugs gehärtet.«
Der Rote Prinz war bei weitem nicht das erste Mal im Feld. Nach einem zweijährigen Universitätsstudium in Bonn hatte man den blutjungen Prinzen während des preußischen Feldzugs gegen Dänemark im Deutsch-Dänischen Krieg 1848 dem Militärstab von General von Wrangel zugeteilt. Der zwanzigjährige Prinz im Rang eines Majors hatte einige Monate als Adjutant gedient und bei der Schlacht von Schleswig ein so gutes Urteilsvermögen bewiesen, dass ihm die Tapferkeitsmedaille verliehen wurde. Darüber hinaus hatte er an der Niederschlagung der Badischen Revolution durch die Preußen teilgenommen und dabei eine Verwundung erlitten. Er galt als mutiger junger Mann mit einer gehörigen Portion Todesverachtung, die ihn zum Vorbild der Soldaten werden ließ; und die Treue, die seine Männer ihm erwiesen, wurde verstärkt durch die Aufmerksamkeit und Fürsorge, die er ihnen entgegenbrachte: Friedrich Karl verkörperte das Ideal des preußischen Offiziers, der seine Soldaten als seine eigenen Kinder betrachtete. Das hieß nicht, dass es nicht zu Züchtigungen kam – Züchtigungen galten als gängige Praxis im preußischen Heer, diese Art der Bestrafung wurde als notwendiger Bestandteil des Erziehungskonzepts insgesamt angesehen. Gleichzeitig hatte sich der ideale Offizier aber in allen Belangen um seine Männer zu kümmern.
1856 wurde Friedrich Karl zum Generalleutnant ernannt und 1860 zum Kommandeur des 3. Brandenburgischen Armeekorps befördert. Während des Feldzugs gegen Dänemark stand er zunächst an der Spitze des 1. Armeekorps, im Laufe des März 1864 wurde er jedoch zum eigentlichen Kommandeur der gesammelten preußischen Kräfte vor Düppel.
Die Anteilnahme des Prinzen am Schicksal der gemeinen Soldaten ging bisweilen so weit, dass einige seiner älteren Generäle ihn für rückgratlos und wankelmütig hielten. Tatsächlich erwiesen sich beide Vorwürfe als durchaus zutreffend – und er selbst war der Erste, der es zugab. Friedrich Karl litt, wenn die Soldaten unnötig allzu großen Gefahren ausgesetzt waren. In den Nächten, in denen die dänischen Batterien den preußischen Granatenbeschuss erwiderten, konnte Prinz Karl Friedrich nicht schlafen.
Sein Mitleid mit den Soldaten lag auch daran, dass er inzwischen ein erhebliches persönliches Unbehagen verspürte, wenn er sich mitten im Kampfgeschehen befand. Am 2. Februar hatte er mit annähernd 10000 Mann die Dänen in einer vorgeschobenen Schanzenstellung bei Missunde am Danewerk angegriffen; und abgesehen von der großen Zahl Infanteristen hatte ihm dabei ein geradezu gigantisches Angebot an Feldartillerie zur Verfügung gestanden: 66 Kanonen. Seine Übermacht war gewaltig gewesen: Die Dänen hatten in dem Schanzenabschnitt, den er angriff, 20 Kanonen und lediglich ein einziges Regiment – ungefähr 2500 Soldaten. Und doch misslang dem Prinzen alles.
Es war grauenhafter Tag für Friedrich Karl; er fühlte sich krank durch den Nebel, die Kälte und den Druck, für das Wohl und Wehe so vieler Menschen verantwortlich zu sein und seine Entscheidungen allein treffen zu müssen. Er hätte bis in die Knochen gefroren, schrieb er später, und seine Laune verbesserte sich durch die erbitterte Gegenwehr, mit der die Dänen seine Truppen empfingen, durchaus nicht.
Die Kanonen dröhnten bei Missunde. Die Erde bebte, der Pulverdampf mischte sich mit dem Nebel, der immer dichter wurde. Rauchwolken und Flammen stiegen in dunklen Säulen am Horizont auf. Der Ort Missunde brannte lichterloh. Preußische Einheiten rückten näher auf die Schanzen vor – aber der dänische Widerstand wurde nicht gebrochen. Als der Prinz zum Sturm auf die Schanzen von Missunde blasen ließ, bäumten sich die dänischen Artilleristen in einer geradezu übermenschlichen Kraftanstrengung auf. Granaten und Kartätschen explodierten in der Luft, pfiffen über den Boden und schlugen auch dort ein, wo Friedrich Karl sich befand. Er war verunsichert und verwirrt und musste erkennen, dass es trotz der Übermacht, über die er verfügte, unmöglich war, die dänischen Stellungen einzunehmen. Der Prinz hatte notgedrungen den Befehl zum Rückzug zu geben, ein an Menschenleben teures Manöver. Kartätschen schlugen in die retirierenden Reihen und zahlreiche deutsche Soldaten blieben auf der gefrorenen Erde liegen.
Ein Fiasko. Der erste Angriff auf die dänischen Stellungen war fehlgeschlagen, und Friedrich Karl wusste, mit welchem Ernst diese Niederlage in den leitenden Kreisen in Berlin aufgenommen werden würde. Die Kriegsskeptiker hatten reichlich Gelegenheit, den König und seinen Minister Bismarck zu kritisieren, die sich auf einen Krieg gegen diese Skandinavier eingelassen hatten.
Elend hatte der Prinz sich auch Ende März gefühlt. Das schwere, regnerische dänische Wetter zehrte an seiner Gesundheit und an seiner Stimmung. In seinem Hauptquartier auf Schloss Gråsten schlief er schlecht, außerdem fror er den ganzen Tag. Als gäbe es keine Wärme in diesen Breitengraden, schrieb er später.
Zusammen mit Stabschef Oberst Blumenthal war er einer der führenden Betreiber eines groß angelegten Angriffsplans, der Ende März umgesetzt werden sollte: das sogenannte Ballebro-Projekt. Laut Plan wollte man die Dänen mit einem Angriff über den Alsenfjord überraschen, mit dem Ziel, das dänische Heer zu umzingeln und niederzuschlagen. Von dem kleinen Fährhafen Ballegård sollten große Truppeneinheiten nach Alsen gebracht werden, um dem dänischen Heer von dort aus in den Rücken zu fallen. Der Prinz ging davon aus, dass die Dänen sich aufgrund ihrer Überlegenheit zur See auf Alsen sicher fühlten. Sie würden sich nicht vorstellen können, dass Preußen auf eine derart riskante Idee wie ein Übersetz-Manöver kam. Die Überraschung wäre vollkommen, und mit einem raschen Kneifzangenmanöver ließen sich die dänischen Truppen auf Alsen und in Düppel aufreiben.
Der Gemeine Wilhelm Gather und seine Kompanie gehörten zu den Soldaten, die an diesem Manöver teilnehmen sollten. Sie fürchteten sich vor dem Angriff, und auch Friedrich Karl gefiel der Plan nicht wirklich. Einerseits war er begeistert von dem Gedanken an einen glorreichen Sieg – gelänge der Plan, würde er den Ruhm als großer Heerführer davontragen. Auf der anderen Seite war und blieb er wankelmütig. War es nicht doch ein zu gewagtes Projekt? Laut Plan wollte man nicht an der schmalsten Stelle über den Sund setzen – hier standen die Dänen bereit, um sich zu verteidigen –, sondern an der breitesten Stelle des Fahrwassers, am Alsenford. Dort allerdings bestand die Gefahr, dass die dänischen Kriegsschiffe eingriffen, wenn es nicht gelang, den Feind vollständig zu überrumpeln. Der groß angelegte Angriff könnte somit auch zu einer totalen Niederlage werden. Der Prinz wurde krank bei dem Gedanken, und er wurde krank, sich nicht entscheiden zu können. Mehrere seiner Generäle und Ratgeber stimmten gegen das Übersetzen, was ihn noch unschlüssiger werden ließ. Die Tage vergingen. Es kam der 1. April, es kam der 2. April. Ungefähr 160 Ruderboote lagen bei Ballegård bereit. Schwere weitreichende Festungsartillerie hatte man in den Stellungen verankert, um die dänischen Kriegsschiffe zu empfangen. Tausende deutscher Soldaten waren zusammengezogen worden, außerdem wurde ein Scheinangriff auf die Schanzen als Ablenkungsmanöver vorbereitet.
Sollte er, sollte er nicht? Es herrschte Uneinigkeit unter den preußischen Generälen, vor allem der aufbrausende und temperamentvolle Blumenthal regte sich auf. Auch er war deutlich nervös und voller Zweifel, doch andererseits ertrug er die Wankelmütigkeit seines Vorgesetzten nicht. Er wollte das Ganze überstanden wissen. Abmarsch und kurzer Prozess. Er beschimpfte den Prinzen bei den Treffen des Generalstabs. Die anderen Generäle hörten staunend zu, als der Oberst brüllte: »So tun Sie doch etwas! Angriff!«
Friedrich Karl indes unternahm nichts. Am 1. April zog ein schweres Unwetter auf. Die Wellen türmten sich meterhoch im Sund, und Friedrich Karl betrachtete es als ein Eingreifen des Herrgotts, der ihm ein Zeichen gab. Die Überfahrt nach Alsen wurde ad acta gelegt und stattdessen beschlossen, die Stellungen bei Düppel durch einen Frontalangriff zu nehmen.
Allerdings waren die Strategen der Ansicht, die Schanzen wären zu stark, um sie lediglich anzugreifen, ohne sie zuvor unter systematischen Beschuss genommen zu haben. Friedrich Karl und die preußischen Generäle spürten gleichzeitig, dass die Zeit gegen sie arbeitete. In Berlin wuchs die Ungeduld. Wo blieb der große Sieg? Es musste bald etwas Entscheidendes geschehen auf dem Kriegsschauplatz im hohen Norden.
Und genau das – etwas Entscheidendes – wollte der Prinz am 17. April zustande bringen. Er und seine Offiziere hatten einen sinnreichen Schlachtplan ausgearbeitet; eine organisatorische Kraftanstrengung, bei der nichts dem Zufall überlassen bleiben sollte.
Seinen Generälen und den anderen hochrangigen Offizieren im Hvilhøj Kro gab er ganz spezielle Befehle, wie die Schlacht um die Düppeler Schanzen am nächsten Tag geschlagen werden sollte. Die Instruktionen lauteten:
In der Nacht zum 18. April rückt die erste Hälfte der Angriffstruppen um 1.30 Uhr bis Bøffelkobbel vor und bezieht von dort aus im Schutz der Dunkelheit und so lautlos wie möglich die preußischen Schützengräben (Parallelen) vor den Schanzen. Um 2.00 Uhr folgt die nächste Angriffskolonne. In den Parallelen legen sich die Truppen auf den Boden und bleiben so still wie möglich liegen – gleichzeitig wird das auf diesem Feldzug heftigste Artilleriefeuer auf die dänischen Schanzen eröffnet. 102 Kanonen werden mit unerhörter Vehemenz und Geschwindigkeit Feuer speien – Granaten und Brandbomben. Sechs Stunden soll dieses Inferno dauern. Um 10.00 Uhr wird der Beschuss der Artillerie für einen Augenblick unterbrochen, die Kanonen werden auf die dänischen Truppen hinter den Schanzen gerichtet. In dem Moment, in dem die Kanonen schweigen – Punkt 10.00 Uhr –, geht es los.
Die Generäle hörten zu. Sie waren bereit. Mehrere Tage hatten Pioniereinheiten den Sturmlauf auf Kopien der dänischen Schanzen trainiert, die man auf Broager und bei Nybøl nachgebaut hatte. Die Angriffstruppen waren aufmarschiert, alle Batterien in Stellung gebracht, die letzte Parallele gegraben.
»Noch Fragen, meine Herren?«, kam es vom Prinzen.
Abb. 7: Preußischer Artilleriepark bei Düppel.
Zunächst Schweigen. Dann durchdrang eine laute, selbstsichere Stimme den Kreis der Offiziere, die Friedrich Karl in einem Halbkreis umstanden. Adjutant von Geisler hielt die Begebenheit fest. Der Ton der Stimme, so von Geisler, war »so ruhig und geschäftsmäßig, als handle es sich um eine Frage nach der Aufnahme der Richtung. Wenn die vorderste Kolonne stutzt, Königliche Hoheit, so darf doch von hinten auf sie geschossen werden [um sie voran zu treiben]? Alles sah nach dem Sprecher hin, einem langen, hageren General mit eigentümlich spitzem Kopf, einer Brille auf der Nase und dem Habitus eines Schulmeisters. Es war Goeben. Der Prinz selbst schien einen Augenblick betroffen, doch bald erwiderte er: ›Das wird nicht vorkommen!‹ Und gleich darauf nochmals mit einer Handbewegung: ›Das wird nicht vorkommen.‹«
4. Schlachtbank Düppel
Nach der Besprechung der Offiziere im Hvilhøj Kro und ungefähr zur gleichen Zeit, als Wilhelm Gather seinen Eltern schrieb, ritt der Rote Prinz mit seinem Stab auf der breiten Sønderborg-Chaussee zur Front bei Düppel. Einen Kilometer westlich der dänischen Schanzen erreichte er den höchsten Punkt der Gegend, den Avnbjerg, von dem er eine vorzügliche Aussicht über die Landschaft hatte. »Ich kam mir vor wie jener König, der mit vergnügten Sinnen auf das beherrschte Samos blickte«, schrieb Prinz Friedrich Karl später über diesen Moment.
Er sah Buchten, Meer und Hügel. Auf der Halbinsel Broager sah der Prinz die großen Batterien bei Gammelmark, die Granaten über den Vemmingbund auf die dänischen Stellungen schossen. Diese Batterien waren die Trumpfkarte des Prinzen. Sie bestanden aus modernen, gezogenen Hinterladerkanonen, die den südlichen Teil des dänischen Verteidigungswerks, die linke Flanke, effektiv beschossen. Seit Anfang April hatten sich die Dänen auf das Duell mit den Batterien von Gammelmark eingelassen. Vor allem Schanze 2, eine der südlichen Schanzwerke, die am höchsten lag, hatte den Beschuss erwidert. Sie wurde geführt von den beiden kaltblütigen Leutnants Ancker und Castenskjold, die für ihre Männer eine Legende waren und hohen Respekt beim Feind gewannen. Aber die Düppeler Stellungen waren nicht dafür gebaut, das Feuer aus Broager zu erwidern, sondern primär, um gegen einen Feind zu kämpfen, der vor den Schanzen stand – in dem eigentlichen Schanzwerk war nur Platz für relativ wenige Kanonen, die sich auf ein Duell mit den preußischen Batterien einlassen konnten.
Dennoch waren die Kämpfe zwischen Schanze 2 und den Broager-Batterien im März und Anfang April nicht weniger heftig gewesen. Im Laufe des April jedoch wurde die Überlegenheit der Preußen immer größer, und am 17. April war die dänische Artillerie so gut wie zum Schweigen gebracht.
Die Batterien von Gammelmark waren lediglich ein Teil der zahlreichen Artilleriestellungen, über die die Preußen verfügten: Ganze 33 Batterien auf die Dänen gerichtete Geschütze hatte man vor den Schanzen eingegraben, und egal, ob Friedrich Karl seinen Blick in Richtung Westen, Osten oder Norden richtete, sah er dunkle Kanonenrohre, deren Mündungen grimmig in die Luft ragten. Er sah den Rauch von ihren Schüssen, und er hörte das dumpfe Dröhnen, das die Landschaft erzittern ließ. Und er sah die Granaten – die Dänen nannten sie ›Broager‹, ›Feldhühner‹ oder ›Störche‹ –, über das ausgedehnte preußische Laufgrabensystem fliegen. Die Laufgräben führten jetzt fast bis an die Schanzen heran – als würden sie den Hals ausstrecken, um den dänischen Stellungen den Todeskuss zu geben. Der Prinz konnte den Bahnen der Granaten folgen und ihre Einschläge in den Schanzen beobachten, die ausgebrannt und beinahe wie in den Boden geduckt vor ihm lagen.
Der viel besungene und weit geschwungene Hügelkamm, die Düppeler Höhe, hatte sich in eine graue und schartige Landschaft verwandelt. Die Höfe der Gegend waren zusammengeschossen. Das Dorf Düppel westlich der Frontlinie gleich hinter dem Avnbjerg bestand ebenfalls nur noch aus einem Haufen Ruinen, dasselbe galt für das Dorf Ragebøl im Nordwesten. Große Teile von Sønderborg im Osten existierten nicht mehr, und auch gegenüber von Sundeved gab es auf der anderen Seite des Sunds Zerstörungen (allerdings kann man vom Avnbjerg bis dorthin nicht sehen). Auf der Düppeler Seite waren die Bäume verschwunden, nur wenige verkohlte Büsche ragten noch aus der nackten Erde.
Der Ort war der Vorhof der Hölle, obwohl die dänischen Soldaten eine eher prosaische Bezeichnung für ihre Stellungen hatten: Sie nannten sie ganz einfach ›Schlachtbank Düppel‹. Ein makabrer Name. Und vielleicht noch demoralisierender war die unfassbare Trostlosigkeit des Ortes. Es sah aus, als würde sich die ganze Landschaft aus Solidarität mit den hart geprüften Truppen vor Schmerzen winden.
Einst thronte eine große, hübsche, weiße Mühle auf der Spitze des Hügels. Die Mühle wurde während eines früheren Krieges in Brand geschossen, 1849 während des Dreijährigen Krieges. Man hatte sie wieder aufgebaut, doch nun war sie erneut eingestürzt: Das Dach war zerschossen, die massiven Mauern durchlöchert, der Putz abgeplatzt und das eigentliche Mahlwerk zerstört.
Einen halben Kilometer westlich der eingestürzten Mühle lagen die dänische Festungsanlagen, die zehn Schanzen. Vor und hinter den Schanzen spann sich ein Wirrwarr aus Granatlöchern, Schützengräben und Laufgräben, von denen die einzelnen Schanzen miteinander verbunden wurden. Insgesamt zogen sich die dänischen Stellungen in einer zwei Kilometer langen Linie über die Anhöhe von Düppel, die vom Meer begrenzt wird: vom Vemmingbund im Süden und dem Alsensund im Norden.
Die dänische Stellung bei Düppel war eine sogenannte Flankenstellung. Sie lag an der östlichsten Spitze Südjütlands, wo die Landschaft wie ein Krummstab ins Wasser ragt. Der ursprüngliche Gedanke einer Flankenstellung lief darauf hinaus, hier große Teile des Heeres zu konzentrieren, um auf diese Weise einem feindlichen Heer in den Rücken fallen zu können, das in Jütland einmarschieren wollte. Weil die Dänen mit ihrer Flotte das Meer kontrollierten, konnte man jederzeit Truppen auf Alsen zusammenziehen, wenn der Druck auf die Schanzen zu groß wurde – oder wenn sie im Sturm genommen werden sollten.
Dies war jedenfalls der strategische Gedanke der Dänen, als die Schanzenreihe 1861 angelegt wurde.
Eigentlich war Düppel als eine offensive Stellung gedacht, von der aus Vorstöße unternommen werden sollten. Die Vorstöße hätten durch die befestigten Schanzen unterstützt werden können. Aber 1864 gab es keine Offensivkräfte mehr im dänischen Heer. Die Dänen verfügten über bedeutend weniger Soldaten – und selbst zu Beginn der Belagerung im Februar, als die Dänen noch in der Überzahl waren, fühlte man sich unterlegen, da man den deutschen Feind für wesentlich besser ausgebildet hielt. Auf dänischer Seite wurde eine Offensive als sinnlos erachtet.
Stattdessen richteten sich die Dänen auf eine Belagerung ein. Zwischen den Schanzen wurden Laufgräben ausgehoben, weiter zurückliegende befestigte Stellungen hinter den Schanzreihen errichtet – und bis Mitte März, als das dänische Heer noch das Terrain vor den Schanzen kontrollierte, wurden dort unzählige Beobachtungslöcher und Schützengräben angelegt.
Ausgeklügelte Hindernisse hatte man vor der Schanzlinie installiert: spanische Reiter, die vorstürmende Soldaten aufspießen konnten, Stacheldrahtzäune, die Hände, Füße und Körper der gehetzten Angreifer aufreißen sollten. Auch ein breiter Zaun angespitzter Pfähle, sogenannte Sturm-Pfähle oder Cäsar-Pfähle, wurde errichtet. Außerdem stellten die Dänen ganze Gürtel mit Eisenspitzen versehener Eggen auf. Sie sollten diejenigen töten oder verstümmeln, die im Kampfgewühl über sie stolperten.
Schließlich hob man Fallgruben aus und verteilte die berüchtigten Fußangeln – schwere sternförmige Eisenspitzen, die sich durch den Fuß bohrten, wenn man fest auf sie trat.
Friedrich Karl hatte die Schanzen zum ersten Mal Mitte Februar gesehen; er hatte den Mut verloren und seinem Onkel, König Wilhelm I., geschrieben: »Düppel war ein Stück Sewastopol. Eine von Natur starke Stellung von der Art, dass sie in der Feldschlacht nur ungern von einem weit überlegenen Feind angegriffen werden würde.«
Sewastopol. Der Name hatte einen furchteinflößenden Klang. Mit haarsträubend hohen Verlusten hatten französische und britische Truppen während des Krim-Krieges gegen Russland nach einer langen, blutigen und zehrenden Belagerung – der Typhus hatte gewütet – 1856 die stark befestigte Hafenstadt Sewastopol gestürmt. Die russischen Verteidiger waren den Angreifern zahlenmäßig weit unterlegen. Dennoch führte der Sturm auf die Stellungen zu einem Blutbad unter den Angreifern, es war ein teuer erkaufter Sieg. Ein Blutbad, das Offiziere weltweit studiert hatten, nicht zuletzt die ausgezeichnet ausgebildeten preußischen Heerführer. Ein Blutbad, dem kein General seine Truppe aussetzen wollte.
Zumal der Gedanke an eine lange und erschöpfende Belagerung bedrückend war. Monatelang hatten die Briten und Franzosen Sewastopol mit Kartätschen und Granaten überzogen, augenscheinlich ohne die Verteidiger in die Knie zu zwingen. Wieder und wieder gelang es den Russen, die Schäden an ihren Verteidigungsanlagen zu reparieren.
Der Vergleich zwischen Sewastopol und Düppel war Anfang April 1864 durchaus berechtigt. Die dänischen Verteidigungsstellungen in Düppel waren zu dieser Zeit weitaus stärker, als es die dänische Nachwelt unter dem Eindruck des verlorenen Krieges zugeben wollte – und stärker, als die dänischen Soldaten und Offiziere oft selbst glaubten.
Die Schanzen lagen hoch in der Landschaft. Von ihnen aus ließ sich ein Angriff genau überblicken. Es ist schon immer effektiver gewesen, auf Angreifer in einem offenen Gelände zu schießen, als auf jemanden, der hinter einer Brustwehr abwartet.
Sieben der zehn Schanzen waren rundum abgeschlossen, die ausgehobenen Erdbefestigungen umgaben tiefe Wallgräben und schwere Palisadenwände. Eine Zugbrücke ließ sich hinter den Schanzeneingang ziehen, der mit einem schweren Palisadentor geschlossen werden konnte. Dann befand man sich in einer Festung mit Kugelfängen für die Infanterie, Kanonenständen, sogenannten Blockhäusern (gedacht als schusssichere Aufenthaltsräume für die Soldaten; allerdings erwiesen sie sich als nicht sicher gegenüber Granaten), dunklen Pulverkammern, die aus schwerem Beton gebaut waren, und Traversen, das heißt Querwällen. Diese Querwälle sollten die Besatzung vor Granateneinschlägen schützen.
Drei Schanzen – Schanze 3, 5 und 7 – waren nach hinten offen, die sogenannten Lünetten. Auch sie verfügten über tiefe Wallgräben, Palisadenwände und Kugelfänge für die Infanterie, in erster Linie aber dienten sie als schwere Kanonenstellungen.
Dass die Landschaft im Laufe des Aprils immer düsterer und die Stellung wesentlich geschwächt wurde, war das Werk der deutschen Kanonen. Sewastopol hatte die Strategen gelehrt, dass es nicht ausreichte, die gegnerische Stellung einfach nur kräftig zu beschießen und zu zerstören zu versuchen. Man hatte systematisch vorzugehen, mit einer weit überlegenen Feuerkraft. Man musste die Verteidiger brechen, die Schanzen einreißen und gleichzeitig die über 80 Kanonen, über die die Dänen zu ihrer Verteidigung verfügten, zum Schweigen bringen. Je mehr dänische Kanonen zerstört wurden, desto besser. Mit Kartätschen geladene Kanonen waren damals die gefährlichste Waffe gegen angreifende Truppen. Eine Kartätsche entfaltete gegen die vorstürmende Infanterie eine Wirkung wie ein Maschinengewehr, nur war ihr Effekt fast noch schlimmer: Eine gut platzierte Kartätsche konnte mit einem wüsten Knall eine ganze Abteilung Soldaten in Stücke reißen.