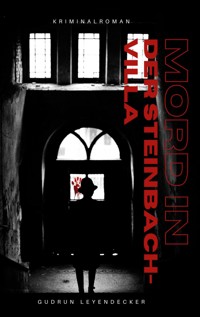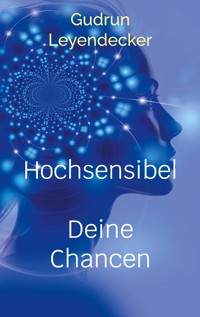Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Dolomitensaga
- Sprache: Deutsch
Zwei Familien, ein Tal - und eine Heimat, die zur Schicksalsfrage wird. Südtirol, 1955. Tief verschneit liegt ein abgelegenes Tal zwischen Felsen und Fichten, doch unter der winterlichen Stille brodelt ein gefährlicher Konflikt. Zwei Bauernfamilien, die Kobners und die Hinterhofers, leben seit Generationen Tür an Tür. Was einst Nachbarschaft war, wird in der Nachkriegszeit zu offener Feindschaft. Politische Überzeugungen, alte Verletzungen und der Kampf um die Autonomie der Region reißen tiefe Gräben durch Familien und Freundschaften. Während im Verborgenen Freiheitsaktionen vorbereitet werden, geraten einzelne Menschen zwischen die Fronten. In einem dichten Netz aus Politik, alten Beziehungen, Loyalität, Liebe und Angst flammt die Gewalt auf, doch es gibt auch jene, die an Versöhnung glauben und an eine Zukunft jenseits von Hass. Dieser Roman erzählt von Schuld und Hoffnung, von Stolz und Verrat - und von der Frage, wie viel Heimat ein Mensch verlieren kann, ohne sich selbst zu verlieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsangabe:
Textbeginn
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 56
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Inhaltsangabe:
Südtirol, 1955.
In einem abgelegenen Tal zwischen Felsen und Fichten kämpfen zwei Bauernfamilien um ihre Heimat und ihre Lebensanschauungen. Die Kobners und die Hinterhofers, seit Generationen Nachbarn, nun durch Misstrauen und politische Richtungen entzweit.
Während im Land heimlich Freiheitsaktionen vorbereitet werden, verstricken sich Politik und persönliches Schicksal zu einem Netz aus Liebe, Stolz und Verrat. Immer wieder eskaliert die Gewalt, aber immer wieder gibt es Personen, die versuchen, ein friedliches Miteinander für die Zukunft zu finden.
Die Geschichte und alle Personen und Namen sind frei erfunden, und jede Ähnlichkeit mit Personen ist rein zufällig. Geschichtlich belegt ist jedoch, dass in dieser Zeit durch Aktionen einiger Personen der Freiheitsbewegung zahlreiche Menschen, besonders auch Carabinieri ums Leben kamen oder verletzt wurden.
Allen Opfern dieser Zeit ist diese Geschichte gewidmet.
Gudrun Leyendecker ist seit 1995 Buchautorin. Sie wurde 1948 in Bonn geboren.
Siehe Wikipedia.
Sie veröffentlichte bisher über 120 Bücher, unter anderem Sachbücher, Kriminalromane, Liebesromane und Satire. Leyendecker schreibt auch als Ghostwriterin für namhafte Regisseure. Sie ist Mitglied in schriftstellerischen Verbänden und in einem italienischen Kulturverein. Erfahrungen für ihre Tätigkeit sammelte sie auch in ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Lebensberaterin.
Kapitel 1
Der Schnee breitete sich auf den Hängen aus, als wollte er alles zudecken, was in den letzten Jahren gewesen war.
Die alten Lärchen am Wegrand trugen weiße Schultern, und in der Dämmerung glitzerten die Äste, als hielten sie das letzte Licht des Tages fest. Über den Bergen hing ein fahles Blau, das bald ins Schwarz überging. Kein Laut war zu hören außer dem Knirschen der Schritte eines Mannes, der langsam durch den Schnee stapfte.
Johann Kobner kam vom Alm-Bertl herab. Der Weg war ihm vertraut, aber heute schien er länger als sonst. Die Kälte fraß sich durch die Stiefelsohlen, und in seinem Bart hatten sich kleine Eiskristalle verfangen. Über ihm zog der Wind vom Taleingang herauf, scharf und müde zugleich, wie einer, der zu viel gehört hat in den letzten Jahren.
Die Männer hatten lange beisammengesessen, beim Bier und bei ernsten Worten. Es war wieder geredet worden: über die Regierung, über Rom, über die Italiener, die jetzt vermehrt ins Tal kommen sollten.
„Die nehmen uns alles,“ hatte Karl Hinterhofer gesagt, mit jener rauen Stimme, der keiner gern widersprach. „Unsere Sprache, unsere Höfe, unsere Ehre.“
Johann hatte geschwiegen. Man wusste, dass er nicht der war, der leicht ins Schimpfen verfiel. Er hörte lieber zu, wog die Worte ab, bevor er sie sprach.
Als er den Hof endlich erreichte, lag Rauch über dem Dach, dünn und still, und durch das kleine Fenster der Stube fiel warmes Licht auf den Schnee. Er trat in den Flur, klopfte die Füße ab und hängte den Mantel an den alten Haken. Drinnen roch es nach Suppe, nach Holz und nach dem stillen Leben, das hier nie ganz aufgehört hatte.
Anna stand am Herd.
„Du bist spät heut’, Johann,“ sagte sie, ohne sich umzudrehen.
„Ja,“ antwortete er nur. Seine Stimme klang rau vom Wind.
Sie schöpfte die Suppe auf den Teller und stellte sie vor ihn hin. „War wieder eine lange Versammlung?“
Er nickte. „Die Männer beim Alm-Bertl können reden, als hätt’ der Krieg nie aufgehört.“
Sie setzte sich ihm gegenüber und faltete die Hände. „Was sagen sie diesmal?“
„Sie wollen nicht, dass mehr Italiener kommen. Der Hinterhofer war der Lauteste. Der meint, man müsse sich wehren. Er sagt, wenn Rom befiehlt, dann soll Tirol schweigen, aber er will nicht schweigen.“
Anna sah ihn an, die Stirn leicht gefurcht. „Und du? Was meinst du dazu?“
Johann rührte in der Suppe, blies den Dampf fort. „Ich mein’, der Krieg ist verloren, und verloren ist verloren. Wir müssen leben mit dem, was kommt. Wir sind keine Herren im Land mehr. Wir müssen arbeiten, nicht reden.“
Eine Weile schwieg sie. Nur das Ticken der alten Uhr war zu hören, und draußen heulte kurz der Wind.
„Mir ist nicht wohl bei dem, was du erzählst,“ sagte sie leise. „Wenn der Hinterhofer wieder anfängt, den Leuten den Kopf heiß zu reden, kommt Unheil ins Tal. Ich spür’s.“
Johann sah sie lange an. Ihre Hände, vom Winter trocken und rau, lagen ruhig auf dem Tisch, und doch zitterten die Finger ein wenig. „Ich kenn ihn seit Kindertagen,“ murmelte er. „Er war nie einer, der sich beugen konnte. Aber vielleicht ist jetzt die Zeit, wo wir uns alle ein wenig beugen müssen.“
Er stand auf und trat ans Fenster. Draußen schob sich der Mond über den Grat, silbern und fern. „Ich hab heut auch an Federico gedacht,“ sagte er, fast zu sich selbst. „Du weißt schon – der aus Bozen. Ein guter Mann. Halb Italiener, halb Südtiroler. Wir haben als Buben zusammen Fische gefangen unten am Bach. Er ist wie ich. Kein besserer, kein schlechterer. Nur ein Mensch.“
Anna nickte. „Ich wünsch mir nur, dass es friedlich bleibt. Dass die Kinder in Ruhe großwerden können.“
Im Nebenraum hörte man das leise Atmen der Kinder, das Rascheln einer Decke. Die kleine Lilli murmelte etwas im Schlaf, ein Wort ohne Sinn, aber mit dem Klang von Geborgenheit.
Johann setzte sich wieder, trank den letzten Rest der Suppe, und für einen Moment war alles still. Nur das Feuer im Herd knackte leise, und draußen fiel Schnee vom Dach, dumpf und weich.
„Frieden,“ sagte Anna noch einmal. „Das wär’ schön.“
Johann sah sie an, lange, dann nickte er. „Ja,“ sagte er. „Aber Frieden ist schwerer zu halten als Krieg.“
*
Kapitel 2
Der Schnee lag dicht über den Almwiesen, als hätte der Himmel ihn auf das Land gelegt, um es zum Schweigen zu bringen. In den Furchen der Hänge leuchteten vereinzelt die Lichter der Höfe, matt und fern, wie die Augen alter Menschen, die das Leben schon zu lange gesehen hatten. Vom Tal herauf kam Karl Hinterhofer, die Schultern rund vom Frost und von Gedanken, die ihn drückten wie ein schwerer Stein. Der Wind spielte mit seinem Mantel, zerrte an den Knöpfen, als wolle er ihn noch einmal prüfen, ob er standhielt gegen das, was kommen mochte.
Im Haus war es still. Nur das Knacken des Feuers im Ofen mischte sich in die Nacht. Leonore war wach geworden, hatte den Vater gehört, noch bevor er die Tür geöffnet hatte. Sie zog das Tuch enger um die Schultern, entzündete die Lampe und begann, das Essen aufzuwärmen: Kartoffeln mit Specksauce, schlicht, aber kräftig, ein Mahl, das den Körper wärmte und die Seele mit Erinnerungen füllte.
„Du bist spät, Vater“, sagte sie, ohne Vorwurf, nur mit Sorge in der Stimme.
Karl nickte, setzte sich schwerfällig an den Tisch. Der Schnee tropfte von seinem Mantel auf die Dielen, kleine Spuren der Kälte, die nicht lange bleiben würden.
„War es gut heute?“ erkundigte sich Leonore und legte ihm eine weitere Kartoffel auf den Teller.
Er murmelte etwas vor sich hin. „So kann es nicht bleiben. Aber es wird uns schon etwas einfallen. Aber wage dich ja nicht, einmal einen von diesen Ausländern anzuschleppen. Mit einem Italiener kannst du nur unglücklich werden.“ Er zerschnitt die Kartoffel mit dem Messer.
Leonore tat so, als habe sie seine Worte nicht gehört. „Ich habe etwas von Mutter aus dem Krankenhaus gehört. Der Pfarrer hat heute einen Krankenbesuch unten in der Stadt gemacht, und er war kurz mal bei Mutter im Zimmer. Er meinte, Mutter hätte heute viel besser ausgesehen als beim letzten Mal.“
Karl blickte auf und seufzte. „Ja die Lunge! Dabei haben wir hier immer so gute Luft gehabt.“
Sie füllte ihm den Becher erneut. „Sie fehlt uns hier so sehr. Agathe hat heute wieder geweint.“
„Diese harte Zeit hat uns alle krank gemacht“, meinte er und sah böse auf. „Und jetzt kommen wieder neue Sorgen. Wir müssen den Italienern zeigen, dass wir hier eine alte Tiroler Kultur haben, die darf nicht zugrunde gehen, weil sie sich jetzt hier alle ausbreiten.“
Leonore hatte eine Antwort auf der Zunge, aber sie wagte nicht, dem Vater etwas zu entgegnen, deswegen blieb sie still.
Karl stöhnte und wischte sich den Mund ab. „Es ist ein Jammer, dass dein Bruder Hans nicht bei uns im Haus ist. Wir könnten ihn jetzt bei allem gut gebrauchen“, meinte er ärgerlich und mit lauter Stimme.
„Aber Tante Tina braucht ihn jetzt noch mehr in Luttach“, fand die Tochter. „Ihr Mann, Onkel Gustav und ihre beiden Söhne sind im Krieg gefallen, andere Verwandte als uns hat sie nicht außer ihrer Tochter Filippa. Allein kann sie unmöglich den großen Hof bewirtschaften.“
„Weiß ich“, brummte der Vater ärgerlich und erhob sich. „Geh schlafen, es ist spät!“
Während Leonore noch nach dem Feuer sah, schlurfte der Vater ohne ein weiteres Wort aus dem Zimmer. Seine Schritte knarrten auf der Stiege, während er hinaufstieg, um sich in die Schlafkammer zu begeben.
In diesem Moment erschien ein junges Mädchen aus der Stube nebenan und wärmte sich die Hände am Ofen. „Hat der Vater wieder sehr viel geschimpft?“
„Was machst du denn noch so spät hier, Agathe?“ fragte die große Schwester und strich der Jüngeren über den Kopf. „Du solltest längst schlafen, sonst wirst du nachher auch so krank wie Mutter.“
Draußen knarrte ein Ast im Wind. „Es ist so still bei uns geworden, seit Mutter und Hans nicht mehr hier sind. Vater ist immer so ernst und schimpft mehr und mehr. Ich dachte immer, wenn der Krieg zu Ende ist, dann sind wir alle fröhlich. Uns geht es doch gut, wir müssen zwar sparen, aber nicht hungern.“
Leonore legte den Arm um Agathes Schultern. „Es wird schon wieder. Die schweren Jahre kann Vater nicht einfach so abschütteln, und jetzt hat er Sorgen um Mutter und um die Zukunft in unserem Land. Geh schlafen, das wird dir guttun!“
Die Schwester blickte bittend hoch. „Darf ich denn noch ein Weilchen zu dir ins Bett kommen?“
Die Ältere hob die Augenbrauen und sah die Kleinere vorwurfsvoll an. „Du bist doch nicht mehr klein, du bist schon sechzehn Jahre alt.“
Agathe lächelte schelmisch. „Das schon. Aber ich habe kalte Füße.“
Da wich auch der Ernst aus Leonores Gesicht. „Also gut. Ausnahmsweise, weil es so kalt ist.“
Gemeinsam, Hand in Hand, gingen die beiden Schwestern in die Schlafstube.
*
Kapitel 3
Die ganze Nacht über hatte es geschneit, und die Schneedecke über den Almwiesen war um einige Zentimeter gewachsen.
Vor dem Haus des Kobner-Hofes freute sich ein kleines Mädchen über die weiße Pracht und begann, einen Schneemann zu bauen. Doch bevor sie die erste Kugel gerollt hatte, erschien die Mutter im Rahmen der Haustür. „Komm herein, Lilli! Der Frühstücksbrei steht auf dem Tisch, wir warten schon alle auf dich.“
Das kleine Mädchen blickte sehnsüchtig auf die weiße Pracht. „Ich habe gar keinen Hunger, warum muss ich etwas essen? Ich will viel lieber hier draußen bleiben.“
Anna seufzte. „Ich weiß wirklich nicht, warum du so anders bist als deine Geschwister. Vincent, Maria und Jakob fragen nie, wenn sie irgendetwas tun sollen. Sie wissen einfach, dass alles gut ist, was wir ihnen sagen, Vater und ich.“ Lilli sah die Mutter aus großen Augen an. „Maria sagt immer, das kommt davon, dass ich erst nach dem Krieg geboren bin und all die schrecklichen Dinge nicht gesehen habe, die meine großen Geschwister gesehen haben.“
„Was du mir immer für merkwürdige Dinge sagst! Komm jetzt herein!“ fügte Anna kopfschüttelnd hinzu und ging voran ins Haus.
Lilli folgte ihr und hüpfte froh gelaunt durch die Stube.
An dem großen Holztisch hatten sich bereits der Vater, der Bruder Vincent und die beiden älteren Schwestern Maria und Johanna versammelt, und sahen die Ankommenden erwartungsvoll an.
Die Kleine betrachtete ihre Geschwister munter. „Warum habt ihr auf mich gewartet? Von mir aus hättet ihr ruhig schon anfangen können.“
Der Vater warf ihr einen strengen Blick zu und setzte sich gerade. „Was sind denn das für neue Sprüche?! Wir sind eine Familie, und wenn es geht, essen wir gemeinsam, besonders am Sonntag.“
Lilli setzte sich ebenfalls, und die Mutter holte seufzend die Kaffeekanne vom Ofen. „Es wird andere Zeiten geben, ohne Zweifel. Aber das hat nichts mit den Italienern zu tun. Jetzt, nach dem Krieg, weht auf der ganzen Welt ein neuer Wind, ein frischer. Ich glaube, sogar hier in unserem Tal. Maria, sprich du heute das Tischgebet!“
Alle Familienmitglieder falteten die Hände, senkten den Blick, und die junge Frau begann mit fester Stimme, eine Segnung für die Mahlzeit zu sprechen.
Nach dem „Amen“ langten alle tüchtig zu, um sich für den Tag stärken. Sie aßen schweigend, wie fast jeden Morgen.
Vincent hatte indes über die Worte der Mutter nachgedacht. „Unten in Bruneck, da habe ich in der Werkstatt einen älteren Kollegen, der sagt, dass sich bei uns in der Gegend irgendetwas zusammenbrauen wird. Es gibt zu viele alteingesessene Tiroler, die es nicht gut finden, dass so viele Italiener aus dem Süden hierherziehen.“
Auf der Stirn des Vaters zeigten sich Sorgenfalten, und er nahm einen tiefen Schluck aus der Tasse. Jetzt konnte er auch nicht mehr ruhig bleiben. „Gestern Abend bei der Versammlung auf der Bertl-Alm haben auch einige davon geredet. Der Karl Hinterhofer ist ganz wild darauf, die Italiener aus dem Süden wieder fortzuschicken. Er sagt, dieses Temperament passt nicht hierher. Aber das ist eben die Politik von Rom, da können wir nichts machen, wenn sie hier so viele Menschen aus dem Süden bei uns im Tal ansiedeln.“
Die Mutter hob den Kopf. „Eigentlich sollte sich nach dem Pariser Vertrag von 1946 dieses Gebiet hier selbst regieren dürfen. Aber so, wie es jetzt aussieht, befürchten doch einige Menschen, dass man hier bald nur noch Italienisch spricht.“
„Dafür können aber die armen Leute nichts, die hierherkommen“, fand Maria. „Wenn sie im Süden keinen Wohnraum haben, und ihnen diese Berglandschaft gefällt, warum sollten sie da nicht hierhinziehen dürfen?!“
„Sie werden in Rom dazu aufgefordert, so heißt es“, berichtete der Vater. „Nach dem Abkommen in Paris sollte eigentlich alles beim Alten bleiben. Doch die Regierung ist nicht dumm, hier ist viel Platz, hier ist viel Land. Also schicken sie ihre Leute aus dem Süden in diese Gegend.“
Vincent legte das Brot beiseite. „Aber wir sind doch jetzt auch Italiener, weil wir in einem Land leben, das von Italienern regiert wird.“
Johanna meldete sich und sah ihren Bruder nachsichtig an. „Das verstehst du nicht. Hier sind wir doch eigentlich in Tirol, und die Menschen sind Tiroler. Das sieht man doch besonders an unseren Trachten. Sie sind doch nicht Italienisch.“
Jetzt seufzte auch die Mutter erneut. „Ich weiß nicht, wer schuld ist, ob die Regierung in Rom, oder unsere Tiroler hier, das wird nicht einfach werden, und es sieht nach sehr viel Streit aus. Ich hoffe nur, dass die Bevölkerung nicht darunter leidet.“
Lillis Augen öffneten sich weit. „Kommt wieder Krieg?“
Die Mutter strich ihr über das Haar. „Aber nein Kind. Den hatten wir doch lange genug, und er war schlimm genug. So etwas wollen wir nie wieder haben. Und jetzt macht euch alle fertig, wir wollen nach Mühlwald in die Kirche gehen. Vergesst nicht, euch Überschuhe anzuziehen!“
*
Kapitel 4
Als die Familie, in dicke Wintermäntel eingehüllt, mit Mützen, Schals und Handschuhen den Weg zur Kirche nahm, glitzerte die weiße Schneepracht ringsherum in der Sonne. Die schneebedeckten Gipfel der nördlichen Zillertaler Alpen grüßten leuchtend herüber.
Vom Seitenweg her näherte sich eine kleine Gestalt, die sich mühsam durch den hohen Schnee kämpfte. „Das ist Agathe“, rief Maria fröhlich aus und lief dem jungen Mädchen entgegen. „Agathe von den Hinterhofers.“ Mit schnellen Schritten hatte sie die Freundin erreicht.
„Was ist denn los mit dir? Warum hast du keine vernünftigen Schuhe an?“
Agathe stöhnte und rieb sich die Knie. „Der Vater war wütend heute Morgen. Und er hat auch schon ein bisschen getrunken. Seit Mutter im Krankenhaus ist, tut er das öfters. Er wollte nicht, dass ich in die Kirche gehe. Ich sollte Leonore helfen, ein paar Kleidungsstücke für Mutter zu flicken, damit sie im Krankenhaus wieder etwas zum Anziehen hat. Deshalb hat er mir einfach die Stiefel versteckt. Da habe ich meine alten Schuhe vom letzten Jahr angezogen. Aber die sind viel zu eng.“
Maria sah die Freundin mitleidig an. „Herr je! Das ist wirklich ein schlechter Scherz. Kein Wunder, dass dir jetzt die Füße und die Beine weh tun. Und du wolltest unbedingt in die Kirche?“
Agathe stöhnte. „Ja auch. Aber ich wollte auch mit dir reden, weil mich ja sonst der Vater bestimmt nicht zu euch gehen lässt. Er hat nämlich heute Morgen schon mächtig über deinen Vater geschimpft.“
„Geschimpft? Aber warum denn?“ fragte die Freundin ungläubig.
Der Schnee knirschte unter ihren Füßen. „Er war gestern auch bei der Versammlung. Und er will sich mit einigen weiteren zusammentun, um zu beratschlagen, was man gegen die Italiener tun kann. Vater sagt, dass dein Vater da nicht mitmachen will, und erst einmal abwartet, was die Zeit so bringt. Er hat sogar gesagt, dass dein Vater nicht mutig ist. Was sagst du jetzt?“
Maria schüttelte den Kopf. „Nicht mutig?! Dabei sind die beiden doch sonst immer gemeinsam auf die höchsten Berge geklettert und hatten keine Angst.“
Agathe seufzte und humpelte weiter. „Ich kann es auch nicht verstehen, was der Vater meint. Es muss wohl bei dieser Versammlung gewesen sein, da haben sich die Männer wohl gestritten. Leider trinken sie dort auch immer viel zu viel, und ich wünschte ich könnte dem Vater die Flaschen wegnehmen, seit Mutter im Krankenhaus ist, ist er wie verändert.“
Das junge Mädchen sah ihre Freundin aufmerksam an. „Was würde er denn tun, wenn du ihm die Flaschen wegnimmst?“
„Wahrscheinlich würde er die Flaschen suchen und finden und mich dann schlagen, wenn er herausbekommen, dass ich sie versteckt habe. Ich bin ziemlich hilflos, und bin ja leider erst sechzehn Jahre alt, genau wie du. Ich habe ja sonst nur meine große Schwester Leonore bei mir. Aber die traut sich auch gar nichts gegen den Vater zu unternehmen. Sie gehorcht ihm aufs Wort. Und dabei ist sie doch schon achtzehn Jahre alt. Seit unser Bruder Hans nicht mehr auf dem Hof ist, haben wir niemanden mehr der uns den Rücken stärkt“, beklagte sich Agathe.
„Bei uns geht es schon ein wenig anders zu“, veriet Maria. „Mutter ist froh, dass Vater unverletzt aus dem Krieg heimgekommen ist, und seitdem sind sie sehr dankbar und irgendwie nicht mehr so streng wie vorher. Vincent ist ja schon in der Lehre, er ist eigentlich schon erwachsen. Und meine Schwester Johanna ist sehr brav. Sie hat meinen Eltern noch nie Sorge bereitet. Nur die kleine Lilli, die ist irgendwie ein Wildfang und überrascht uns alle immer wieder. Sie fällt ein bisschen aus dem Rahmen.“
„Es ist gut, dass ihr eine so große Familie seid“, freute sich Agathe mit der Freundin. „Da ist es nicht so still wie bei uns. Und seit Mutter im Krankenhaus ist, gibt es bei uns sowieso nur noch Arbeit oder das Schimpfen meines Vaters.“
Maria überlegte und zog den Schal fester um die Schultern. „Er macht sich bestimmt viele Sorgen. Und wenn er ja jetzt auch alles mit euch allein machen muss, was bisher seine Mutter getan hat, dann wird er alles nicht so gut schaffen können. Klein ist euer Hof nicht.“
Das junge Mädchen blieb stehen und rieb sich den schmerzenden Fuß. „Nein, eigentlich waren unsere Höfe einmal sehr schönen In diesem Tal, bis dann der Krieg kam und alles ein bisschen verwahrloste. Es gab da nur das Nötigste. Ich hoffe, dass alles jetzt aufwärtsgeht, obwohl der Vater so düstere Gedanken hat.“
„Ich habe auch Hoffnung, dass alles besser wird“, bekannte Maria. „Mutter war immer voller Hoffnung, sogar im Krieg, und sie hat immer mit uns sehr viel gebetet. Da habe ich es auch gelernt, und ich werde auch gleich in der Kirche für deine Mutter beten.“
Agathe freute sich und sah die Freundin mit leuchtenden Augen an. „Danke dir! Vielleicht lerne ich es auch wieder, das Beten.“
Auf der Anhöhe vor ihnen erhob sich die Dorfkirche mit dem hohen spitzen Turm, auf dem der Schnee immer noch liegen geblieben war, nur das dunkle Metall-Kreuz ragte mahnend daraus empor.
*
Kapitel 5
Die Holzhütte roch nach Harz und nassem Holz. Draußen lag der Schnee und bedeckte alles, drinnen flackerte eine einzige Lampe, die Schatten an die rauen Balken warf. Anton zog den Lodenkragen hoch, ließ den Atem als kleine Nebelschwaden aufsteigen und stellte die Kaffeekanne auf den wackeligen Tisch.
Bertl saß bereits da, die Hände noch vom Schmieröl leicht schwarz, die Stirn in die Falten gelegt, als trüge er die ganze Schwere des Tals in sich. Sie schwiegen einen Moment, weil Worte in solchen Stunden erst warm werden mussten. Dann begann das Gespräch, ernst, knapp, wie bei Männern mit zu vielen unausgesprochenen Erinnerungen.
„Wir können so nicht weitermachen,“ sagte Anton schließlich. Seine Stimme war rau, aber fest. „Rom will uns vorschreiben, wer wir zu sein haben, und das sollen wir einfach hinnehmen?“ Bertl nickte. „Sie wollen unsere Sprache, unsere Sitten auslöschen. Wir haben nicht nur Land zu verlieren, Anton, sondern die Art, wie wir leben. Das kann keiner von uns einfach zulassen.“
Anton legte die Finger um die Tasse, als brächte die Wärme ihm Mut. „Wir müssen etwas tun, und zwar bald. Reden nützt nichts mehr; wir müssen ein Zeichen setzen, damit die Leute aufwachen, und damit Rom merkt, dass hier nicht alles still weiterläuft.“
„Was schlägst du vor?“ Bertls Augen verengten sich. Seine rechte Hand trommelte unruhig auf dem Holztisch.
„Wir müssen Rom aufmerksam machen. Und das geht nur, wenn wir etwas zerstören, was den hohen Herren wichtig ist. Denkmäler zum Beispiel,“ sagte Anton. „Nicht die Häuser der Leute, keine Höfe. Aber die Monumente, die sie aufbauen, um uns ihre Macht zu zeigen. Die Schilder, die überall auf Italienisch prangen. Wenn die nicht mehr da sind, wenn man sieht, dass die Symbole nicht sicher sind, wird man in Bozen nicht mehr so tun können, als sei hier alles normal.“
Bertl stöhnte leicht. „Aber das ist Revolte und Provokation zugleich. Wenn wir ein Denkmal zerstören, was ist dann? Kommt das Militär? Kommen Verhaftungen? Können wir das riskieren?“
„Ich weiß, was es ist,“ antwortete Anton ruhig. „Gefahr. Aber wir müssen etwas tun. Es geht nicht um Lust am Zerstören. Es geht darum, Gehör zu finden. Wenn nur einzelne Briefe geschrieben werden wie bis jetzt, werden unsere Forderungen wieder untergehen. Ein zerstörtes Monument richtet mehr aus als hundert Petitionen. Die Leute müssen sehen, dass Widerstand möglich ist.“
Bertl zog an seinem Bart, dachte an die Männer im Versammlungslokal, an die hitzigen Reden, an die Blicke der Freunde, an Johanns Blick bei der letzten Versammlung. „Und die Gewalt? Wenn jemand verletzt würde? Wenn wir anfangen, Gewalt anzuwenden, wer hält dann die Grenze?“
Anton schluckte. „Ich bin kein Feigling. Aber ich bin auch kein Mörder. Wir zielen nicht auf Menschen. Wir zielen auf Symbole. Wenn wir jetzt nichts zu, dann sind wir verloren, nicht nur als Bewegung, sondern als Menschen. Die Aktion darf kein Blutvergießen werden. Wir müssen Regeln haben: Unschuldige müssen geschützt werden. Keine Unbeteiligten, keine Kirchen, keine Häuser dürfen angegriffen werden. Nur das, was die Besatzer als Symbol der Macht gebaut haben.“
Bertl schloss die Augen, als läge ihm plötzlich die Pflicht schwer auf der Brust. „Und die Männer, die wir ansprechen? Wer führt? Wer entscheidet, wenn es eng wird?“
„Wir müssen klein anfangen,“ sagte Anton. „Nur Vertraute. Leute vom Betrieb, Leute, die ich kenne. Ein paar von der Alm, alles Menschen, die schweigen können. Wir machen vorher Proben, prüfen unsere Mitarbeiter, die Wege, den Zeitpunkt. Und dann handeln wir in der Nacht, wenn keiner auf den Straßen ist. Dann schlagen wir zu, zerstören das, was sie stolz macht, und ziehen uns zurück. So fällt die Aufmerksamkeit auf die Bewegung, nur auf unser Ziel, nicht auf Unschuldige.“
Bertl öffnete die Augen, sprach langsam und bedächtig. „Das haben wir einen Pakt, Anton. Wenn wir das tun, binden wir uns. Wir können nicht mehr zurück. Bist du dir dessen bewusst?“
„Ich bin mir bewusst,“ sagte Anton leise. „Und wenn du jetzt mitgehst, dann nur, weil du es für das Beste hältst. Wenn du nicht sicher bist, dann mache ich es. Denn ich kann nicht mehr nur reden. Die Zeit der Reden ist vorbei.“
Draußen ächzte ein Ast im Wind, als wolle er die Worte bekräftigen. Die Lampe warf ein flackerndes Licht auf die beiden Männer, die sich jetzt aufrecht hinsetzen, als wollten sie damit ihre unbeugsame Haltung beweisen.
*
Kapitel 6
Im benachbarten Tal stellte Tina Veitl die Suppenterrine auf den sonntäglich gedeckten Tisch. „Setzt euch Kinder!“ sagte sie zu ihrem Neffen Hans und ihrer Tochter Filippa in freundlichem Ton und nahm auf dem Stuhl am Kopfende Platz. „Heut werde ich das Tischgebet selbst sprechen.“
Sie setzte sich gerade, senkte den Blick und sprach ein langes Dank-Gebet, wobei sie sich sowohl für den bestehenden Frieden als auch für das Gute Auskommen und die gute Ernte des letzten Sommers bedankte. Am Ende bat sie um Gesundheit für die ganze Familie und um eine gute Bekömmlichkeit des Essens. Mit dem Wort „Amen“ am Ende des Gebets zeigte sie ihre Zuversicht und ihr Vertrauen zu Gott.
„Du hast bestimmt bei den Kranken auch an meine Mutter gedacht“, vermutete Hans und sah die Tante dankbar an.
Sie nickte. „Ich weiß, wie schlimm es ist, jemanden zu verlieren. Mein Gustav liegt irgendwo in unbekannter Erde, und auch meine Söhne Benedikt und Korbinian durften nicht lebend aus dem Krieg zurückkehren. Wüsste ich nicht, dass sie es jetzt beim lieben Herrgott guthaben, ich könnte es nicht aushalten. Da wünsche ich nun dir und deiner Familie, lieber Hans, dass deine Mutter recht schnell wieder gesund wird.“
Der junge Mann atmete tief und strich sich eine Haarsträhne aus der Stirn „Ich bin froh, dass meine Schwester Leonore schon so erwaxhsen ist und auch für die Familie mitsorgen kann.“
Die Tante runzelte die Stirn und bediente sich an der Honigdose. „Wollte sie nicht Krankenschwester werden? Vor einiger Zeit hat sie mir etwas davon erzählt.“
Hans seufzte. „Ja, das war einmal. Gemeinsam mit ihrer Schulfreundin Dorothea hatte sie das vorgehabt. Aber der Vater meinte, das ginge nicht. Dann sei sie jetzt zu oft weg vom Hof. Deswegen muss sie nun zu Haus für alles sorgen. Aber die Thea hat es geschafft, die ist jetzt Krankenschwester und besucht meine Mutter ab und zu.“
Tante Tina lächelte. „Ich weiß doch, wie oft du an deiner Mutter denkst, und wie sehr du sie vermisst. Ich habe heute auf dem Hof schon alles vorbereitet und dem Sepp Bescheid gesagt. Der nimmt dich dann mit nach Bruneck, da kannst du dann deine Mutter im Krankenhaus besuchen.“
Hans freute sich, doch er hatte Bedenken. „Schafft ihr das wirklich alles allein heute mit den Kühen und all den anderen Tieren?!“
Filippa lächelte. „Geh du nur! Ich helfe der Mutter schon. Schließlich bin ich ja auch schon groß mit meinen fünfzehn Jahren. In diesem Alter wurden andere früher schon verheiratet.“
Frau Veitl lachte. „Da hast du aber noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, dir hat noch keiner den Kopf verdreht!“
Das junge Mädchen blickte verschämt nach unten. „Wo denkst du hin?!“ Schnell lenkte sie vom Thema ab und wandte sich an Hans. „Ich hab für deine Mutter einen Kuchen gebacken und ein paar Taschentücher bestickt. Die kannst du ihr mitnehmen.“
Der junge Mann freute sich. „Wie schön, dass du an meine Mutter gedacht hast!“ Er wandte sich an die Tante. „Bist du mir sehr böse, wenn ich jetzt das Essen beende und schon alles zusammenpacke, damit ich dem Sepp entgegengehen kann?“
Frau Veitl schmunzelte. „Na geht schon! Ich hab dir eine Wegzehrung mit eingepackt. Damit wirst du schon nicht verhungern.“
Hans bedankte sich bei Filippa und der Tante, eilte in seine Stube, und packte rasch alles zusammen. Nach einem kurzen Abschiedsgruß machte er sich durch den hohen Schnee auf zum Benderhof. Der Schnee knirschte unter seinen Füßen, es klang, wie ein Protest der weißen Natur. Als er auf dem Hügel ankam, war Sepp gerade damit beschäftigt, die Pferde einzuspannen.