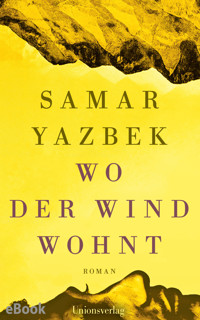11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen sehe" - mit diesem Vorsatz nimmt die Journalistin Samar Yazbek an der Revolution gegen das Regime al-Assads in Syrien teil. Sie geht auf die Straße, befragt Demonstranten, aus der Haft entlassene Dissidenten, aber auch Polizisten. Bald wird sie selbst in die Ereignisse hineingezogen und mehrmals verhaftet und misshandelt. In eindringlichen Bildern erzählt Yazbek von Protest, Folter und Verzweiflung in Arabien. Als sie erfährt, dass ihr Name auf einer Todesliste steht, flieht sie mit ihrer Tochter ins Ausland. Yazbeks Erlebnisbericht ist ein erschütterndes, sprachlich brillantes Dokument über Widerstand und Menschlichkeit. Mit einem Vorwort von Rafik Schami.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Nagel & Kimche eBook
Samar Yazbek
Schrei nach Freiheit
Bericht aus dem
Inneren der syrischen Revolution
Mit einem Vorwort von Rafik Schami
Aus dem Arabischen übertragen
von Larissa Bender
Nagel & Kimche
© 2011 Samar Yazbek
Poesie der Wunde: © 2012 Rafik Schami
Die Übersetzerin dankt dem Europäischen Übersetzerkollegium
Straelen für die Unterstützung.
© 2012 Nagel & Kimche
im Carl Hanser Verlag München
Herstellung: Andrea Mogwitz und Rainald Schwarz
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann
ISBN 978-3-312-00534-5
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Poesie der Wunde
Manchmal ist die Wirklichkeit phantastischer als jede der Phantasie entsprungene Geschichte. Ein begnadeter Dokumentarfilmer kann, gemeinsam mit einem fähigen Kameramann, ein Ereignis in einem großartigen Film verarbeiten, der jeden Spielfilm in den Schatten stellt. Dokumentarbücher haben es schwerer, denn es steht nur das Wort zur Verfügung, um den Stoff poetisch zu erhöhen. Diese Fähigkeit besitzen nur wenige. Samar Yazbek ist eine von ihnen.
Hundert Tage lang dokumentierte die syrische Schriftstellerin und Filmemacherin die Revolution in ihrer Heimat aus nächster Nähe. Aber sie war auch aktiv daran beteiligt. Sobald die Situation es zuließ, schrieb sie auf, was sie in den Stunden und Tagen zuvor erlebt, empfunden und gedacht hat, und das in einer eindrücklichen, wortgewaltigen Sprache. Wortgewaltig insofern, als sie trotz der brutalen Morde, trotz der vielen Toten um sie herum, trotz der Angst um sich selbst und ihre Tochter, der Tränen und der Verhöre, mit denen der Geheimdienst sie zu erpressen versuchte, poetisch schreibt. Diese Poesie erlaubt uns, den Leserinnen und Lesern, in Samar Yazbeks Begleitung den Aufstand hautnah mitzuerleben, ohne erdrückt zu werden oder in Atemnot zu geraten.
Samar Yazbek war eine aktive Zeugin. Und während sie ihr Leben aufs Spiel setzte, half sie verfolgten Demonstranten, tröstete Kinder, deren Eltern verhaftet wurden. Aber noch eindrücklicher als dieser Mut war und ist ihre Haltung gegenüber ihrer Sippe und der alawitischen Minderheit, durch die sie ihr Leben gefährdet. In ihrer Heimatstadt wurde sie öffentlich als Verräterin verurteilt. Das gab den Killer-Schwadronen mit dem neuen Namen «Schabbiha» grünes Licht, die das Assad-Regime auf die Syrer losgelassen hatte. Es sind Mörder, Kriminelle, die für einen geringen Lohn zu Söldnern werden und die Drecksarbeit erledigen. Sie ermorden jeden, ohne mit der Wimper zu zucken. Samar Yazbek musste sich äußerst vorsichtig bewegen. Jeder Schritt auf der Straße konnte ihr letzter sein.
Woher nimmt eine Frau den Mut, wirft all die Sicherheiten einer wohlhabenden alawitischen Familie über Bord und solidarisiert sich mit den Gedemütigten? Man kann sich die Enttäuschung ihrer Familie vorstellen, die ganz andere Erwartungen an sie gerichtet hatte.
Samar Yazbek wurde 1970 in der Küstenstadt Dschableh in eine angesehene alawitische Familie hineingeboren – in jenem Jahr, als Vater Assad gegen seine eigenen Genossen putschte, um eine nie da gewesene Art von Diktatur zu errichten, die auf einer Sippen- und Religionszugehörigkeit basierte. Syrien, das lebendige Land, wurde in eine Farm der Sippe Assad verwandelt.
Samar Yazbek gehört also einer Generation an, die kein anderes als das existierende politische System kennengelernt hat. Sie schrieb Kurzgeschichten und Drehbücher für Fernsehserien (auch für das Staatsfernsehen) und drehte Dokumentarfilme, aber berühmt wurde sie durch ihre Romane, von denen nur wenige in andere Sprachen (Italienisch und Französisch) übersetzt wurden. In diesen Romanen überschritt Samar Yazbek Grenzen, ließ alle Verbote außer Acht. Sie schrieb über verbotene Liebe und korrumpierte Militärs, über die Enge innerhalb der Sippe und die Heuchelei. Die professionellen Hüter der Moral verschonten sie nicht mit harscher Kritik. Aber sie war privilegiert, und man bestrafte sie nicht.
Samar Yazbek war auch als Frauenrechtlerin und Kulturschaffende aktiv. Ihre Abstammung und ihre privaten Beziehungen ließen ihr gewisse Freiheiten, die andere nicht hatten, aber sie ließ sich deswegen nicht blenden. Sie trat bereits lange vor dem Ausbruch der Revolution am 15. März 2011 mutig auf. Ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Schwachen und Entrechteten führten unter Assad, der keinen Widerspruch duldete, zur Konfrontation. Samar Yazbek schloss sich schnell der Protestbewegung an.
Das Assad-Regime hatte noch ein Auge zugedrückt, wenn ein Autor oder eine Autorin verbotenerweise erotische Passagen in einen Roman einfließen ließ. Das liegt daran, dass der Herrscher-Clan niemals religiös war. Es war nichts als Heuchelei, wenn der alawitische Präsident in der Omajjaden-Moschee mit dem sunnitischen Mufti betete. Kein Alawit nahm ihm diese Show ab, denn die Omajjaden waren mit Ali, dem Schwiegersohn des Propheten Muhammad und Namensgeber der Alawiten, tief verfeindet.
Doch jetzt wurde die Situation weitaus bedenklicher. Denn wenn Intellektuelle in Aktion treten, wird es für das Regime gefährlich. Gehören sie gar der Minderheit der Alawiten an, so gelten sie als doppelt gefährlich. Die Alawiten werden härter bestraft, wenn sie, statt blinden Gehorsam zu zeigen, in den Widerstand gehen, statt loyal zu sein, sich als Gegner des Regimes bekennen. So wird klar, warum Samar Yazbek jetzt alle Privilegien verlor und zur Verräterin gestempelt wurde.
Um aber Samar Yazbeks Haltung und ihr Buch richtig würdigen zu können, muss man den syrischen Diktator eingehender betrachten.
Der Assad-Clan hält in seinem Land, auf seiner «Farm» 20 Millionen Syrer gefangen. Und er ist selbst Gefangener seines Systems. Baschar al-Assad lügt, wenn er Reformen verspricht, nicht aus Spaß, sondern weil er nicht anders kann. Der erste Schritt der Reform hieße nämlich: die Auflösung aller fünfzehn Geheimdienste, Freilassung aller fast 100 000 politischen Gefangenen und Bestrafung der Mörder von über 4000 unschuldigen Menschen. Solange das nicht geschieht, ist es absurd, über die Erhöhung der Gehälter und die Verbesserung der Krankenversicherung zu reden. Aber die Auflösung der Geheimdienste würde den Sturz des Regimes bedeuten.
Assad versprach mehrmals, die Armee und die Scharfschützen aus den Städten abzuziehen. Er brach sein Wort, denn er wusste und weiß, dass diese Städte eine Stunde später von den Revolutionären kontrolliert würden. Deshalb ist bislang nicht ein einziger Panzer, nicht ein einziger Scharfschütze weniger im Einsatz. Elf Jahre lang hätte er eine Reform vorantreiben können, aber das vom Vater geerbte Unrecht hat sich um keinen Deut verändert. Wie soll ihm jetzt binnen weniger Wochen ein solches Unterfangen gelingen? Unmöglich!
Man muss wissen: Ein arabischer Diktator wird als Held geboren. Er heiligt seine Mutter und seinen Vater, weil sie ihm, dieser historischen Ausnahme, das Leben ermöglicht haben. Er lebt als «Herrscher für die Ewigkeit». Und er stirbt als Heiliger, auch wenn er durch Krankheit (wie Vater Assad) oder einen Autounfall (wie Bassel al-Assad, der Bruder) den Tod findet.
Dass Assad, Saddam Hussein, Gaddafi und der jemenitische Ali Saleh in bitterem Elend aufwuchsen und ihr Abitur mit Müh und Not bestanden, das verdrängten sie. Sie verbanden sich mit dem Teufel, um an die Macht zu kommen. Sie zerstörten den Staat und bauten etwas auf, was aus der Ferne ähnlich aussieht: Ein mafiöses Netz der Herrschaft, das es ihnen erlaubte, das Land zu knechten. Alle Ämter an der Spitze der Macht wurden von Brüdern, Cousins, Schwägern und Schwiegersöhnen besetzt. Reichte die eigene Sippe nicht aus, bediente man sich der Anhänger aus befreundeten Sippen, der Nachbarn und der Freunde aus Kindheitstagen. So entstand Schicht für Schicht eine korrupte Pyramide der Macht. Ganz unten ist das Volk. Je länger sich ein Regime an der Macht hält, desto dichter wird das Netz, desto besser ist es gegen Angriffe gewappnet. Das Assad-Regime regiert blutig seit vierzig Jahren – nach der ersten bereits ergrauten Generation der Putschisten inzwischen in der zweiten und dritten Generation des Clans.
Aber Vater Assad war viel zu klug, um zu übersehen, dass die Alawiten allein auf Dauer keine Chance haben zu regieren. Deshalb beteiligte er die große Sippe der Sunniten, aber immer nur so, dass sie zwar wirtschaftliche Nutznießer waren, aber politisch nichts zu sagen hatten. Deshalb ist es auch widersinnig, wenn Islamisten in fast rassistischer Manier auf die Alawiten allein schimpfen. Dennoch bleibt das System hierarchisch. Ein sunnitischer oder christlicher General fürchtet sich vor einem alawitischen Unteroffizier. Und das ist kein Gesetz des Militärs, sondern eines der Mafia.
In einem solchen System ist Loyalität die einzige Möglichkeit, um an der Macht zu partizipieren. So ist es nicht verwunderlich, dass bald nur noch Claqueure mitregierten, die schnell gelernt hatten, dass der Präsident nichts als Zustimmung hören wollte. Seine Porträts und Denkmäler wurden von Jahr zu Jahr größer, alle wichtigen Errungenschaften wurden nach ihm benannt, der Stausee am Euphrat etwa oder die Nationalbibliothek. Bücher über seine Heldentaten, die es ja gar nicht gab, füllten die Regale, Loblieder entstanden. Die Medien knieten vor ihm nieder, und aus dieser Perspektive wurde er zu einem Riesen. Wie sollten und sollen da Charaktere wie Gaddafi, Saddam Hussein oder Assad (Vater wie auch Sohn) an ihrer eigenen Genialität noch zweifeln.
Die arabischen Diktatoren stürzten ihre Länder ins Elend, aber anders als den europäischen Diktatoren, von Mussolini und Hitler über Stalin zu Honecker, die vor allem machtbesessen waren, genügte ihnen die absolute Macht nicht. Die arabischen Diktatoren sicherten sich zudem mit einem milliardenschweren Vermögen ab, das sie dem Land raubten und in den Banken ihrer offiziellen «Feinde» bunkerten. Es ist vollkommen absurd, dass sich der Assad-Clan als Gegner der Amerikaner gibt. Und die USA spielen das dumme Spiel auch noch mit. Hinter den Kulissen aber kooperiert der syrische Geheimdienst mit der CIA, und die Assads, Makhloufs und Schallahs und wie die syrischen Räuber auch alle heißen, bringen ihre Beute nach Amerika. Nicht eine Million, nicht hundert Millionen, sondern gleich hundert Milliarden, und mit der Armut, die im eigenen Land Einzug hält, werden die stolzen Bewohner gedemütigt. Gleichzeitig schämt sich das Regime nicht, bei der EU einen Antrag auf fünf oder zehn Millionen Euro Unterstützung für die Entwicklung der Dorfstrukturen zu stellen.
Die arabischen Länder verkommen in sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht. Zwar hilft vor allem das Erdöl, gerade den wirtschaftlichen Ruin zu tarnen. Aber Syrien, der Irak, Libyen und Ägypten sind im Grunde in allen Bereichen bankrott. Die Armut wird mit allen Mitteln kaschiert. Gleichzeitig bereichert sich eine dünne oberste Schicht, ähnlich wie beim verbündeten Russland, in so astronomischem Ausmaß, dass es fast an ein Märchen aus der Boulevard-Presse erinnert. Der Cousin von Baschar al-Assad, Rami Makhlouf, war bereits vor seinem dreißigsten Lebensjahr Milliardär. Er bekam vom Präsidenten die Telekommunikation des Landes übertragen und kassierte mit seiner Hydra von jedem Import oder Export, weshalb ihn die Syrer «Mister zwanzig Prozent» nennen.
Wohin man schaut, Korruption und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung. Ein Heer von Dichtern und Journalisten lebt davon, als Handlanger der Geheimdienste die kulturelle Peitsche des Regimes gegen seine Gegner zu schwingen. Der Schriftstellerverband ist eine Abteilung der Propaganda und des Geheimdienstes. Das Kulturministerium wird direkt vom Geheimdienst geführt.
Und der Westen? Er spielte charakterlos mit, lieferte Waffen und Überwachungssysteme, kooperierte mit den Regimen, bunkerte deren geraubtes Geld, verschloss die Augen vor tausendfachen Morden und wurde seiner Freiheit und Demokratie unwürdig. Dass der spanische Sozialist Zapatero, Enkelkind eines ehrenhaften Kämpfers für die Republik, den Onkel des Präsidenten Assad, Rifaat al-Assad, einen Massenmörder, dem über 30 000 Morde angelastet werden, bei sich beherbergt, ist nur ein vorläufiger Höhepunkt der Skandale. Es werden weitere aufgedeckt werden, sobald die Revolutionäre noch mehr Geheimakten ans Licht bringen.
Auch einige charakterlose deutschsprachige Intellektuelle beugten sich vor dem Geld. Statt der Diktatur bekämpften sie die Exilautoren. Und manch einer schämte sich über Jahre hinweg und sogar bis in die Gegenwart der Revolution hinein nicht, für das Regime zu werben.
Mit der Vollendung des mafiösen Netzwerks hat das Regime die Gesellschaft durch Gewalt, Korruption, Lüge und Heuchelei zum Schweigen oder Mitmachen verurteilt. Es duldete keinen Widerspruch, und jede Kritik wurde als Gotteslästerung gewertet. Die Kritiker wurden ermordet, verhaftet, gedemütigt, gleich welchen sozialen Rang sie innehatten. Auch die Verbündeten entkamen nicht, wenn sie Kritik äußerten. Angeblich begingen sie Selbstmord. Tausende von Oppositionellen wurden ermordet, Hunderttausende wurden ohne Gerichtsurteil und ohne Rechtsbeistand in Gefangenenlager gesteckt und manchmal bis zu zwanzig Jahre gefangen gehalten. Über fünfzigtausend oppositionelle Intellektuelle und Akademiker mussten das Land verlassen. Die Armut trieb fast eine Million Syrer ins Ausland. In einem solchen Land wird Widerstand unmöglich. Touristen lobten die Ruhe im Land. Sie ahnten nicht, dass es eigentlich eine Friedhofsruhe war.
Die geschilderte Eigenart der arabischen Diktaturen, speziell der syrischen Variante, zeigt, dass die Diktatoren von Ben Ali bis Baschar al-Assad abgeschottet an der Spitze einer Machtpyramide regieren. Und das ist der Grund, warum sie nicht glauben wollten und konnten, dass sich ein Heer von Sklaven, die sie «Insekten» und «Ratten» nannten, trotz all der einschüchternden Maßnahmen erhob. So etwas Ergreifendes wie eine friedliche Revolution kann Baschar al-Assad nicht nachvollziehen, und deshalb lastet er dem Westen die Schuld dafür an. Er offenbart damit ungewollt eine der Spätfolgen des Kolonialismus. Die Syrer sind in seiner krankhaften Vorstellung primitiv, und wenn trotz der fünfzehn Geheimdienste und der gut 250 000 Spitzel etwas so Perfektes, so Schönes, so genial Organisiertes zustande kommt, dann müssen die Europäer dahinterstecken. Denn sie sind die Überlegenen. Das haben sie als Kolonialisten seinen Eltern zumindest eingebläut. Er gibt es nur wieder.
Davon, wie es im Bauch des Walfischs, Volk genannt, rumorte, ahnte ich bis zum 15. März 2011 nicht das Geringste. Niemand ahnte etwas. Die Diktatur nicht, der Geheimdienst nicht, die Opposition nicht und auch die Exilanten nicht. Wer etwas anderes behauptet, lügt.
An diesem Tag wurde der erste Buchstabe einer neuen, nie da gewesenen friedlichen Revolution geschrieben. Sie begann in Deraa, einer staubigen armen Stadt im Süden. Jugendliche sprayten arglos das an die Wände, was wir alle dachten: «Nieder mit der Korruption!»
Der Chef des Geheimdienstes in der Stadt, Atef Nadschib, ein Cousin ersten Grades des Präsidenten und berühmt für seine Bestechlichkeit und seine sadistische Neigung, höhere sunnitische Offiziere zu demütigen, ließ die Jugendlichen verhaften und bestialisch foltern. Als die Eltern nach ihren Kindern fragten, wurden diese noch mehr gepeinigt. Das brachte das Fass zum Überlaufen. In einer friedlichen Demonstration zeigten sie ihren Unmut. Sie demonstrierten nicht einmal gegen Assad, sondern einfach gegen das große Unrecht, das Atef Nadschib zu verantworten hatte, und gegen die Korruption in der Stadt, an der er beteiligt war. Statt aber zur Vernunft zu kommen, schoss sein Geheimdienst in die Menge.
Und der Präsident? Er schickte Truppen, die auf die Demonstranten schossen und die Stadt umzingelten. Assad ist Oberbefehlshaber aller Geheimdienste und hat als solcher jeden Mord zu verantworten. Die ersten Beerdigungen und das Freitagsgebet wurden zum Ausgangspunkt für Demonstrationen, später fanden die Menschen täglich zusammen.
Der Funke sprang auf andere Städte über. Die Menschen eilten auf die Straße, um sich mit der Stadt Deraa solidarisch zu zeigen und deren Bewohner voller Liebe zu unterstützen. Mancherorts hörte man zum ersten Mal von Deraa. So lernten die Syrer die Geographie ihres Landes kennen, denn an manchen Tagen rebellierte es in bis zu zweihundert Orten, deren Name zuvor niemand gehört hatte. So erging es auch mir, der ich Erdkunde immer langweilig fand.
Samar Yazbek begleitete die Ereignisse aus nächster Nähe, hatte große Angst auch und vor allem um ihre Tochter. Sie tauchte unter, während sie durch das Land fuhr, Aktivisten traf, Geschichten hörte und versuchte, alles aufzuschreiben. In einer schnörkellosen Sprache, denn für Ausschweifungen, für Plaudereien blieb keine Zeit. Das Resultat: poetische Konzentrate.
Doch die Hand des Regimes agierte immer härter. Samar Yazbek wurde verhört und geschlagen. Das Regime schreckte vor keiner Gemeinheit zurück, um sie zu diskreditieren. Auf Flugblättern wurde sie des Verrats beschuldigt, diffamierende Gerüchte wurden in die Welt gesetzt – eine Einladung zur Lynchjustiz. Doch Samar Yazbek wurde nur noch entschlossener.
Es ist ein Wunder der Revolution: Der Einzelne wird zum Ganzen, und das Ganze verkörpert sich in jedem Beteiligten an der Revolution. So wie Samar Yazbek vom Medienliebling zu einer passiven Kämpferin wurde und schließlich zu einer aktiven Untergrundkämpferin, die das Regime und seinen Präsidenten für kriminell erklärte und ihnen den Kampf ansagte, so wurde auch das syrische Volk radikaler und entschlossener, je härter das Regime gegen es vorging.
Als Samar Yazbek spürte, dass sich die Schlinge lebensbedrohlich eng zuzog, flüchtete sie. Sie rettete sich, ihre Tochter und die Tagebücher der Revolution.
Erst durch ihren Bericht wird eine breite Öffentlichkeit aus erster Hand erfahren, was in Damaskus und den anderen Städten alles geschah. Sie wird erfahren, dass trotz massivster Präsenz der Geheimdienste und des Militärs wunderbare Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen und auf die Straße gehen, obwohl Damaskus-City für die Widerstandskämpferinnen und -kämpfer sehr gefährlich ist. Denn der Geheimdienst durchkämmt, wie Samar Yabek detailliert beschreibt, die Straßen auf der Suche nach Unruhestiftern. Orwell und Ray Bradbury lassen grüßen.
Die Syrer haben seit dem 15. März 2011 eine neue Art von Revolution entwickelt, eine mutige, aber friedliche Art. Und Samar Yazbek ist die Chronistin dieser Revolution.
Rafik Schami, Frühjahr 2012
Im Kreuzfeuer befindet sich eine Person oder eine kämpfende oder eine politische Gruppierung, wenn sie von mehreren Seiten beschossen wird, vom Feind wie vom Freund.
S. Y.
Dieses Tagebuch ist keine unmittelbare Dokumentation von vier Monaten syrischen Aufstands. Es sind nur Worte, die mir in jenen Tagen halfen, der Angst die Stirn zu bieten. Doch es sind wahre, reale Worte, die nicht der Phantasie entspringen.
Freitag, 25. März 2011
Es stimmt nicht, dass der Tod, wenn er kommt, deine Augen haben wird!
Es stimmt absolut nicht, dass der Wunsch nach Liebe und der Wunsch nach dem Tod einander gleichen. Vielleicht gleichen sich die beiden Wünsche in der Sehnsucht nach Auflösung. Die Gedanken der Menschen waren schon immer erhabener als ihre leibliche Existenz. Wie sonst ist die Heiligkeit unserer Toten zu erklären? Es kann passieren, dass einer, der gerade noch unter uns weilte, verschwindet und sich sofort in reinen Glanz verwandelt.
Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt ruhig bin. Aber ich bin tatsächlich ganz still. Ich höre meine Herzschläge wie weit entfernte Explosionen, deutlicher immerhin als die Schüsse und das Schreien der jungen Männer, das Klagen der Mütter. Deutlicher als die zitternde Stimme meiner Mutter, die mich anfleht, nicht auf die Straße zu gehen, weil die Mörder überall sind. Der Tod ist überall. Im Dorf. In der Stadt. Am Strand. Die Mörder eignen sich jeden Ort an, versetzen seine Menschen in Angst und Schrecken, verteilen sich vor den Häusern der Nachbarn und reden ihnen ein, dass wir sie töten werden. Dann kommen sie zu uns und schreien: «Die werden euch umbringen.»
Ich bin die Fremde an diesem Ort. Ich bin fremd im Leben. Wie ein wildes Tier bin ich im Nichts geschwommen. Ich schlug um mich, hatte nichts bis auf die Freiheit meines Daseins. Seit die Protestbewegung hier begonnen hat, schaue ich aus dem Fenster und beobachte. Meine Stimme erhebt sich nicht, ich wollte nur sehen. Im Dickicht der Details hatte ich nicht gemerkt, dass diese Gleichgültigkeit mich zu einer sehr strengen und zerbrechlichen Frau machen würde! Und dass ich mich mit derart viel Angst ans Leben klammern würde. Angst wovor? Wie haben die Menschen hier Angst? Sie wissen nicht, dass sie die Angst geradezu leben; die Angst gehört dazu wie das Atmen. Seit ich vor fünfzehn Jahren mit meiner Tochter in die Hauptstadt gezogen bin, trage ich stets ein Messer in meiner Handtasche. Ich habe es überall dabei; ein kleines scharfes Klappmesser mit einem Druckknopf. Ein Messer zur Selbstverteidigung. Vor Jahren habe ich gesagt: Ich werde es demjenigen in den Leib rammen, der mich zu beleidigen versucht, weil ich eine alleinstehende Frau bin. Ich habe es nur ein paar Mal benutzt, habe es verblüfften Männern ins Gesicht gestreckt. Doch seit kurzem sage ich mir: Bevor ich zulasse, dass meine Würde beleidigt wird, steche ich mir dieses Messer ins eigene Herz.
Was bedeutet all das, jetzt, angesichts dieser Todesparty? Auf die Straße zu gehen, heißt, vielleicht zu sterben. Ich hatte diese Vorstellung, durch die Straße zu gehen und das Gefühl zu haben, jeden Moment getötet werden zu können. Eine abstruse Vorstellung, aber es ist tatsächlich seltsam, mit Freunden zum Demonstrieren zu gehen und zu wissen, dass die Sicherheitskräfte dich dort jeden Augenblick erschießen können. Die Sicherheitskräfte, die die Menschen seit Jahrzehnten in den Nacken treten, sie zu Huren machen, zu Verrätern, die sie einsperren. Die sie töten und dann vollkommen kaltblütig selbst durch die Straßen gehen.
Wie wird der menschliche Körper zu einer Tötungsmaschine? Die Hände, die Augen, das Haar, der Kopf. All diese Körperteile, die aussehen wie deine – wie verwandeln sie sich in riesige Fühler und lange Stoßzähne? Einfach so, in einem einzigen Augenblick, verwandelt sich die Realität in eine groteske Phantasie. Die Realität ist dann aber noch grausamer. Es heißt, für das Schreiben eines Romans brauche man Phantasie, und ich sage, man braucht vor allem die Realität. Was wir in unseren Romanen schreiben, ist weniger grausam als das, was auf dem Boden der Wirklichkeit geschieht.
Buthaina Schaaban, die Beraterin des Präsidenten, erscheint auf den Bildschirmen. Meine Mutter sagt: «Hört zu! Sie spricht über Verräter und über einen Krieg der Religionsgemeinschaften. Wehe uns! Schließt die Fenster!» Dann erscheinen wieder die Bilder von den gequälten Kindern und getöteten jungen Männern. Das Gesicht eines Kindes kommt mir in den Sinn, das ich auf dem Mardscheh-Platz in den Armen hielt, während es zusah, wie seine Familie geschlagen und verhaftet wurde. Ich höre einen Mann im Fernsehen über das Blut der Getöteten von Deraa sprechen. Er fordert Rache. Dann sagt er: «Wir werden dieser Frau [er meint Buthaina Schaaban] nicht antworten, wir antworten Frauen nicht.» Stimmt es überhaupt, dass wir auf eine Frau hören? Was da alles passiert, hat nichts mit mir zu tun: der Jubel meiner Familie über diese Frau, der Jubel meiner Freunde über das Blut der Getöteten. Ich schäme mich angesichts des Bluts der Toten und krümme mich vor Schmerz. O Herr der Himmel, wenn sich herausstellt, dass du wirklich dort sitzt und nicht herunterkommen willst, um zu sehen, was geschieht, wenn Menschen Fehler begehen dann, strecke ich meine Arme zu dir aus und hole dich eigenhändig aus deinen sieben Himmeln, damit du siehst und hörst!
Ich gehe auf den Balkon, die Zitronenbäume erquicken mich. Für einige Augenblicke ist es ruhig, dann bricht das Feuer aus. Alle wissen, dass in dieser Stadt Ruhe herrschte. Keine natürliche Ruhe, denn die Macht der Sicherheitsapparate ist groß, und niemand kann einfach so Unruhe stiften. Die Geheimdienstler sind überall, immer. Ganz plötzlich verwandeln sich die Straßen in einen Karneval des Schreckens. Ganz plötzlich stellt sich das Chaos ein. Die Geheimdienstler beobachten die Leute – manchen gelingt es zu fliehen, manche werden auf unbegreifliche Art getötet! Die Banden, die plötzlich wie aus dem Nichts auftauchten, entsprangen – wie alles, was hier passiert – der Leere, ohne Logik und ohne Grund! Woher kamen diese bewaffneten Männer, die die Menschen töten? Wie konnte all das geschehen?, fragen sich die Leute. Ich, die Fremde hier, beobachte erschreckt das Geschehen. Ich, die Verbannte, verbannt aus der Stadt, aus dem Dorf, von der Luft des Meeres, ich spüre die strengen Blicke von allen. Von allen Seiten. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne das andere Leben in Damaskus. Dort, wo sich die Stadt in ein Dorf verwandelte!
Was tue ich hier? Warte ich auf den Tod? Wieder entflammt der Konflikt: Da sind sie erneut, die Saboteure, die sich eingeschlichen haben. Ich mache mich klein. Ich habe mich jetzt bei meiner Familie eingeschlichen. In mein Bett eingeschlichen. Ich schleiche mich derzeit überall ein. Und ich bin nichts. Ich bin der Haufen Fleisch, der sich unter der Decke zusammenkauert. Ich schleiche mich sogar in die Adern des Straßenasphalts ein! Ich schleiche mich in die Trauer eines jeden Syrers ein, der vor meinen Augen vorbeigeht. Und ich höre das Geräusch der Schüsse und Gebete. Ich bin der Klumpen Fleisch, der am Morgen von Haus zu Haus geht und versucht, eine letzte Lösung zu finden, der vorgibt, irgendetwas zu tun, das ihm hilft zu glauben, Gerechtigkeit könne herbeigewünscht werden. Aber was bedeutet das jetzt? Nichts! Alle Parolen und alle Schmerzen und der ganze Hass, der zum Morden und zum Sterben anstachelt, bedeuten jetzt nichts angesichts dieser Realität: Die Straßen sind leer, es ist eine Geisterstadt. Kriegsgerät steht überall, aber es gibt kein Militär. Wohin ist die Armee verschwunden? Und wer glaubt diesen Schwindel jetzt? Das Militär lässt es zu, dass die bewaffneten Banden die Menschen einschüchtern und ermorden, es greift nicht ein. Die Geheimdienstler, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben, sind angesichts dieser Banden plötzlich unwirksam geworden.
Was ist das für ein Wahnsinn? Es ist der Tod, das Wesen, das sich jetzt auf zwei Beinen fortbewegt. Ich höre und sehe ihn. Ich bin es, die Bekanntschaft mit ihm gemacht hat, ich bin es, die das Gefühl des Messers im Nacken kennt, das Gefühl der Stiefel im Nacken. Ich kenne ihn seit langer Zeit, seit meiner ersten Flucht aus dieser engen Welt, seit meiner zweiten und dritten Flucht. Ich bin ein Verrat an meiner Gesellschaft und meiner Religionsgemeinschaft. Ich habe keine Angst mehr. Aber nicht, weil ich mutig wäre. Ich bin außerordentlich zerbrechlich. Es ist einfach die Gewohnheit!
Heute ist der «Freitag der Würde». In den syrischen Städten gehen die Menschen auf die Straßen. Mehr als zweihunderttausend Demonstranten tragen in Deraa ihre Toten zu Grabe. Die Menschen aus den Dörfern im Umland von Deraa marschieren in Massen zum südlich gelegenen Friedhof. Fünfzehn Menschen werden getötet. In der Stadt Homs drei Tote, in Latakia Tote und Verwundete, in der Hauptstadt Damaskus im Midan-Viertel demonstrieren die Menschen; die Verletzten werden ins Mudschtahid-Krankenhaus gebracht. Militäreinheiten umzingeln Deraa und schießen auf alles, was sich bewegt. In Sanamein verübt der militärische Geheimdienst ein Massaker und tötet zwanzig Bewohner.
Ich fürchte den Tod nicht mehr! Wir atmen den Tod. In aller Ruhe erwarte ich ihn, rauchend und Kaffee trinkend. Ich denke darüber nach, dass ich dem Scharfschützen auf dem Dach ins Auge blicken kann. Ohne mit der Wimper zu zucken, starre ich ihn an. Ich gehe auf die Straßen und schaue zu den Dächern der Gebäude hinauf. Ganz gemächlich bewege ich mich vorwärts. Ich gehe die Bürgersteige entlang und überquere einen der Plätze, ich überlege, wo der Scharfschütze jetzt stecken könnte. Ich denke darüber nach, einen Roman über einen Heckenschützen zu schreiben, der eine Frau beobachtet, die ganz ruhig durch die Straße läuft. Ich stelle sie mir als zwei einsame Helden in einer Geisterstadt vor.
Ich kehre in die Hauptstadt zurück, und ich weiß, dass dieser Ort nicht mehr so sein wird wie früher. Das Leben hat sich hier auf einen Schlag für immer verändert. Ich kehre zurück, und ich weiß, dass ich nicht aufhören werde, Gerechtigkeit zu suchen, selbst wenn ich meine Brust dem Tod entgegenstrecke. Noch einmal: Es ist die Gewohnheit, nicht mehr und nicht weniger. Ich warte auf ihn, und ich werde keine Blumen an mein Grab tragen.
Dienstag, 5. April 2011
Ich werde mich in den Schlaf der Mörder einschleichen. Ich werde sie fragen: Habt ihr den Toten in die Augen gesehen, als sich die Kugel ihrer Brust näherte? Habt ihr das Loch des Todes gesehen? Seht euch die roten Löcher in den Stirnen und Bäuchen an. Hier in Damaskus, wo die Augen der Mörder bald schlafen werden, während wir bekümmert wachen.
Wie eine Frau nach der Liebe gewinnt auch Damaskus in der Nacht an Schönheit. Heute aber kleidet sie sich nicht in ihr Dunkelblau, sondern in ein zart fliederfarbenes Gewand, damit wir die Augen der Mörder erkennen können, die sich in den Straßen verteilen und die wir nur schemenhaft wahrnehmen.
Wer tötet? Wer steckt auf den Dächern und hinter den Gebäuden? Ist es ein feiger Mörder? Der Mörder ist feige – wie könnte er mutig sein, wo er doch der moralischen Voraussetzung dazu entbehrt.
Ich verlasse die Wohnung, in Richtung der Plätze der Stadt, der Moscheen. Jetzt, zur Mittagszeit, muss ich wissen, wie die Straßen der Stadt aussehen, Straße für Straße, Platz für Platz, ich traue nur meinen eigenen Augen. Die Plätze der Stadt sind menschenleer, vielleicht weil heute Feiertag ist. Alle ziehen sich heute in ihre Angst zurück.
Die Trupps der Geheimdienstler schwärmen in Scharen durch die Straßen, sie sind überall, wohin ich auch gehe. Autos zirkulieren, schnelle Autos und langsame, riesige Busse, die vollgestopft sind mit Sicherheitskräften und Männern in Militäruniformen und behelmt. Sie verteilen sich in den Geschäftsstraßen, auf den Plätzen, den breiten Kreuzungen, an allen Orten, wo Demonstrationen möglich sind.
Auch Männer in Zivil stehen überall herum, aber ihre dichte Präsenz verrät sie. Wie habe ich gelernt, in Damaskus zwischen Geheimdienstlern und normalen Leuten zu unterscheiden? Ich kann tatsächlich nur schwer sagen, wann ich mit diesem Spiel begonnen habe und seit wann meine Intuition Fragen und Reden vorausgeht. Ich erkenne sie an ihren Augen, an der Art, wie sie gekleidet sind. An ihren Schuhen. Die Anzahl der Geheimdienstler übersteigt heute die der normalen Menschen in den Straßen der Stadt, in den Gassen, vor den Kiosken, auf den Plätzen und vor den Schulen. Überall stehen Sicherheitskräfte.
Die Einheiten der Sicherheitskräfte verteilen sich in der Nähe des Eingangs zur Hamidija-Geschäftsstraße, in der Nähe des Bab-Touma-Platzes. Sie halten einige Männer an, kontrollieren sie, nehmen ihnen die Ausweise ab. Ich verschwende keine Zeit damit herauszufinden, ob sie die Ausweise einbehalten. Ich gehe schneller, an ihnen vorbei, beobachte sie aus den Augenwinkeln und biege in eine Gasse ein. Kaum Menschen hier, aber um die Omajjaden-Moschee herum stehen überall Geheimdienstler. Und eine Menschenmenge, die Fahnen und das Bild des Präsidenten hochhält.
Die Moschee ist geschlossen, ich komme nicht hinein. Es heißt, drinnen würden die Menschen beten. Ich setze mich, rauche in aller Ruhe und beobachte. Dann ziehe ich mich zurück.
Plötzlich sehe ich seltsame Gestalten in den Straßen. Kerle mit breitem Kreuz und aufgeblähten Oberkörpern, in schwarzen Hemden mit kurzen Ärmeln, mit strammen Muskeln, tätowiert, dazu geschorene Schädel, aus denen die Kerle alles anglotzen. Beim Gehen schaukeln ihre Arme hin und her und setzen schwere Luft in Bewegung. Gestalten, die einen das Fürchten lehren. Wo sind diese Typen vorher gewesen? Wo haben sie gelebt? Woher sind sie so plötzlich aufgetaucht?
Ich gehe in Richtung Hamidija-Geschäftsstraße. Sie ist fast leer, nur einige Straßenhändler bieten ihre Waren feil. Die Läden sind geschlossen. Geheimdienstler streifen durch den Suk. An dessen Ende stehen wieder Busse voller bewaffneter Männer. Ich weiß jetzt, was «wachsame Stille» bedeutet. Ich hatte diesen Ausdruck gehört und für eine Worthülse gehalten. In diesen Tagen in Damaskus lerne ich die Bedeutung von «wachsamer Stille» in den Augen und Bewegungen der Menschen kennen. Ich verlasse die Hamidija-Straße in Richtung Mardscheh-Platz – obwohl ich mir nach dem Vorfall vor dem Innenministerium vorgenommen habe, nicht mehr dort entlangzugehen.
Auf dem Mardscheh-Platz drängen sich auffallend viele Geheimdienstler, ansonsten ist der Platz leer. Nicht weit entfernt wieder ein Bus voller bewaffneter Männer. Der Mardscheh-Platz mit seinen armseligen Hotels ist viel deutlicher zu erkennen, wenn die Menschen fort und die Läden geschlossen sind. Er sieht jetzt vollkommen anders aus als an jenem 16. März, als Dutzende Angehörige von Gefangenen sich vor dem Innenministerium versammelten. Es war ein seltsamer Anblick. Sie sahen würdevoll aus, wie sie still dastanden, in den Händen die Fotos ihrer Angehörigen, die wegen ihrer politischen Ansichten im Gefängnis saßen. Ich stellte mich zu ihnen, neben den Ehemann und die beiden Kinder einer Gefangenen. Plötzlich tat sich die Erde auf, Geheimdienstler und Schabbiha brachen hervor und begannen, auf die Leute einzuschlagen. Die kleine Gruppe bekam es mit der Angst zu tun, die Leute schrien: «Wer sein eigenes Volk tötet, ist ein Verräter!» Ich blickte in ihre Gesichter. Sie wehrten sich nicht. Sie nahmen die Schläge und Beleidigungen entgegen und verschwanden dann einer nach dem anderen. Die Männer, die plötzlich von den Straßen ausgespuckt worden waren, nahmen sie einfach mit. Männer mit dicken Ringen, aufgeblähten Muskeln, müden Augen und rissiger Haut. Sie bildeten einen menschlichen Wall und griffen sich die Demonstranten, sie schlugen sie, warfen sie zu Boden und traten auf sie ein. Andere Männer tauchten auf und brachten einige Demonstranten weg, versteckten sie. Ich sah, wie sie einen der Läden öffneten und eine Frau hineinstießen, die Eisentür hinter ihr schlossen und zu einer anderen Frau liefen, um ihr zu helfen.
Die Gruppe, die anfangs versucht hatte zusammenzubleiben, löste sich auf. Der Ehemann der Gefangenen neben mir ließ seinen vierjährigen Sohn bei mir zurück. Zahlreiche Männer packten den Vater und den zehnjährigen Sohn. Ich stand vollkommen erstarrt da und drückte den Kleinen fest an meine Brust, ich kam mir vor wie im Film. Was unterscheidet die Realität von der Phantasie, wo verläuft die Linie? Ich zitterte. Plötzlich bemerkte ich, dass der Kleine mitbekam, wie sein Vater und sein Bruder geschlagen wurden. Er musste zusehen, wie sie in den Bus gestoßen wurden. Das Gesicht des Zehnjährigen war so starr, als hätte er einen Stromschlag erhalten. Eine Faust schnellte vor in Richtung des kleinen Kopfes. Wumm! Sein Kopf pendelte hin und her, und einen Augenblick später traten ihn die Männer zusammen mit seinem Vater in den Bus. Ich riss mich zusammen und drehte das Gesicht des Kleinen in eine andere Richtung, dann begann ich zu laufen. Eine Freundin tauchte plötzlich neben mir auf, sie war gerade erst auf den Platz gekommen. Drei Männer stürzten sich auf sie, ich schrie und versuchte sie festzuhalten, doch sie stießen mich fort, zusammen mit dem Kleinen, der in meinen Armen schaukelte, und nahmen sie mit. Ich lief schneller, blieb neben einem Laden stehen. Der Ladenbesitzer schrie: «Haut ab von hier, wir wollen Geschäfte machen!» Ich floh weiter, einer der Demonstranten begleitete mich, um mir mit dem Kind zu helfen. Warum war ich losgeprescht? Der Kleine bat mich, bei ihm zu bleiben, er wolle auf seinen Vater warten, er habe Angst, weil sein Vater und sein Bruder ihn zurückgelassen hätten, er werde die Polizisten verprügeln, die seinen Bruder geschlagen hätten. Er fragte, ob sie ins Gefängnis gebracht worden seien, wie seine Mutter. Und ich schwieg, ich war unfähig zu antworten. Ich sagte nur: «Du kommst jetzt erst mal mit.»
In Wahrheit war es nicht die Polizei gewesen, die seinen Vater geschlagen hatte. Die Polizisten hatten dagestanden und zugeschaut, wie die Leute geschlagen, getreten, beleidigt und verhaftet wurden. Sie hatten auch dann nicht reagiert, als plötzlich Leute auftauchten, die Bilder des Präsidenten und Fahnen in die Höhe hielten und Parolen skandierten. Diejenigen, die vorher schon herumgeprügelt hatten, schlossen sich ihnen an und droschen nun mit den Fahnenstöcken auf die Leute ein. Abends hieß es, gewisse Leute hätten sich in die Demonstration eingeschlichen, um Zwietracht zu säen, und dass der Innenminister sich die Klagen der Angehörigen der Gefangenen angehört habe. Ich hörte das im syrischen Staatsfernsehen, und die Augen des Kleinen in meinen Armen ließen mich nicht mehr los. Plötzlich stellte ich mir vor, wie er sich zwischen den voranstürmenden Beinen verlor und in den Straßen der Stadt versank, allein, auf der Suche nach seinem Vater und seinem Bruder.
– – –
Nach diesen Ereignissen überquere ich nun den Mardscheh-Platz wieder und nehme diese Schatten hinter den Gittern der mobilen Gefängnisse wahr. Ich besteige ein Taxi zu einer der Moscheen, die, wie ich gehört habe, bis jetzt umstellt sind. Es gibt dort vielleicht gar keine Menschenansammlung, denke ich, vielleicht stimmt das gar nicht und die Medien haben das zusammengelogen! Durch die Scheiben des Autos beobachte ich die Stadt auf der Strecke vom Mardscheh-Platz zum Kafr-Susseh-Kreisel. Auf dem Handy gehe ich ins Internet – dort heißt es, der Kreisel sei umstellt, und das Radio im Auto meldet zur selben Zeit, in der Stadt herrsche Ruhe!
Beim Kafr-Susseh-Kreisel stehen Geheimdienstler. Die Syrer kennen ihre Sicherheitskräfte. Fremde wären überrascht, so viele von diesen Autos überall auf den Plätzen herumstehen zu sehen. Diese hier hindern mich daran, auf den Platz zu kommen: Die Straße sei gesperrt. Wir fahren am Platz vorbei und schlagen uns in die Gassen. In anderen Vierteln scheint es ruhig zu sein. Es gibt Viertel, die weit vom Geschehen entfernt sind, besonders die Viertel der Wohlhabenden. Ich steige aus dem Taxi und gehe Richtung Moschee. Es ist schwierig, näher heranzukommen, überall Motorräder, schrille Stimmen und Parolen. Hohe Geheimdienstoffiziere und Leute, die Fahnen und Präsidentenbilder tragen. Ich frage herum, was los sei. Alle raten mir, Abstand zu halten. Frauen gibt es hier nicht. Einer fragt spöttisch: «Was machen Sie denn hier?» Ich wende mich ab. Die Rufe werden lauter, die Fahnen und Bilder immer höher gestreckt. Der Geheimdienst hat die Moschee regelrecht umzingelt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe hineinzukommen. Die einzige Möglichkeit scheint mir, mich in die Menge mit den Bildern und Fahnen einzuschleichen. Die Idee des Einschleichens, über die Freunde auf Facebook geschrieben haben, reizt mich, aber ich komme keinen einzigen Schritt voran.
Plötzlich finde ich mich zwischen irgendwoher aufgetauchten Männern in Zivil wieder, die einen Jungen schlagen, zu Boden werfen und ihm das Handy wegnehmen. Einige dieser Männer steigen auf die Gebäude um die Moschee herum. Ich höre, sie wollen sichergehen, dass niemand filmt, aber ich kann mir keiner einzigen Information sicher sein. Ich weiß nur, dass dieser Ort von Sicherheitskräften, Polizisten, Offizieren und von Fahnen- und Bilderträgern umstellt ist. Und dass diese Bilderträger selbst Sicherheitskräfte sind; aus ihren Reihen treten Einzelne hervor, die die Demonstranten schlagen und gleich wieder zurückeilen. Die Menschen um die Moschee herum erzählen sich, es gebe Verhandlungen zwischen einem der Scheichs in der Moschee und den Geheimdienstlern, damit die Leute die Moschee ohne Blutvergießen verlassen könnten. Später werde ich erfahren, dass die Demonstranten von der Moschee auf direktem Weg in Gefängnis gebracht wurden. Ich höre mein Herz schlagen, als würde ein Mensch mit mir sprechen. Über mein Herz spüre ich die Gefahr. Mein Herz leitet mich, noch bevor mein Verstand es tut. Ich sehe einen Mann mit dem Bild des Präsidenten und zornigen Augen auf mich zukommen. Ich laufe zum Taxi. Der Mann läuft hinter dem Auto her, drohend. Ich bitte den Fahrer, schneller zu fahren. Der Mann kehrt zu den Fahnenträgern zurück. Der Fahrer sagt: «Hören Sie mal, meine Dame, warum wollen Sie sich denn unbedingt hier beleidigen lassen, die machen doch keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern!»
Ich schweige. Mein Blick vernebelt sich, der Anblick des umstellten Ortes macht mir Angst. Was wird passieren? Ich erhalte Meldungen über Tote in Duma, über die Verhaftung von Freunden. Meldungen über Verletzte und überquellende Krankenhäuser, nachdem die Armee das Feuer eröffnet hat. Von überallher erhalte ich Meldungen. Ich bitte den Fahrer, mich nach Duma zu bringen, damit ich mir die Lage ansehen kann. Der Mann fährt hoch und schreit: «Nein, da gehen Sie nicht hin!»
– – –
Ich habe nur mein Gewissen als Waffe. Es ist mir egal, wenn die Zukunft die Züge eines gemäßigten Islam trägt; und was darüber geredet wird, bedeutet mir nichts. Das Gesicht der Mörder interessiert mich nicht; sogar all das, was erzählt und dementiert wird, interessiert mich nicht. Mir ist jetzt nur wichtig, dass ich kein stummer Teufel bin, wenn das Blut zur Sprache der Menschen wird! Mir ist wichtig, mit eigenen Augen friedliche und unbewaffnete Menschen zu sehen, die geschlagen, inhaftiert und getötet werden, nur weil sie demonstrieren. Ich sehe meine Landsleute ganz einfach fallen wie unreife Pfirsiche!
Der Fahrer verwandelt sich in einen Ratgeber und Prediger: «Die Straße nach Duma ist gesperrt. Die Stadt zu betreten ist verboten.» Ich frage: «Was glauben Sie? Was geht da vor sich?» – «Das geht mich nichts an! Ich halte mich mit Mühe über Wasser.» Ich sage: «Aber die Menschen sterben.» – «Wir alle werden sterben. Möge Gott sich ihrer erbarmen!» Ich sage: «Was würden Sie tun, wenn eines Ihrer Kinder getötet würde?» Er schweigt einen Augenblick, dann schüttelt er den Kopf und antwortet: «Die ganze Welt wäre mir nicht mehr groß genug!» Ich sage: «Ich habe gehört, dass einer der jungen Männer, die in Deraa gestorben sind, in einen Kühlschrank gelegt wurde, als er noch lebte. Als sie seine Leiche rausholten, sahen sie, dass er mit seinem Blut an die Wand geschrieben hatte ‹Man hat mich lebend hier hineingelegt. Ich grüße meine Mutter›.» Er schweigt und schüttelt den Kopf. Ich sage: «Ich hoffe nur, dass das nicht wahr ist.» Er sagt nichts, nur seine Ohren erröten.
Heute gibt es eine Demonstration in der philologischen Fakultät der Universität Damaskus. Man nimmt den Studenten die Handys ab und verhaftet sie. Die Ortschaft Talbisa ist immer noch umstellt, die Telefonverbindung gekappt. Die Bevölkerung nimmt die Leichen ihrer Söhne von den Geheimdienstlern in Empfang. In Muaddamia bei Damaskus reißen die Bewohner das große Bild des Präsidenten Baschar al-Assad ab. Dabei wird ein junger Mann getötet. In Latakia sterben acht Häftlinge bei einem Feuer im Zentralgefängnis.
Da sind wir fast bei mir zu Hause angekommen.
Ich zittere. Ich erkenne, wie Blut nur Blut nach sich zieht. Und ich sehe große Löcher, aus denen das Leben fließt, Löcher, größer noch als das Dasein. Ich sehe sie in der Brust der Getöteten, ohne das Gesicht der Mörder. Als ich zu Hause bin, überlege ich, dass ich mich in den Schlaf der Mörder einschleichen und sie fragen werde, ob sie die Lebenslöcher gesehen haben, als sie auf die nackten Oberkörper der unbewaffneten Männer schossen!
Freitag, 8. April 2011
«Hier ist Damaskus.» Mit diesem Satz aus dem Radio waren wir als Kinder vertraut. Alle Syrer kennen den Klang dieses Satzes. Natürlich ist hier Damaskus. Nachdem die Syrer aus ihren Kleinstädten, Dörfern und Steppen hergekommen sind, hat sich Damaskus zu einem Ort entwickelt, der so selbstverständlich ist wie die täglichen Verrichtungen einer Frau, die, ohne an das Beben der Liebe zu denken, ihrem Ehemann das Abendessen bereitet.
Aber Damaskus ist jetzt nicht mehr hier!
Heute ist Freitag. Der Nieselregen hat aufgehört, die Menschen können hinaus, um auf den Plätzen und in den Moscheen zu demonstrieren. Wer denkt jetzt daran, dass jeder Demonstrant ein potentieller Toter ist?
Der Tod ist ein Spiel mit unklaren Regeln. Dieses Tagebuch macht aus dem Tod ein Gemälde zum Zusammensetzen. Ein rätselhaftes, zerbrechliches Gemälde, aber es stellt sich mir durch die Oberkörper der wehrlosen Männer dar, die beim Demonstrieren den Tod in Kauf nehmen.
Bevor ich das Taxi nach Duma bestieg – einen der Vororte von Damaskus –, dachte ich, dass dieses Tagebuch wie eine Erlösung oder ein Schrei ist. Doch am Ende ist es nichts als eine Ansammlung von Worten, die von meinen Bekannten für mutig gehalten werden. Aber damit liegen sie falsch, denn von dem Moment an, in dem der Wagen sich in Richtung der Demonstration in Bewegung setzte, wurden meine Knie schwach, mein Hals wurde trocken, und ich spürte ein Pochen. Angst ist menschlich, doch der Mensch will der Angst ihr Recht nicht zugestehen. Angst ist eine verborgene Erklärung für eine Bedeutung oder eine Liebe. Angst bedeutet, dass du inmitten all dieser Trümmer noch immer ein Mensch bist.