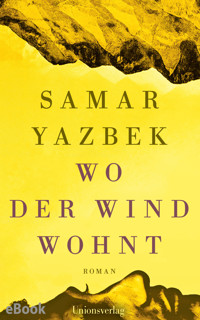10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
2012 erregte Samar Yazbeks Syrien-Bericht "Schrei nach Freiheit" Aufsehen. Yazbek musste fliehen; seither kehrte sie mehrfach heimlich in ihre Heimat zurück und beobachtete, wie sehr sich die Revolution verändert hat: Vom friedlichen Bürgerprotest gegen die Diktatur zum bewaffneten Widerstand, dann zum Bürgerkrieg, immer stärker dominiert von islamistischen Gruppen, bis zum bloßen Albtraum, aus dem der IS den größten Nutzen zieht. Yazbeks Interesse gilt den einzelnen Menschen in diesem Wandel, deren Schicksale sie mit großer Eindringlichkeit beschreibt. Sie sind die Hoffnung Syriens – und das Ergebnis einer Gewaltspirale, die das Land täglich weiter zerstört. Ein wichtiges, dringendes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
N&K
Nagel & Kimche E-Book
SAMAR YAZBEK
Die gestohleneRevolution
REISE IN MEINZERSTÖRTES SYRIEN
Aus dem Arabischen vonLarissa Bender
Nagel & Kimche
Die Übersetzung wurde übersetzt mit Hilfe des
Sharja Book Fair Translation Grant
Titel der Originalausgabe: Bawwabât Ard al Adam
© 2014 Samar Yazbek
© 2015 Nagel & Kimche
im Carl Hanser Verlag München
Umschlag: Hauptmann & Kompanie, Zürich © Fred Froese / Getty Images
ISBN 978-3-312-00685-4
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Ich schreibe mit vierzig Fingern.
Ich schreibe mit blinden Augen.
Ich lebe die Realität. Ich schreibe sie auf – und verschwinde.
Ich bin es, durch deren Kehle die Toten gleiten, einer nach dem anderen, sie rudern in ihrem göttlichen Aufstieg und fallen dann in mein Blut.
Ich bin die Erzählerin, die ihre kurzen Leben betrachtet. Die euch betrachtet, wie wir es in den langen Nächten taten, als wir lachend überlegten: Wen von uns wird die nächste Granate zerreißen? Ich tue das für euch. Ich kann nicht anders, als euch heraufzubeschwören und eure Geschichten in Säulen zu verwandeln, die die Erde mit dem Himmel verbinden.
Ich schreibe euch, ich schreibe für euch und von euch: den Toten der verratenen syrischen Revolution.
Erstes Tor
AUGUST 2012
Der Stacheldraht kratzte mir den Rücken auf. Ein Zittern setzte sich in meinem Kopf fest. Der Stacheldraht, der sich die Grenze entlang erstreckte, war so tief untergraben, dass man darunter durchkriechen konnte. Ich schaffte es, mich durch den Graben zu zwängen, und begann schnell zu laufen. Eine halbe Stunde lang. So lange dauert es, die Grenze zwischen zwei Staaten zu passieren. Damals schlüpften nur wenige Ausländer mit mir über die Grenze. Und ich wusste noch nicht, dass ich diese Geschichten einmal aufzeichnen würde, denn angesichts der Allgegenwärtigkeit des Todes in meiner syrischen Heimat war ich mir nicht sicher, ob ich je wieder von dort zurückkehren würde. Doch in jenem Augenblick, als mein einer Fuß noch im Graben steckte und mein Rücken den Stacheldraht berührte, auf dieser kurzen Entfernung zwischen den beiden Grenzlinien … als ich den Kopf hob und zum ersten Mal zu dem so fernen, fast schwarzen Himmel blickte, nachdem wir stundenlang auf den Einbruch der Dunkelheit gewartet hatten, um die Grenze überqueren zu können, ohne von den türkischen Soldaten bemerkt zu werden … In diesem Augenblick atmete ich tief ein, richtete mich auf und begann zu laufen, wie man uns angewiesen hatte. Ich lief und lief, um die Gefahrenzone hinter mir zu lassen. Der Boden war uneben und felsig, aber ich lief ganz leichtfüßig. Ein aus meinem Herzen ragender Kran trug mich und schwang mich durch die Luft. Ich war zurück! Ich war wieder da! Keuchend stammelte ich vor mich hin: «Ich bin zurückgekehrt!» Es war keine Szene aus einem Film. Es war Realität! Ich lief und stammelte: «Ich bin zurück … ich bin wieder da!»
Wir hörten das Pfeifen von Schüssen, das Poltern von Militärfahrzeugen, die auf der anderen Seite entlangfuhren, aber wir schafften es, uns in Sicherheit zu bringen und zu laufen.
Es schien, als sei alles seit langer Zeit vorherbestimmt.
Ich bedeckte meinen Kopf, zog eine lange Jacke an und schlüpfte in eine weite Hose, dann mussten wir einen hohen Hügel hinaufsteigen, bevor wir auf der anderen Seite zu einem Auto hinunterliefen, das bereits auf uns wartete. Die Nacht war hereingebrochen, alles wirkte ganz normal; zumindest glaubte ich das. Als ich später die Grenze noch mehrmals überwinden sollte, ergab sich ein anderes Bild.
Bereits der Aufenthalt am Flughafen im türkischen Antakya hätte einen Hinweis geben können, wie viele Menschen innerhalb der letzten eineinhalb Jahre nach Syrien eingereist waren. Auch später auf meinen Reisen im Land bestätigte sich das, und es wurde deutlich, was für einen rasanten und tiefgreifenden Wandel die Region durchgemacht hatte. Doch als ich nun mit schmerzenden Beinen den Hügel hinunterlief, dachte ich nicht an all das. Ich erreichte den Fuß des Hügels, dann ließ ich mich auf die Knie fallen, rang mehr als zehn Minuten lang nach Luft und versuchte, mein Herz zur Ruhe kommen zu lassen. Meine Begleiter glaubten, ich sei so aufgeregt darüber, mein Land zu sehen. Aber in diesem Moment ging es nicht um Pathos – wir waren einfach so lange gerannt, dass es mir die Brust zerreißen wollte und ich gar nicht aufstehen konnte.
Schließlich stiegen wir in das Auto, und ich kam wieder zu Atem. Hinten saßen wir zu dritt, vorne saßen zwei neben dem Fahrer. Maisara und Mohammed, die später ein Teil meiner Welt werden sollten. Sie waren beide Kämpfer, zwei sehr unterschiedliche Charaktere aus der Familie, die mich in Obhut nehmen würde. Der zwanzigjährige Mohammed würde mein Freund und Mitarbeiter werden.
Wir befanden uns im Umland von Idlib, einer Region, die noch nicht vollständig von der Herrschaft der Assad-Truppen befreit war. Wir passierten endlose Olivenhaine. Unterwegs wurden wir immer wieder von Checkpoints der Freien Syrischen Armee aufgehalten. Wir traten durch das erste Tor in das Land des Nichts. Sahen bewaffnete Kämpfer, die das Siegeszeichen machten. Es war eine lange Fahrt. Ich versuchte, der Realität Bilder zu entlocken, streckte meinen Kopf aus dem Autofenster und löste mich von meiner Umgebung. In der Ferne hörte man Detonationen, das Auto fuhr und fuhr, die Strecke schien kein Ende zu nehmen. Ich war zugleich freudig erregt und nervös, als ich das befreite Gebiet sah. Dies war befreites Territorium, doch es gab keinen Grund zu lachen. Der Himmel brannte. Vier voneinander isolierte Szenen drängten sich meinem Auge auf. Ich betrachtete sie nicht nur mit zwei Augen, auch im Nacken wuchsen mir Augen. An meinen Ohren und sogar an den Fingerspitzen. Wie ein Ungeheuer in einer alten Legende. Ich starrte hartnäckig geradeaus, aber das Bild zerfiel in vier Teile: die zerstörten Fahrzeuge, der brennende Himmel, ein Auto mit einer Frau darin und drei Männer auf ihrem Weg nach Saraqib.
Alle Details dieses Berichts sind Realität. Nur eine einzige fiktive Person gibt es dabei, die mit der Erzählung spielt. Ich bin die Einzige, die diese Zerstörung durchqueren kann, als sei ich eine fiktive Person in einem Buch. Ich sauge die Realität auf. Ich beobachte die Details, die Wirklichkeit, das Geschehen nicht auf der Grundlage dessen, was ich bin, sondern ich tue so, als sei ich eine Romanfigur. Ich überlege mir, welche Wahl eine fiktive Person in einem Roman hätte, damit ich weitermachen kann. Die wirkliche Frau lasse ich beiseite. Ich werde die Andere, die Fiktive, deren Reaktionen dem entsprechen müssen, wofür sie gelebt hat. Was ist es, was die eigene Existenz gewährleistet? Die Identität? Das Exil? Die Gerechtigkeit? Der irre Blutrausch? Und all diese Straßen, über die das Auto in tiefer Dunkelheit zum Haus der Familie fuhr, die ein Teil meiner Welt werden sollte.
Seltsam, dass mir manche Ereignisse jetzt ganz plötzlich wieder einfallen, denn bei dieser ersten Reise hatte ich nicht geplant, sie aufzuschreiben. Nachdem ich das Land im Juli 2011 hatte verlassen müssen, war ich nun im August 2012 nach Syrien zurückgekehrt, um im Norden des Landes Frauen- und Schulprojekte zu initiieren. Ich suchte nach einem umsetzbaren Projekt, durch das wir zivile demokratische Institutionen in jenen Regionen gründen könnten, die außerhalb des Machtbereichs des Regimes lagen. Ich dachte nicht im Geringsten daran, dieses Tagebuch zu schreiben, sondern wollte eigentlich bald meinen neuen Roman beginnen. Doch als ich das Land wieder verließ, änderte ein kleines Ereignis den Lauf der Dinge und bewog mich dazu, dieses Zeugnis abzulegen: Als wir von Sarmada aus wieder zurück in die Türkei wollten, trafen wir auf ein paar junge Kämpfer. Was einer von ihnen erzählte, veranlasste mich, meinen Stift zur Hand zu nehmen und seinen Bericht in einem kleinen Heft zu notieren. In dem Augenblick, als er sagte: «Wir wollen einen zivilen Staat», da beschloss ich zu schreiben.
Es war am letzten Tag kurz vor unserer Abreise, am Checkpoint des Al-Faruq-Bataillons. Ein junger Mann erzählte mit blitzenden Augen, wie er von den Spezialtruppen der Armee desertiert war, weil er sich geweigert hatte, Menschen zu töten. Dann setzte er hinzu: «Wie soll ich mich dem Tod in die Arme werfen? Wer will schon den Tod? Niemand! Aber wir waren wie Tote, dabei wollten wir einfach nur leben.»
Der Himmel war blau, nichts trübte unsere Freude über die Befreiung großer Teile im Norden Syriens, nicht das Pfeifen der Schüsse, nicht die Straßensperren, nicht einmal all die zerstörten Gebäude beidseits der Straße. Wir hatten Sarmada mit seinen bunten Mauern, auf die die Fahne der Revolution gemalt war, noch nicht lange hinter uns gelassen.
«Wir wollen einen zivilen Staat», wiederholte der andere junge Mann. Der Erste sagte: «Diese verdammten Offiziere! Das sind alles Alawiten!» Darauf schaute der andere ihn bestürzt an und stammelte: «Nein, nicht alle.»
Ich hörte genau zu, als mir der junge Kerl die Geschichte seiner Desertion zum zweiten Mal erzählte. Plötzlich kam sein Freund zu ihm und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Jüngere mit den leuchtenden Augen und dem honigfarbenen Pony schaute mich verblüfft an. Er ließ seine Waffe auf den Boden fallen. Ich sah ihm in die ängstlichen Augen. Er drehte sein Gesicht weg.
Der Himmel hatte sich nicht verändert. Er war immer noch blau. Und der Steinberg, den wir hinter uns gelassen hatten, starrte immer noch schweigend, aber ich konnte ein Knacken hören, als der junge Mann mir sein Gesicht wieder zuwandte. Es war der gleiche junge Mann, der mit seiner Waffe an einem Checkpoint gestanden und dem Himmel seinen Zorn entgegengestreckt hatte. Er biss sich auf die Lippen und sagte mit zitternder Stimme: «Verzeihen Sie mir, ich habe es wirklich nicht gewusst.»
Sein kindliches Gesicht wurde wieder milde. Die bewaffneten Männer unter der Brücke blickten neugierig zu uns herüber. In der Nähe flatterte eine weiße Fahne, auf der stand: «Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet.» Zwei der Männer hatten sich lange Bärte wachsen lassen. Noch immer war der Himmel blau, doch der Soldat, der zum Kind geworden war, kam zu mir und sagte stotternd: «Ich hasse niemanden. Aber das sind Hunde, sie wollen, dass wir Menschen töten … Bitte verzeihen Sie!»
Der etwas ältere Kämpfer stand neben ihm. Mit zornigem Blick wiederholte er: «Wir wollen einen zivilen Staat. Ich bin im Faruq-Bataillon, und ich möchte einen zivilen Staat. Ich studiere Handelswissenschaften im zweiten Jahr.»
Wir blieben nicht lange bei ihnen. Ich sagte: «Kein Problem … Es ist nichts passiert.» Aber der junge Mann, dessen Augen nun weniger leuchteten, bestand darauf, mir zu erklären, dass er mich nicht hatte beleidigen wollen. Bevor wir weiterfuhren, sagte ich noch: «Aber ich bin keine Alawitin, und du bist kein Sunnit. Ich bin Syrerin und du bist Syrer.»
Erstaunt schaute er mich an. Ich fügte hinzu: «Das ist die Wahrheit. Wir sind einfach nur Syrer.»
Als wir den Checkpoint des Faruq-Bataillons hinter uns ließen, brummte ich vor mich hin: «Wer muss hier besänftigt werden? Wer möchte eine Heimat aus Blut und Feuer bauen? Dieser desertierte Soldat, der zu einem Kind geworden ist? Oder diese Mörder, Assads Schergen?» Die Männer schauten mich verwundert an und lachten. Sie verstanden kein Wort von dem, was ich sagte.
Woher kommt die Kraft dieser jungen Männer? Wer von uns hat sich von der Bedeutung des Lebens entfremdet? Wer klebt mehr am Sinn des Lebens: wir oder sie? Diejenigen, die im Angesicht des Todes leben und ihn wie einen leichten Happen mit ihrem Lachen verschlucken, bis ihre Leichen in verstreuten Einzelteilen herumliegen. Sie sind nur eine Vorstellung in den Köpfen der Menschen. Unter der «Freien Syrischen Armee» mag man sich vielleicht eine kompakte Armee vorstellen, dabei sind es genau diese vereinzelten Männer, die man zufällig auf der Straße trifft. Es sind einzelne Gruppen, die sich in ihrer Ausrichtung und ihrer Prägung voneinander unterscheiden, in ihrer Brutalität und ihrer Barmherzigkeit. Sie unterscheiden sich darin, wie sehr sie die Prinzipien der Revolution verinnerlicht haben oder ignorieren. Sie haben kaum etwas miteinander gemeinsam. Die Mitglieder der Freien Syrischen Armee spiegeln unser eigenes Leben, unsere Vielfalt wider. Das Einzige, was sie verbindet, ist, dass ein federleichter Tod zwischen ihnen umherstolziert, und die wohl realistischste Bezeichnung ist: «Bataillone des bewaffneten Volkswiderstands».
Ich weiß selbst nicht, warum dieser letzte bewaffnete Checkpoint vor meiner Ausreise den Ausschlag gab für meine Aufzeichnungen über die Tore ins Land des Nichts. Ich weiß nur, dass ich so beeindruckt war von dem desertierten Soldaten, der zu einem Kind geworden war, dass sich mir, sobald ich die Augen schloss, immer wieder das Bild des jungen Mannes aufdrängte, der seine Waffe zu Boden geworfen hatte, um sich bei mir für etwas zu entschuldigen, wofür er gar nichts konnte, und zwar, dass die Frau vor ihm zur gleichen Religionsgemeinschaft gehörte wie die Offiziere der Regierungsarmee.
Das erste Tor, durch das wir Syrien betraten, führte bereits durch das türkische Krankenhaus in Reyhanli nahe der syrischen Grenze. Dort war ein ganzes Stockwerk verletzten Syrern vorbehalten. Aus mehreren Zimmern drang der Geruch der Menschen, denen ganze Beine oder Arme fehlten. Sie lagen mit verlorenem Blick auf den weißen Laken, und ihre Körperteile schwebten in der Leere. Manhal, einer der Revolutionäre der ersten Stunde aus Saraqib, bat mich im Voraus, mich zusammenzunehmen, als wir das Zimmer zweier Mädchen betraten, der vierjährigen Diana und der elfjährigen Schaima.
Diana, durch eine Kugel im Rückgrat getroffen, war gelähmt. Wie ein verängstigtes weißes Häschen lag sie da. Es war ein Wunder, dass die Kugel ihren kleinen zerbrechlichen Körper nicht in Stücke gerissen hatte. Was mochte der Scharfschütze gedacht haben, als er auf den Rücken eines Mädchens zielte, das die Straße überquerte, um Süßigkeiten für das Fastenbrechen zu kaufen?
In dem Bett neben Diana lag Schaima, deren Bein von einer Granate abgerissen worden war. Die Granate war ganz plötzlich eingeschlagen, als sie mit ihrer Familie vor dem Haus gesessen hatte. Neun Familienmitglieder starben, einschließlich ihrer Mutter. Neben dem Bett stand ihre Tante. Schaimas Blick war zugleich flehend und wütend. Erst als ich ihr die Finger auf die Stirn legte, lächelte sie. Ihre linke Hand war von einem Splitter zerschmettert worden. Ein weißer Verband war um ihren Unterleib gebunden, der am oberen Teil des Oberschenkels endete. An der Stelle des abgetrennten Beins war nichts. Die Leere definiert die Form des fehlenden Körperteils. Wie unvollkommen der Mensch in seiner Verletzlichkeit ist. Was sollte man diesem jungen Mädchen sagen, das mich mit seinen bezaubernden Augen ansah? Auch ihr anderes Bein war verletzt. Am ganzen Körper hatte sie noch weitere Wunden.
Meine Finger auf ihrer Stirn, zwischen uns ein stummes Lächeln. Schaima und Diana waren nicht allein auf diesem Stockwerk. Im Nachbarzimmer lag ein junger Mann, der auf die Amputation seines Beines wartete, das ihm von einer Granate zertrümmert worden war. Seine Augen lachten. Ein anderer junger Mann wartete darauf, dass sein von einer Granate verletztes Bein heilte, um zum Kämpfen zurück nach Syrien zu gehen. Er führte eine Militäreinheit an. Es war Abdallah, den ich später wieder treffen sollte und der beim Gehen hinkte. Wir sollten Freunde werden. Wir würden zusammen durch das dritte Tor ins Nichts gehen, unter Granatbeschuss, um mit seiner schönen Verlobten Kaffee zu trinken.
In diesem Krankenhaus kurz vor der Grenze befanden sich alle zurückgelassenen Körperteile der Syrer am falschen Ort. Die Männer, die mit halb zerrissenen Körpern dort lagen, schauten aus den Fenstern des Krankenhauses, das so nah bei ihrer Heimat lag, dass sie ihren Duft riechen konnten. Den Duft der Heimat, wo ich den ersten Schritt auf das Nichts zu tat; wo wir kurze Zeit später sehen sollten, wie der Himmel über den schlafenden Ortschaften brannte; wo ich hinter Taftanaz das erste Abendessen mit einem der Bataillone einnehmen sollte; wo ich verblüfft in die Gesichter der Männer schauen würde, die lachten, wenn eine Granate über unsere Köpfe flog.
Es gibt keinen anderen Helden als den Tod. Nur über ihn erzählen die Menschen Geschichten. Alles kann man relativieren und ertragen, außer das Heldentum des endgültigen Todes. Oder einen Augenblick, der aus der Zeit fällt. Es war dieser selbe Augenblick, als wir nachts unter dem Stacheldraht hindurchkrochen. Es war der Übergang von einer Verlorenheit in eine andere. Dort, wo die Männer einen Durchschlupf gegraben hatten. Mal rannten wir, mal gingen wir langsam. In diesem Augenblick drängte sich die Frage nach dem Exil und der Heimat auf. Dort, auf beiden Seiten des Zauns, tauchten im Dunkeln plötzlich weitere Körper auf, während wir wie Blinde vorwärtsirrten. Eine Schulter stieß an die andere. Wir hörten eine Stimme sagen: «Guten Abend!» Eine Stimme kam, eine ging. Wir waren wie schwarze Katzen, aber unsere Augen funkelten nicht. Das Niemandsland entlang der Grenze, unter der die Syrer nachts verschwanden, war nicht breit. Menschen gingen, Menschen kamen, sie begegneten einander in der Nacht, viele grüßten nicht. Wie eine gallertartige Masse bewegten sie sich.
Auf unserem Rückweg trafen wir an dem gleichen Stacheldraht zwei junge Tunesier, die die Grenze Richtung Syrien überquerten. Der Mann, der uns begleitete, sagte: «Wenn weiterhin manche Gruppen der FSA auf Kosten anderer unterstützt und finanziert werden, wird es uns schlecht ergehen.» Dasselbe sagten auch die Deserteure, die nicht über ausreichend Munition verfügten, im Gegensatz zu den in letzter Zeit entstandenen islamischen Gruppierungen, von denen es hieß, sie seien radikal und würden von bestimmten Staaten finanziert. Die Männer der Bataillone im Umland von Idlib, Hama und Aleppo sagten meist das Gleiche, aber trotzdem konnten diese schlecht finanzierten Einheiten sich immer irgendwie vor einem Anschluss an die islamischen Gruppierungen retten. Sie verkauften ihr persönliches Hab und Gut und unterstützten sich wie Mitglieder einer einzigen Familie gegenseitig. Manchmal verkauften sie sogar den Schmuck ihrer Ehefrauen. Als ein Gruppenführer einmal Geld für den Kauf von Gewehren sammelte, zog eine der Frauen ihren Ehering ab und reichte ihn ihm. Er wollte ihn jedoch nicht annehmen.
Der Befehlshaber einer anderen Einheit sagte mir einmal: «Wenn es so weitergeht, werden wir uns noch dem Teufel anschließen, um das Regime von Baschar al-Assad zu bekämpfen.» Er wirkte wütend und entmutigt. Die Leute der FSA hätten nicht genügend Waffen, um den Kampf auszuweiten. Sie wollten das Töten in Aleppo beenden und fühlten sich nicht in der Lage dazu. Das Geschäft der Waffenhändler brumme, und die politische Opposition beschäftige sich weder mit der Realität der bewaffneten Einheiten vor Ort noch bemühe sie sich um die Bildung einer einheitlichen Militärführung. Der Mann fuhr fort: «Angesichts der Luftangriffe, des Hungers, der Belagerung, der Scharfschützen und der Verhaftungen werden sich alle jenen Gruppierungen zuwenden, die gut mit Waffen versorgt sind.»
«Ist es das, was das Regime will?», fragte ich.
«Fragen Sie das doch mal die Elite der politischen und kulturellen Opposition!», entgegnete er zornig. «Wo sind sie? Warum leben die hohen Offiziere in der Türkei? Die wahre Schlacht findet hier statt. Wir sterben jeden Tag, und wir werden weiter sterben und können nichts anderes geben als unser Leben. Wir werden uns dem Regime weiterhin entgegenstellen. Vielleicht werden wir umkommen, aber unsere Kinder und Enkel werden das Assad-Regime weiter bekämpfen.»
Ich bin nicht in der Lage, chronologisch zu schreiben. Das liegt mir nicht. Ich muss die Zeit brechen.
Ich kehre wieder zum Beginn zurück und schreibe über unseren Grenzübertritt – darüber, wie wir über die Grenze irrten und wie uns die Olivenhaine und der neue Duft des Landes empfingen. Und über all die Orte, die wir passierten und deren Mauern mit Bildern der Revolution und der Revolutionsfahne verziert waren, und von den müden Gesichtern der Menschen.
Wir fuhren mit dem Auto, das den Schleier der Nacht durchdrang, an etlichen Straßensperren der Freien Syrischen Armee vorbei. Es waren keine großen Checkpoints, und die Männer kannten sich. Die Dörfer waren befreit, manche nur halb. Das Wort «befreit» ist allerdings recht ungenau, denn der Himmel wurde immer noch vom Regime kontrolliert. Um uns herum wurden immer wieder Granaten abgeworfen, manchmal hörten wir Flugzeugbrummen. Die Männer beruhigten mich, dass alles in Ordnung sei, es gebe nur ein paar Kilometer lang eine gefährliche Zone. «Kein Problem», sagte einer von ihnen, was so viel bedeutete wie, dass der Tod vom Himmel kommen würde. Wir würden mit dem Auto nach Bennisch fahren und uns an einer Demonstration beteiligen. Anschließend würden wir ein Bataillon besuchen.
Auf der Demonstration in Bennisch waren keinerlei Frauen zu sehen. Auf den Fahnen stand geschrieben: «Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet.» Die Männer schauten mich als einzige Frau befremdet an. Einige von ihnen lernte ich kennen. Sie waren äußerst höflich. Sie sangen und klatschten, dann hielt ein Scheich eine Predigt. Wir verließen den Ort nicht sofort. Ich kam mit ein paar Frauen ins Gespräch, die vor ihren Häusern standen und die Demonstration beobachteten. Eine von ihnen erzählte: «Früher haben wir uns an den Demonstrationen beteiligt, aber das geht jetzt nicht mehr. Unsere Männer haben Angst um uns wegen der Bomben und der Scharfschützen.» Bennisch war wirklich befreit, nur dem Himmel war nicht zu trauen. Die Schergen Assads konnten den Revolutionären auf dem Boden nichts entgegensetzen, und nachdem sie erfolglos versucht hatten, die Bevölkerung zu bekämpfen, trauten sie sich nicht, in den Ort einzudringen. Stattdessen kamen sie nachts und in der frühen Morgendämmerung, bombardierten und machten sich wieder davon. Meist starben Kinder, Frauen und alte Leute. Aber die Bevölkerung und die kämpfenden Einheiten gaben nicht auf. «Das ist unser Schicksal», sagten die Männer in Bennisch.
Ich sah keine einzige unverschleierte Frau. Das gehört zur Tradition in der Gegend, sie leben nach den Bräuchen des Islam. Auf der Demonstration in Bennisch hatte ich ohne Kopftuch bei ihnen gestanden, gleichwohl setzte ich, als wir durch die Ortschaften und Dörfer fuhren, ein Kopftuch auf, um nicht unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. Aber wenn ich mit den Männern zusammen war, saß ich barhäuptig bei ihnen. Einige von ihnen gaben mir allerdings nicht die Hand. Wir unterhielten uns auf einem vernünftigen und menschlichen Niveau miteinander, aber sie sagten, dass einige andere militärische Einheiten mich nur verschleiert akzeptieren würden. Keiner von ihnen sprach von der Errichtung eines islamischen Kalifats, immer nur von einem zivilen Staat. Es gab insgesamt noch kaum dschihadistische Bataillone, sie waren erst vor ein paar Monaten aufgetaucht. Auch das Gerede über die «arabischen Dschihadisten» war übertrieben, doch nach jedem Massaker wurden es mehr. In Saraqib gab es etwa neunzehn dschihadistische Kämpfer unter insgesamt siebenhundertfünfzig Kämpfern.
Das Abendessen, das wir in Bennisch zu uns nahmen, war geradezu luxuriös. Wir befanden uns in einem Haus inmitten eines Olivenhains, und ein paar Männer waren darum bemüht, uns das Beste aufzutischen, was sie hatten. Der Anführer der Gruppe war Anfang dreißig, ein hübscher ruhiger Mann aus Bennisch. Wir sprachen über etliche Themen, und ich staunte darüber, wie kompromissbereit und milde die jungen Männer im Gespräch waren. Sie wollten unbedingt über das Problem der Konfessionen sprechen, über die Notwendigkeit, eine Lösung zu finden und einem Krieg der Religionsgemeinschaften gegeneinander keine Chance zu geben. Einer sagte: «Es gibt grausame Reaktionen auf die Brutalität des Regimes, aber das sind nur wenige Einzelfälle.» Der gleiche junge Mann sollte mir ein paar Tage später sagen: «Als Reaktion auf ein Massaker wurde einmal ein Alawit umgebracht, aber wir waren gegen diesen Mord. Bis jetzt hat das Regime sein Ziel nicht erreichen können; bis jetzt hat kein sunnitisches Dorf ein alawitisches angegriffen. Das ist bis jetzt nicht passiert und wird auch niemals passieren. Selbst wenn wir dafür mit unserem Leben bezahlen müssen. Aber wir haben natürlich keinen Einfluss auf all die wütenden Menschen, deren Familien komplett ausgelöscht oder deren Häuser bombardiert wurden. Die Zeit spielt dieser Wut in die Hände.» Der junge Mann, der das zu mir gesagt hatte, wurde einige Monate später von Vermummten umgebracht, von denen sich herausstellte, dass sie zu einer Gruppe von Dschihadisten gehörten, die keine Syrer waren.
Sie erzählten mir viele Einzelheiten über Söldnerbanden, die im Namen der Freien Syrischen Armee plünderten und im Namen irgendwelcher militärischer Einheiten Menschen entführten, was zur Folge hatte, dass sie sich nun auch mit diesen Leuten beschäftigen mussten, statt das Regime zu bekämpfen. Außerdem mussten sie Konflikte zwischen bewaffneten Einheiten lösen, die oft persönliche Auseinandersetzungen zwischen Dorfbewohnern betrafen.
Die Männer gestanden auch eigene Fehler ein und dachten darüber nach, wie der Fortgang der Revolution wieder in richtige Bahnen gelenkt werden könne. Vielleicht repräsentierten diese Männer nicht den ganzen Norden im Umland von Aleppo, Idlib und Hama, gleichwohl vertraten alle Einheiten, die ich traf, ungefähr diese Linie. Das galt auch für den Scheich einer der Stämme.
Ich lauschte den Männern aus Bennisch, als das Donnern einer enormen Explosion zu hören war. Wir saßen auf dem Balkon, der auf den Olivenhain hinausging. Im Mondlicht konnte ich die zehn Männer einigermaßen deutlich erkennen. Der Himmel leuchtete auf, einer von ihnen sagte: «Taftanaz wird bombardiert.» Dann kehrten sie zu ihren Gesprächen zurück und ermunterten mich weiterzuessen. Schweigend aß ich, während mir das Herz bis zum Hals klopfte. Einer von ihnen würde mir später schreiben: «Nachdem du uns verlassen hast, wurden wir bombardiert. Gott sei Dank bist du abgereist.»
Die Männer bestanden darauf, mir den Panzerfriedhof in Atarib zu zeigen. Es handelte sich um ausgebrannte Fahrzeuge, die aufeinandergetürmt waren, zertrümmerte Eisenskelette. Überall waren Überreste des Feuers zu sehen, auch in den wie Pappkartons zusammengefallenen Häusern. Stille und Trostlosigkeit. Kein Geräusch war zu hören in Atarib, nichts, nicht einmal ein Flüstern oder Hundegebell. Nur am Ende einer Seitenstraße entdeckten wir, während wir in der Ruinenlandschaft stöberten, die uns die Bedeutung des Wortes «Vernichtung» deutlich werden ließ, das Licht einer Kerze in einem kleinen Laden. Von weitem waren die Umrisse einer Frau zu erkennen, die sich bewegte. Dies war der einzige Hinweis darauf, dass Atarib keine Geisterstadt war. Ansonsten nur amorphe identitätslose Trümmer. Noch immer konnten wir in der Nähe den Lärm von Explosionen hören.
Wir fuhren weiter nach Saraqib. Der Anführer der Truppe, mit der wir unterwegs waren, nahm sein Gewehr und begann es rasch zu laden. Ich begann zu zittern. Dann legte er eine Handgranate neben sich. Sie lag jetzt genau neben mir. Ich betrachtete den nur einige Zentimeter langen grünen Klumpen und berührte ihn. Ich begann wieder zu zittern. Während wir die Gefahrenzone durchfuhren, lag seine Hand fest auf der Granate, seine Waffe hatte er auf den Fensterrahmen gestützt. Wie ein Wolf ließ er seinen Blick durch die Nacht wandern. «Das sind entweder diese Hundesöhne vom Regime oder die Schurken und Diebe, die im Namen der Freien Syrischen Armee stehlen», sagte er.
Maisara, der vorne saß, entsicherte sein Gewehr, der Fahrer fuhr mit der Unerschütterlichkeit eines Propheten weiter. Auch Mohammed neben mir machte sein Gewehr bereit.
Wir fuhren durch die beängstigende Dunkelheit. Hohe Zypressen säumten die enge Asphaltstraße, die niemals enden zu wollen schien. Ich gab mich mutig, doch das Gewehr neben mir und die Handgranate, die der Anführer in seine Jackentasche gesteckt hatte, machten mich glauben, dass mein letztes Stündchen geschlagen hatte. Wäre da nur nicht die Mündung des Gewehrs vor mir gewesen, das der Anführer zwischen uns gestellt hatte. Die Mündung befand sich genau vor meinen Augen. Eine zentimeterkleine Bewegung der Finger am Abzug würde mich garantiert in die süße ewige Finsternis versinken lassen. Es war eine sehr kleine, einladende Öffnung, die mich inmitten der Dunkelheit anstarrte. Die Stimme des Anführers riss mich aus meinen Gedanken: «Wir sind alle bereit, draufzugehen, damit Ihnen kein Haar gekrümmt wird.»
Wir fuhren vorsichtig durch die Gassen von Saraqib. Die Stadt war noch nicht vollkommen befreit, ein Scharfschütze hockte immer noch auf der Radiostation. Er hatte schon viele umgebracht.
Wir betraten das Haus einer wohlhabenden und großzügigen Familie. Es bestand eigentlich aus drei Häusern, die um einen Innenhof gruppiert waren. Im hinteren Teil lag ein altes Zimmer, das sie Gewölbe nannten und in dem ich mich am liebsten aufhalten sollte. Es war ein altes Kuppelhaus, das von den Vorfahren errichtet worden war. Links befand sich das Haus des ältesten Sohnes, Abu Ibrahim, und seiner Frau Nura. Bei ihnen würde ich schlafen. Rechts lag das Haus des jüngeren Sohnes, Maisara, seiner Frau Manal und ihrer Kinder Alaa, Ruha, Mahmud und Tala. Bei ihnen lebten noch die alte Mutter und die alte Tante, beide fast gelähmt. Um sie kümmerte sich Ajusch, die unverheiratete Tochter.
Kaum waren wir angekommen, machten sich alle eilig an die Zubereitung des Abendessens. Maisara hatte früher friedlich gegen das Assad-Regime demonstriert, bevor er zum Kämpfer geworden war. Mohammed, Anfang zwanzig, studierte Handelswissenschaften. Auch er hatte sich zuerst der friedlichen Bewegung angeschlossen, dann der bewaffneten Opposition. Wir setzten uns alle auf den Boden und nahmen gemeinsam das Abendessen ein, neben mir Ruha und Alaa.
Am nächsten Morgen wollte ich losziehen, um mich über die Situation der Märtyrerwitwen zu erkundigen. Doch zunächst strömten die schönen Nachbarinnen in das Haus der großen Familie, bildeten einen Kreis um mich und begannen, Geschichten aus Saraqib zu erzählen. Alaa saß an meiner Seite und lauschte, meine Hand in der ihren. Ruha half ihrer Mutter und schaute sie dabei feindselig an, weil sie nicht bei uns sitzen durfte. Ich versuchte die beiden zu besänftigen. Alaa zwinkerte mir zu, legte die Hand ans Kinn und hörte gemeinsam mit mir den Geschichten der Frauen zu.
Die Witwen zu Hause aufzusuchen, war nicht einfach. Mohammed musste mich immer mit dem Auto begleiten, aber Männern war es verboten, die Wohnungen der Witwen zu betreten, wenn sie sich noch in der gesetzlichen Wartezeit bis zu einer möglichen Wiederverheiratung befanden. Nach islamischem Recht durften sie vor Ablauf von drei Monaten und zehn Tagen keinen Mann treffen.
Als wir vom letzten Besuch zurückkehrten, schlug Mohammed vor, den Kalligraphen und Maler zu besuchen, der die Mauern von Saraqib bemalte. Die Graffiti-Kunst war eine der wichtigsten Kunstformen der Revolutionsaktivisten. Sobald die Ortschaften befreit waren, wurden die Mauern zu offenen Büchern und Freiluftmuseen. Der Mann, der die Mauern von Saraqib bemalte, war derselbe, der die Opfer der Bombenangriffe bestattete. Er sagte zu mir: «Ich beerdige die Leichen.» Er rieb sich die Hände und fügte hinzu: «Ich könnte Ihnen die Geschichte jedes Toten erzählen. Aber das bräuchte wahrscheinlich ziemlich lange Zeit. Ich beerdige die Toten und bemale die Mauern von Saraqib. Ich werde diesen Ort niemals verlassen!»
Wir standen gegenüber dem Kulturzentrum von Saraqib vor den Mauern, die leuchtenden Farben brachen die Einförmigkeit des Ortes. Auf einer Mauer stand: «Damaskus! Wir und die Ewigkeit sind die Bewohner dieses Landes.»
Wir wanderten durch die Straßen. Ich fotografierte die Mauern und Fassaden der Geschäfte, während man vereinzelt die «Gott ist groß!»-Rufe von vorüberziehenden Leichenzügen hörte. Überall Staub und eine sengende Sonne. Wir begegneten nur wenigen Männern; sie hatten gerötete, aber hellwache Augen. Immer war das Pfeifen der Schüsse des Scharfschützen zu hören. Dazu pausenloser Granatenbeschuss.
Am Abend kam ein dunkelhäutiger junger Mann, ein Verwandter von Maisaras Familie, mit seiner Mutter zu Besuch. Er saß eine Weile still da, dann erzählte er, dass die Granaten in sein Feld gefallen seien und den Tabak verbrannt hätten, den er verkaufte. Damit sei die Saison dieses Jahres vorbei. Dann lehnte er den Kopf gegen die Wand. Wir saßen auf einer Schaumstoffmatratze, die auf einer Plastikmatte lag, und hörten ihm schweigend zu. Seine Mutter schaute ihn neugierig an, für einige Sekunden konnten wir ihr Schnaufen hören, bevor auch sie ganz still wurde und mit uns dem Geräusch der Schüsse draußen lauschte.
Als wir am Mittag des folgenden Tages vor einer der Mauern standen, erklärte Mohammed: «Sie verbrennen die Anbauflächen im Umkreis der Ortschaft, um die Bevölkerung zu bestrafen. Ob sie jetzt wohl eine Granate auf uns abfeuern werden? Vielleicht tun sie es!» Wir schauten in den klaren blauen Himmel, in dem die Granaten dröhnten. «Wenn eine Granate auf uns runtergeht, werden wir sie nicht einmal hören», sagte er, und wir lachten. Nicht weit von der Ortschaft fuhren fortwährend Panzerkolonnen in Richtung Aleppo.
«Saraqib wird später, wenn die Kämpfe wieder aufflammen, zur Demarkationslinie werden. Sie werden nicht aufhören, es zu bombardieren», versicherte er, als wir weiterfuhren. Wir hielten vor einem zerstörten Haus, und Mohammed fuhr fort: «Dieses Haus haben sie bombardiert, nachdem es schon in Brand gesetzt und einer der Bewohner umgekommen war. Den Sohn hatten sie an ein Auto gebunden und durch die Straßen geschleift. Der Junge gehörte zu den friedlichen Demonstranten. Im Gefängnis wurde er zu Tode gefoltert, er hinterlässt sieben Schwestern und einen Bruder. Ein anderer Junge hatte die Demonstrationen fotografiert. Ihn haben sie sich auch geschnappt und vor einen Panzer gelegt und ihm gesagt, der Panzer würde jetzt über ihn fahren. Dann setzten sie den Panzer in Bewegung, hin und her, er lag direkt davor. Das machten sie eine Weile, dann fingen sie an zu lachen, bevor sie ihn verhafteten. Wir bauen wieder auf, was sie bombardiert haben. Siehst du diese Wohnung auf der anderen Seite?» Er zeigte auf ein Stockwerk mit einem riesigen Loch in der Wand. «Hier wohnte die Schwester eines Deserteurs aus der syrischen Armee. Sie haben sie bombardiert, einfach so, aus Rache an ihrem Bruder.»
Wir hörten immer wieder Bombenlärm und standen vor Angst bereits um fünf Uhr morgens auf. Es gab keine bestimmte Uhrzeit, zu der bombardiert wurde. In der Nacht gab es allerdings genaue Zeitabstände: Jede halbe oder ganze Stunde ging eine Granate nieder. Einmal hatte es hundertdreißig Detonationen nacheinander gegeben. Manal, die Frau von Maisara, sagte, dass sie seit Beginn der Revolution nicht mehr richtig schlafen könnten. Sie schliefen gerade mal eine Stunde, dann wachten sie auf. Sie hatten alle schwere Lider. Ich packte mir Alaa und Ruha und ging mit ihnen in den Schutzraum. Wir stolperten langsam voran, weil beide Mädchen seitlich an mir hingen, und jede unerwartete Bewegung uns unweigerlich hätte stürzen lassen. Das Haus war groß, aber nun war es voll mit all den Familienmitgliedern, die von zu Hause geflüchtet waren: Da war die alte Großmutter, mit der alle verwandt waren, die Tante, dann die Generation der Töchter und ihrer Ehemänner und die Söhne und ihre Frauen, dann die Enkel und Urenkel. In jedem Haus drängten sich mehrere Familien zusammen. Manche Häuser waren gestürmt und zerstört worden, andere lagen in der Schusslinie oder waren zur Demarkationslinie geworden. Häuser, die von Scharfschützen ins Visier genommen wurden, Häuser von abgetauchten Deserteuren. Diese Familie hier war zwar groß, «aber wir kommen zurecht», sagte eine der Frauen.
Der Schutzraum war ein großer Lagerraum, in dem die Familie Arbeitsgeräte, Rohre und Werkzeug deponierte. Das Loch, das eine Granate gerissen hatte, wie Manal erzählte, war ausgebessert worden. Die Tür war mit Plastiktüten umwickelt. Kinder und Frauen waren hier unten, auch ein paar Männer hatten sich hinzugesellt. Die beiden Alten blieben oben mit den meisten Männern der Familie. «Sie können sich nicht bewegen», erklärte die älteste Tochter, «und so schnell, wie eine Granate fliegt, kann man sie nicht herunterbringen. Außerdem sind sie krank. Sie bleiben in ihrem Zimmer und lauschen dem Lärm der Granaten. Wenn der Beschuss nachlässt, erklingt irgendwann eine Stimme vom Minarett, die den Tod eines Bewohners bekannt gibt. Die beiden Alten bleiben oben und schauen durchs Fenster nach draußen.»
Unten im Schutzraum prahlten Alaa, Ruha und Tala um die Wette und redeten über die verschiedenen Arten von Granaten und Raketen. Eine hatte eine Granate in der Hand, die sie als Andenken aufbewahrte. Auch Familien aus der Nachbarschaft kamen in den Schutzraum, weil ihre Häuser über keinen eigenen Keller verfügten. Die Familie, deren Haus gegenüber dem Posten des Scharfschützen lag, war ebenfalls hierher geflohen. Später konnte ich mir ihr Haus ansehen. Über die ganzen Mauern verteilt waren Einschlaglöcher. Während wir vorsichtig durch die Räume wanderten, erzählte mir die Mutter dieser Familie, dass sie, wenn sie von einem Zimmer zum anderen gehen und den Hof überqueren wollte, immer erst einmal lange dastand und den Scharfschützen beobachtete. Wenn er einen Augenblick unachtsam war, rannte sie los, um ein Glas Wasser zu trinken oder ihren Kindern das Essen zu bringen oder auf die Toilette zu gehen. «Ich spiele mit diesem verfluchten Scharfschützen», sagte sie lachend. Sie trug ein rosafarbenes Kopftuch und ein den Boden berührendes Kleid mit Schlingpflanzenmuster. Alle Frauen hier trugen lange Kleider, und die Mutter, die ihr Spiel mit dem Heckenschützen trieb, wirkte seltsam mit ihrem Stolz inmitten dieses zerstörten Hauses.
Die Frauen im Ort erzählten mir später, derselbe Scharfschütze habe an dem Tag, als ich den Ort verließ, auf die Geschlechtsteile einer Frau gezielt und ein zwölfjähriges Mädchen getötet. Es war auch derselbe Schütze, wegen dem ich auf Anweisung der Männer durch die Häuser hindurchlaufen musste, um nicht die für ihn einsehbare Straße zu nehmen. Ich hatte dann das Gefühl, eine plötzlich einsetzende Lähmung hindere meine Knie daran, gerade zu gehen. «So geht das aber nicht!», riefen die Männer. «Du musst dich zusammenreißen!»
Ich lernte damals auch, meine Traurigkeit und mein Unglück für mich zu behalten. Wir versuchten einfach, dem Scharfschützen auszuweichen. Die Haustüren waren geöffnet. Wir sprangen aus einem Fenster, dann auf eine Treppe ganz unten im Haus, von dort betraten wir den nächsten Hof. Wir nahmen unsere Schuhe in die Hand, wenn wir durch fremde Wohnungen liefen. Wir grüßten die alte Frau, deren Wohnzimmer wir durchquerten, und sie grüßte zurück, ohne sich zu rühren. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass die Bewohner durch ihr Haus liefen. Sie alle hatten ihre Türen geöffnet und Mauern durchbrochen und ihre Häuser in Straßen verwandelt, um dem Scharfschützen zu entgehen. Als ich zum ersten Mal aus dem Fenster sprang, sah ich die alte Frau an, in der Erwartung, eine gewisse Verwunderung wahrzunehmen. Sie aber starrte nur zur Decke, als würde sie uns drei gar nicht bemerken. Wir durchquerten etliche Häuser, bis wir in Sicherheit waren. Dies war die einzige Möglichkeit, dem Scharfschützen zu entkommen.
Auch tagsüber gingen die Luftangriffe weiter, trotz der sengenden Sonne, und die Stille am helllichten Tag wurde nur vom Geräusch der Bomben und von den Schüssen des Heckenschützen unterbrochen.
Als wir die Türschwelle zu ihrem Haus überquerten, sagte die Nachbarsfrau zu mir: «Haben Sie keine Angst, solange bombardiert wird, hält sich der Heckenschütze zurück.» Sie zwinkerte mir zu. Dann warf sie ihren Sohn in die Luft und fing ihn mit beiden Armen wieder auf. Ihr Haus war leer, nur ein Teppich bedeckte den Boden eines Zimmers. Als ich mit ihr in den Schutzraum zurückkehrte, kam eine neue Nachbarsfamilie dazu. Alaa, die auf einer Gute-Nacht-Geschichte beharrte, sagte, während sie auf die neue Familie zeigte: «Ihre Mutter ist auf unserer Seite, und ihr Vater ist für Baschar. Mein Vater ist ein Revolutionär, und die da sind auch für Baschar, also, die sind nicht für uns. Aber das macht nichts, sie müssen sich auch bei uns verstecken, damit sie nicht sterben!»
Dieses kleine dunkelhäutige Mädchen – diese kleine Scheherazade – hatte die schönsten schwarzen Augen, die ich je gesehen habe. Sie ging ganz leichtfüßig und kämmte sich stündlich das Haar, in das sie Plastikblumen steckte, gelb, rot oder rosa, je nach Farbe ihrer Kleider. Sie beobachtete alle und wurde noch aufmerksamer, wenn wir in den Schutzraum hinunterstiegen. Sie kümmerte sich um ihre zweieinhalbjährige Schwester, behielt auch die anderen Kinder im Auge und erlaubte niemandem, sich mir zu nähern. Sie erzählte mir im Detail, wie die Nachbarn gestorben und wie die Männer einer nach dem anderen aus dem Ort verschwunden waren.
Kurz bevor der Beschuss aufhörte, nahm sie der zweijährigen Schwester die Granate aus der Hand und sagte ganz ruhig zu ihr: «Das ist nichts für kleine Kinder.» Sie war selbst noch nicht einmal sieben Jahre alt. Sobald wieder neues Bombardement zu hören war, nahm sie schnell ihre Schwester in den Arm und drückte sie ganz fest an sich. Eine andere Frau, deren Kinder sich in einer Ecke des Schutzraums um sie drängten, berichtete: «Die Soldaten von Baschar, die Sicherheitskräfte und die Regimeschergen sind in die Häuser eingedrungen und haben sie geplündert. Sie sind mit Lastwagen voller Munition gekommen, mit der sie uns beschossen haben. Dann sind sie mit diesen Lastern wieder abgefahren, jetzt voll beladen mit unseren gestohlenen Möbeln. Sie haben unsere Kinder getötet und unsere Wohnungen ausgeraubt. Aber warum haben sie meinen Schrank geöffnet und meine Kleider in den Hof geworfen und sich damit den Hintern abgeputzt und in die Gläser gepinkelt? Sogar mein altes Hochzeitskleid war nicht sicher vor ihnen, es ist voller Scheiße.»
In einem anderen Haus traf ich eine etwa vierzigjährige Frau, die einem Jungen über den Rücken streichelte. Er war etwas über zehn Jahre alt und der Einzige, der ihr geblieben war. Er war geistig behindert, er sprach nicht, seine blauen Augen lachten, sein schönes Gesicht hatte die Farbe von Weizen, und aus dem stets offenen Mund floss der Speichel. Die Frau hatte noch drei andere Söhne gehabt. Mit weit aufgerissenen Augen erzählte sie in allen Einzelheiten, wie man ihr einen der Söhne aus den Armen gerissen hatte. Ihre Augen röteten sich, eine Träne lief herunter, als sie berichtete:
«Mein Bruder gehörte zu den Ersten, die demonstrieren gingen. Wen immer Sie fragen, alle kennen den Namen Mohammed Haf. Er ist der Held von Saraqib. Zuerst waren es friedliche Demonstrationen, aber dann schossen sie auf uns und töteten vor aller Augen neun Menschen. Mein Bruder kämpfte bis zum letzten Atemzug. Er sagte immer zu mir: ‹Wir werden nicht als Feiglinge sterben.› Meinen zweiten Bruder haben sie auch getötet. Sie haben mein Haus in Brand gesetzt, deshalb haben wir es verlassen und sitzen nun hier. Zwei meiner Brüder wurden getötet und meinen Sohn haben sie mir entrissen. Ich habe sie angefleht, ihn in Ruhe zu lassen, aber sie haben nicht nachgegeben. Auch meinen zweiten Sohn haben sie umgebracht, und noch zwei meiner Brüder. Ich habe nur noch einen Jungen, aber der ist bei den Revolutionären. Meine Kinder sind von mir gegangen, sie sind alle weg. Nur dieser hier ist mir geblieben.» Sie zeigte auf ihren kranken Sohn, der uns verwundert anschaute und lachte. Sie fuhr fort: «Und wie Sie sehen … Was für ein Unglück! Und mein Sohn, der bei den Revolutionären ist, hat gesagt, dass er nicht zurückkommen werde, ehe Syrien befreit ist.»
Sie zeigte mir Fotos ihrer beiden getöteten Söhne. Der erste, neunzehn Jahre alt, hatte grüne Augen und goldenes Haar. Ihre Finger liefen wie Wellen über das Foto. Auf dem zweiten Foto war ein Junge zu sehen, dem gerade mal der erste Flaum über der Lippe gewachsen war. Dann zog sie ein Foto von Mohammed Haf hervor und hielt es in die Höhe. Beim vierten Foto hielt sie inne. Sie senkte den Kopf und sagte: «Den haben sie mir aus den Händen gerissen. Ich habe ihn so lange festgehalten, bis sie zu mir gekommen sind und ihn mir aus den Armen gerissen haben. Ich habe sie angefleht, sie gebeten, ihn zu verschonen. Ich bin hinter ihnen hergelaufen, aber sie haben ihn mitgenommen. Er war ein Aktivist in der Revolutionsbewegung. Sie haben ihn umgebracht. Er war noch ein Kind …»