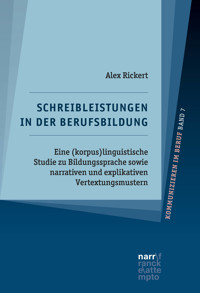
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kommunizieren im Beruf
- Sprache: Deutsch
Wer gut lesen und schreiben kann, hat bessere Chancen im Beruf - und in der Gesellschaft. Trotz ihrer Bedeutung sind die Schreibfähigkeiten junger Erwachsener in der Berufsbildung nur wenig erforscht. Diese Studie untersucht, wie (gut) junge Erwachsene am Ende ihrer beruflichen Grundbildung schreiben. Die Schreibleistungen von Lernenden wurden anhand von 227 Abschlussarbeiten analysiert. Welches Register nutzen die Lernenden beim Schreiben? Welche Ausprägungen weisen die Texte im Kontinuum zwischen Alltags- und Bildungssprache auf? Wie elaboriert sind erzählende und erklärende Textstrukturen ausgestaltet? Diesen Fragen geht die Studie nach. Die Resultate zeigen, dass besonders Lernende aus kurzen Ausbildungsgängen (mit niedrigem Anspruchsniveau) gezielt gefördert werden sollten. Die entwickelten Kriterienraster und Textprofile bieten Ansätze für die Förderung von Schreibkompetenzen im Unterricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alex Rickert
Schreibleistungen in der Berufsbildung
Eine (korpus)linguistische Studie zu Bildungssprache sowie narrativen und explikativen Vertextungsmustern
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Dr. phil. Alex Rickert
Leiter Schreibzentrum, Pädagogische Hochschule Zürich, Schreibzentrum, Abteilung Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung, Lagerstrasse 2, CH-8090 Zürich
https://orcid.org/0009-0009-4202-0521
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381132423
© 2025 · Alex Rickert
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
ISSN 2699-3252
ISBN 978-3-381-13241-6 (Print)
ISBN 978-3-381-13243-0 (ePub)
Inhalt
Danksagung
Viele Menschen haben dazu beigetragen, diese Dissertation zu ermöglichen. Ich danke den Lehrpersonen für den Feldzugang und insbesondere den Berufslernenden, die bereitwillig ihre Abschlussarbeiten zur Verfügung gestellt haben. Den Betreuern dieser Arbeit – Heiko Hausendorf und Christian Efing – danke ich für die zahlreichen konstruktiven Anregungen und Impulse sowie für das Vertrauen und die inhaltlichen Freiräume, die sie mir gewährt haben. Kirsten Schindler danke ich für die Mitbegutachtung der Arbeit. Bei Martin Volk vom Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich bedanke ich mich herzlich für die Unterstützung bei technischen Fragen zur Korpusaufbereitung. Ein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen vom Schreibzentrum der PH Zürich, die die Entstehung dieser Arbeit mitverfolgt haben und mir Rückhalt gaben. Nur durch eine gute und wertschätzende Zusammenarbeit ist es möglich, solche Projekte neben dem hektischen Arbeitsalltag zu realisieren. Mein Dank geht in alphabetischer Reihenfolge an Daniel Ammann, David Romero, Erik Altorfer, Maik Philipp, Martina Meienberg, Monique Honegger, Peter Holzwarth und Yves Furer. Meinen Vorgesetzten Markus Weil und Geri Thomann danke ich für die Unterstützung und das Ermöglichen von Schreibzeiten. Methodische Impulse erhielt ich durch die Zusammenarbeit in einem Forschungsprojekt mit Liana Konstantinidou, Joachim Hoefele und Elsa Liste Lamas. Ihnen sei herzlich gedankt. Ein großes Dankeschön gebührt auch meinem persönlichen Umfeld. Meine Familie und Freunde haben Höhen und Tiefen abgefedert und mich immer wieder aus dem Arbeitstunnel gezogen. Zutiefst dankbar bin ich Lea, die mich in vielerlei Hinsicht und zu jeder Zeit unterstützt hat. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen.
Abstract
Die Anforderungen an Lese- und Schreibfähigkeiten sind in einer digitalen und automatisierten Berufswelt hoch und nehmen stetig zu. Weit entwickelte sprachliche Kompetenzen sind nicht nur für hochqualifizierte Berufe, sondern auch für die grundlegende berufliche Ausbildung relevant und gehen einher mit beruflichem und sozialem Aufstieg.
In den deutschsprachigen Ländern Europas absolviert ein Großteil der Jugendlichen auf der Sekundarstufe II eine berufliche Ausbildung. Über die Schreibkompetenzen dieser jungen Menschen ist wenig bekannt. Aus Leistungsstudien geht unter anderem hervor, dass Berufslernende Mühe bei der Wahl des sprachlichen und insbesondere bei der Realisierung des bildungssprachlich geprägten Registers haben. Weitere Probleme bestehen, wenn es darum geht, Texte adäquat zu strukturieren und die Textfunktion zu erfüllen. Erst wenig bekannt ist, wie kontext- und personenbezogene Merkmale, beispielsweise Anspruchsniveau der Lehre, Migrationshintergrund oder Mehrsprachigkeit, mit Schreibleistungen zusammenhängen.
Davon ausgehend war das Ziel dieses Vorhabens, Schreibleistungen von Lernenden am Ende ihrer Berufsausbildung mit Blick auf die „Bildungssprachlichkeit“ im Register sowie auf narrative und explikative Vertextungsmuster zu beschreiben. Hierfür wurden in zwei separaten Studien schriftliche Arbeiten analysiert, die im Rahmen des schulischen Qualifikationsverfahrens zum Abschluss der beruflichen Grundausbildung verfasst worden waren.
Untersuchung A fokussierte das Ausmaß an „Bildungssprachlichkeit“ im Registergebrauch. Es handelte sich um eine korpuslinguistische Analyse, für die 17 bildungs- und alltagssprachliche Merkmale in 227 Abschlussarbeiten in den Blick genommen wurden. Ferner wurde mit statistischen Verfahren ausgewertet, ob Zusammenhänge zwischen der „Bildungssprachlichkeit“ in den Texten und personenbezogenen Merkmalen der Verfasser:innen auftreten. Letztere waren zuvor mittels Fragebogen erhoben worden. Aus Untersuchung A resultierten zwei Hauptbefunde: 1) Bildungssprache und Alltagssprache stehen in reziprokem Verhältnis und sind Gegenpole. 2) Es besteht einzig ein Zusammenhang zwischen dem Anspruchsniveau der Lehre und der bildungssprachlichen Prägung der Texte. Bei den anderen personenbezogenen Merkmalen Gender, Vorbildung, Migrationshintergrund, Erstsprache und Alter beim Deutscherwerb war kein Zusammenhang mit „Bildungssprachlichkeit“ auszumachen. Eine zentrale Implikation aus der Untersuchung ist, dass die Förderung einer umfassenden Registerkompetenz insbesondere bei Lernenden in Ausbildungsgängen des niedrigeren Anspruchsniveaus elementar ist.
In Untersuchung B wurde die Reichhaltigkeit narrativer und explikativer Vertextungsmuster in einem kleinen Subkorpus (zehn narrativ und zehn explikativ geprägte Textauszüge aus 20 Arbeiten aus dem Gesamtkorpus) codiert und analysiert. Das Ziel war einerseits, narrative und explikative Profile hervorzubringen. Andererseits sollte eruiert werden, ob reichhaltiger ausgebaute Vertextungsmuster mit einem höheren Grad an Bildungssprachlichkeit im Register zusammenhängen. Analysewerkzeuge für beide Muster waren theoretisch hergeleitete und induktiv weiterentwickelte Codierschemata. Durch die Annotation der Texte konnte für jeden Text festgestellt werden, wie reichhaltig das Muster ausgebaut ist. Aus der Analyse resultierten Profile, denen sich die Texte qua struktureller Beschaffenheit zuordnen ließen. Dies sind die drei narrativen Profile Erzählung mit Dramatisierung, Schilderung mit evaluativen Elementen und reine Schilderung sowie die drei explikativen Profile Tiefenerklärung (wenige Aspekte werden profund erklärt), ausgewogene Erklärung und Breitenerklärung (viele Aspekte werden oberflächlich erklärt). Zweites Resultat ist ein tendenzieller Zusammenhang zwischen Reichhaltigkeit und Bildungssprachlichkeit, der sich zwar prozentual, aber aufgrund der kleinen Fallzahl nicht statistisch signifikant nachweisen liess. Das Potenzial, das sich aus Untersuchung B ableiten lässt, liegt insbesondere in den entwickelten Codeschemata. Die darin definierten strukturellen Elemente zu beiden Vertextungsmustern können didaktisch als Bausteine der Textbildung nutzbar gemacht werden. In der Arbeit wird der didaktische Einsatz solcher Bausteine im Rahmen von Schreibstrategien skizziert.
1Einleitung
Das Schreiben ist aus dem beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken. Die fortschreitende Digitalität sowie der hohe Automatisierungs- und Spezialisierungsgrad in der Berufswelt führen dazu, dass die literalen Anforderungen im Arbeitsleben steigen (Brown, Teravainen-Goff & Clark 2023; Lauer & Brumberger 2019; Jakobs, Lehnen & Schindler 2005; Sander 2021). Dies gilt nicht nur für Berufszweige, in denen Hochqualifizierte tätig sind, sondern zunehmend auch für Berufe, die im Rahmen einer beruflichen Grundausbildung erlernt werden (Neumann 2016). Natürlich variiert die Komplexität von schriftlich zu bewältigenden Aufgaben je nach Kontext. Das Spektrum des beruflichen Schreibens reicht vom (vermeintlich) einfacheren Ausfüllen von Formularen bis zu komplexen digitalen Schreibprozessen mit integralen Feedbackschleifen, an denen mehrere Personen beteiligt sind (Jakobs, Lehnen & Schindler 2005; Schindler 2017; Wendt & Neumann 2023). Insgesamt wird das Schreiben in der Arbeitswelt tendenziell kollaborativer und digitaler. Ein wesentlicher Aspekt des digitalen Schreibens ist der Umgang mit der Fülle an frei zugänglichen Informationen, in deren Folge sich das Schreiben verschiebt vom Herstellen von Inhalten hin zum Prüfen und neuen Zusammensetzen bestehender Informationen (Lauer & Brumberger 2019; List 2019).
Im Bereich der beruflichen Ausbildung auf der Sekundarstufe II geht aus Untersuchungen zu literalen Anforderungen hervor, dass Berufslernende im Lehrbetrieb im Gegensatz zur Berufsfachschule nur selten Texte schreiben oder lesen, „die der schulisch vermittelten Definition eines Textes als lineares, kohärentes, komplex versprachlichtes Gebilde (‹Fließtext›) entsprechen“ (Efing 2014, 9). Berufslernende schreiben – weitgehend unabhängig vom Beruf – unter anderem Berichtshefte, Rechnungen, Bestellungen, Protokolle, Journale, Briefe und E-Mails. Es gibt in der Berufsbildung deshalb eine Debatte darüber, welche Art des Schreibens (und Lesens) gefördert werden soll. Gemäß einer der vertretenen Positionen sollte die Schreib- und Leseförderung in Berufsfachschulen stärker an die kommunikativen Anforderungen im Betrieb angelehnt werden, da dies für die Berufsausübung zielführend und nutzbringend sei. Demgegenüber wird aus einer gesellschaftlichen Makroperspektive dafür argumentiert, literale Fähigkeiten zu fördern, die stärker allgemeinbildenden Charakter haben, und berufsspezifische Schreibfähigkeiten primär „on the job“ zu erwerben. Mit gut ausgebildeten allgemeinen, das heißt berufsunabhängigen Schreib- und Lesekompetenzen können sich junge Berufsleute eher weiterqualifizieren und sich in der Berufswelt mobiler bewegen. Es gibt empirische Evidenz dafür, dass die Lohn- und Statusentwicklung von Absolventen und Absolventinnen von Berufslehren in den ersten Erwerbsjahren umso schneller voranschreitet, je mehr Allgemeinbildung, zu der unter anderem Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten gehören, vermittelt wird (Kriesi & Grønning 2021). Dass das allgemeinbildende Schreiben nach der Schulzeit weiter eine zentrale Kompetenz darstellt, wird von Lehrpersonen der Sekundarstufe I und II bestätigt, die dieser Aussage in einer Studie von Kiuhara et al. (2009: 149) zu 98% zustimmten. Vor diesem Hintergrund wird offensichtlich, dass die Ausbildung von Schreibfähigkeiten in der beruflichen Ausbildung sehr wichtig ist.
Trotz der Bedeutung des Schreibens ist forschungsseitig wenig über Schreibkompetenzen von Berufslernenden bekannt – obwohl in der Schweiz rund zwei Drittel der Jugendlichen auf der Sekundarstufe II eine Berufsausbildung absolvieren1. Auf der Berufsbildungsstufe gibt es Untersuchungen zum Schreiben, die als Interventionen zur Messung der Wirksamkeit von Schreibförderansätzen konzipiert sind (Giera 2020; Konstantinidou, Hoefele & Kruse 2016; Konstantinidou et al. 2022). Ein anderes Bündel von Studien untersuchen Schreibkompetenzen von Berufslernenden, indem Schreibleistungen anhand von Produkten gemessen werden. Diese Studien analysieren je nach Fokus einzelne oder verschiedene linguistische Ebenen in Texten, etwa Orthografie, Struktur, Stil oder globale Erfüllung der Textfunktion (Baumann 2014; Biedebach 2006; Efing 2008; Efing 2011; Neumann 2006; Neumann 2007; Sturm 2014; Wyss Kolb 1995). Die einzelnen Studien unterscheiden sich methodisch und in Bezug auf die Stichprobengröße stark und sind kaum miteinander vergleichbar. Im Theorieteil der Arbeit wird detailliert auf den Stand der Forschung eingegangen, an dieser Stelle nur auf einige wesentliche Aspekte zur Einführung in das Thema.
Insgesamt zeichnet der Forschungsstand zur Schreibkompetenz von Jugendlichen in der beruflichen Bildung ein disparates Bild mit uneinheitlichen Ergebnissen. Fasst man Befunde aus den Schreibkompetenz- und Leistungsstudien in den Blick, dann erscheinen die Erkenntnisse zur Orthografie am kohärentesten. Es wird deutlich, dass die Entwicklung sprachlich korrekter Schreibung bei Berufslernenden noch nicht abgeschlossen ist und Defizite bei einem beträchtlichen Teil der Lernenden bestehen. Hinsichtlich der Fähigkeit, Texte adäquat strukturieren zu können, zeigen mehrere, aber nicht alle Studien signifikante Problemlagen auf. Die adäquate Textstrukturierung wird als eines der Hauptprobleme beim Schreiben betrachtet. Auch die Befunde zur Fähigkeit, die Textfunktion gesamtheitlich zu erfüllen, sind ambivalent und führen zu unterschiedlichen Einschätzungen in den Untersuchungen. Ähnlich variabel sind die Ergebnisse bezüglich der Formulierungsfähigkeiten, wobei global Defizite festgestellt werden.
In manchen Untersuchungen werden die Leistungen nach individuellen Merkmalen wie Sprachhintergrund, Herkunft oder sozio-ökonomischem Hintergrund aufgeschlüsselt. So wird eruiert, welche Gruppen von Jugendlichen besonders vulnerabel sind. Es werden vergleichsweise geringere Schreibkompetenzen bei Jugendlichen festgestellt, die entweder vor Beginn ihrer Berufsausbildung eine Schulstufe mit niedrigerem Anspruchsniveau absolvierten oder eine Berufslehre mit geringem Anspruchsniveau durchlaufen. Divergenzen in den Ergebnissen bestehen hinsichtlich Personen mit Migrationshintergrund und/oder nichtdeutscher Erstsprache sowie in Bezug auf das Geschlecht.
Aufgrund der lückenhaften Forschungslage zur Schreibleistung und der bestehenden Abweichungen in den Ergebnissen besteht weiterhin ein Bedarf an Forschung, um zu untersuchen, wie (gut) Berufslernende schreiben und welche Personengruppen spezifische Förderung benötigen.
1.1Ziele und Fragestellungen
Die vorliegende Studie zielt darauf ab, Schreibleistungen von Berufslernenden am Ende der Berufsausbildung zu analysieren, und fasst dafür Abschlussarbeiten, sogenannte „Vertiefungsarbeiten“, in den Blick. Das Vorhaben fokussiert einerseits das bildungssprachliche Register und andererseits die Vertextungsmuster Narration und Explikation. Die übergeordnete Fragestellung lautet: Welche Schreibleistungen zeigen Berufslernende in Abschlussarbeiten in Bezug auf „Bildungssprachlichkeit“ des Registers sowie auf narrative und explikative Vertextungsmuster?
Die Fragestellung wird entsprechend den beiden Schwerpunkten in Teilfragen unterteilt, die im Rahmen von zwei Untersuchungen beantwortet werden. Die Fragen zum Register (Untersuchung A) lauten:
In welchem Ausmaß treten ausgewählte bildungs- und alltagssprachliche Registermerkmale im Korpus zutage und in welcher Beziehung stehen sie zueinander?
Inwiefern unterscheiden sich Lernendengruppen in Bezug auf die Verwendung bildungs- und alltagssprachlicher Merkmale?
Inwiefern unterscheiden sich die Textsegmente Einleitung, Sachkapitel, Erfahrungsbericht, Interview, Umfrage, Reflexion und Schlussteil in Bezug auf bildungs- und alltagssprachliche Merkmale?
Die Fragen zu narrativen und explikativen Vertextungsmustern (Untersuchung B) lauten folgendermaßen:
Wie reichhaltig sind die Vertextungsmuster Narration und Explikation ausgestaltet und welche Realisierungsformen der Muster treten in Erscheinung?
Inwiefern gibt es einen Zusammenhang zwischen der Reichhaltigkeit eines Vertextungsmusters und der Bildungssprachlichkeit eines Textes?
Diese Fragestellungen leiten sich aus dem Forschungsbedarf her. Ein Bereich, der erst spärlich untersucht ist, ist das sprachliche Register: Mit Ausnahme des Modellversuchs „VOLI“ (Biedebach 2006; Efing 2008; Efing 2011) gibt es keine systematische Untersuchung von Registerperformanz in Texten von Berufslernenden. Zusätzlich ist die Frage strittig und untersuchungswürdig, welche personenbezogenen Faktoren (beispielsweise der sprachbiografische Hintergrund) mit der Schreibleistung zusammenhängen. Mehr Resultate liegen im Bereich der Textstruktur vor, sie sind jedoch widersprüchlich. Daher wird die Vertextungsstruktur in diesem Vorhaben untersucht. Weitere Themen, denen sich bislang die Forschung zwar nicht gewidmet hat, die aber nicht im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, sind die Schreibprozesse von Berufslernenden sowie die Vermittlungspraxis, also die Art und Effektivität von Schreibförderung, die in den Berufsfachschulen stattfindet.
Die vorliegende Studie befasst sich mit Schreibleistungen. Unter Schreibleistungen werden hier die Ausprägungen spezifischer sprachlicher Merkmale subsumiert, die jedoch nicht normativ beurteilt werden. Anstelle einer Einschätzung der Qualität fokussiert dieses Vorhaben einerseits auf der Ebene des Registers das Auftreten ausgewählter Merkmale und wertet es gruppenspezifisch aus. Andererseits werden im Rahmen einer Analyse von Vertextungsmustern narrative und explikative Profile skizziert, die für Schreibförderung nutzbar gemacht werden können.
Auf die beiden Schwerpunkte – Register „Bildungssprache“ und Vertextungsmuster – sei an dieser Stelle kurz näher eingegangen. Als sprachliches Register ist „Bildungssprache“ noch immer unscharf konturiert (Efing 2022). Das in der Bildungsforschung seit den 2000er-Jahren intensiv diskutierte Konstrukt ist jedoch relevant, weil das Beherrschen des bildungssprachlichen Registers nachweislich mit schulischem Erfolg und sozialem Aufstieg zusammenhängt (Gogolin & Duarte 2016; Marx, Ehrig & Weiß 2016). Daher liegt ein Fokus dieses Vorhabens auf dem bildungssprachlichen Sprachgebrauch in den Texten von Berufslernenden. In einem ersten Schritt werden die Schreibleistungen in Bezug auf das bildungssprachliche Register in Abschlussarbeiten von Berufslernenden erfasst. Hierfür werden textuelle Aspekte in Bezug auf Lexik und (Morpho-)Syntax untersucht. Diese Ebenen sind Parameter der Schreib- und Registerkompetenz. In Überblicksarbeiten von Crossley (2020) und McNamara et al. (2010) haben sich bildungssprachliche Registerausprägungen wie lexikalische Vielfalt und „Sophistication“, syntaktische Komplexität und Textverknüpfung als Prädiktoren für Textqualität erwiesen. Schreibende Personen wählen Formulierungen (Wörter und grammatikalische Konstruktionen) und Textverknüpfungsmuster so aus, dass sie die kommunikative Aufgabe angemessen erfüllen. Die Ebenen der Lexik und der Grammatik sind daher die Hebel, um unterschiedliche Register zu realisieren, und werden im Rahmen dieser Studie untersucht. Im Diskurs wird Bildungssprache oft der „Alltagssprache“ gegenübergestellt, wobei zwischen den beiden Polen ein kontinuierlicher Verlauf besteht (Efing 2022; Feilke 2012; Morek & Heller 2012). Bildungssprache wird auch in dieser Arbeit innerhalb dieses Kontinuums aufgefasst. Das Auftreten von insgesamt 17 Merkmalen der Bildungs- und Alltagssprache wird theoretisch hergeleitet und in allen Texten analysiert und quantifiziert. In einem zweiten Schritt wird der Zusammenhang von personenbezogenen Faktoren und dem Grad an „Bildungssprachlichkeit“ eines Textes geprüft. Mit „Bildungssprachlichkeit“ ist ein empirisch hervorgebrachter Wert gemeint, der die Position eines Textes im Kontinuum zwischen Bildungs- und Alltagssprache angibt. Ziel dabei ist, zu eruieren, inwiefern sich Personen mit unterschiedlichen sprachlichen und biografischen Hintergründen in Bezug auf den Grad an „Bildungssprachlichkeit“ unterscheiden.
Der zweite Fokus liegt auf der Strukturebene der Texte. Konkret werden die „Vertextungsmuster“ (Brinker et al. 2000) Narration und Explikation in den Blick genommen. Vertextungsmuster als sprachlich erzeugte und konventionalisierte Weltbezüge (Eroms 2014: 84; Hausendorf et al. 2017: 209) sind für das Schreiben und Verstehen von Texten zentral (Wrobel 2014). Bisherige Studien referieren mitunter widersprüchliche Resultate zur Kompetenz von Berufslernenden, Texte angemessen strukturieren zu können. Untersucht wird deshalb, wie reichhaltig die realisierten explikativen und narrativen Muster sind. Das Ziel hierbei ist es, Profile verschiedener Realisierungsformen dieser Muster zu abstrahieren und das Potenzial dieser Profile für die Schreibförderung zu skizzieren. Es werden nur narrative und explikative Vertextungsmuster untersucht, keine argumentative und deskriptive, die in der Systematik von Brinker et al. (2000) ebenfalls zu den Vertextungsmustern gezählt werden. Der Grund dafür ist, dass im Untersuchungskorpus kaum argumentative Muster auftreten und deskriptive Muster für eine Analyse zu breit gestreut und zu kleinteilig sind. Weil narrative und explikative Vertextungsmuster nur anhand einer kleinen Stichprobe analysiert werden, werden Zusammenhänge mit personenbezogenen Merkmalen außer Acht gelassen. Die beiden Schwerpunkte verfolgen demnach verschiedene Ziele und Fragestellungen, die im Kapitel 7 noch detaillierter ausgeführt werden.
1.2Methodisches Vorgehen
1.3Aufbau der Arbeit
Die Arbeit ist wie folgt gegliedert: Im theoretischen Teil wird zuerst auf das Verhältnis zwischen Schreibkompetenz, Schreibprozessen und Schreibleistung eingegangen und das Vorhaben wird in einem Schreibkompetenzmodell verortet (Kap. 2). Das daran anschließende dritte Kapitel befasst sich mit dem Forschungsstand zum Schreiben in der beruflichen Bildung (Kap. 3.1) und beschreibt die Vertiefungsarbeit (VA) als Qualifikationsarbeit der beruflichen Grundbildung (Kap. 3.2). Hierbei wird auch auf schwierigkeitsgenerierende Merkmale von Schreibaufgaben eingegangen, die diesen Abschlussarbeiten zugrunde liegen.
Als Nächstes folgen mehrere Kapitel, die die theoretische Grundlage bilden. Zunächst werden im Kapitel 4 die miteinander verwandten Begriffe Varietät, Register und Stil definiert und voneinander abgegrenzt. Das fünfte Kapitel befasst sich ausführlich mit dem Register(konstrukt) Bildungssprache unter den Aspekten seiner Bedeutung für Schulerfolg, seiner Definitionen und Vorläuferkonzeptionen, seiner Funktion und Abgrenzbarkeit gegenüber anderen Registern sowie seiner sprachlichen Eigenschaften. Das daran anschließende Kapitel 6 legt die theoretische Basis für die Untersuchung B. Es thematisiert die Relevanz und die Funktion von Vertextungsmustern fürs Schreiben und geht im Detail auf die Vertextungsmuster Narration, Deskription, Explikation und Argumentation ein.
Damit ist der theoretische Teil beendet und es folgt im Kapitel 7 die Herleitung des Forschungsvorhabens mit den Fragestellungen zu beiden Untersuchungen, bevor diese im Einzelnen wieder getrennt dargestellt werden. Kapitel 8 (Untersuchung A gewidmet) und Kapitel 9 (Untersuchung B gewidmet) enthalten jeweils Teilkapitel mit Ausführungen zur Stichprobe, zur Methode und zu den Ergebnissen.
Im Kapitel 10 werden die Ergebnisse der beiden Studien gesamthaft diskutiert, indem die Fragestellungen beantwortet, praktische Implikationen skizziert, Limitationen des Vorhabens diskutiert werden. Ein Ausblick schließt das Kapitel und die gesamte Arbeit ab.
2Schreibkompetenz, Schreibprozess und Schreibleistung
Was bedeutet es, kompetent schreiben zu können? Wer die Aufgabe erhält, eine Geschichte zu schreiben, braucht einen Plan für eine spannende, auf die Leserschaft ausgerichtete Gestaltung der Geschehnisse und damit Wissen über ein bestimmtes Textmuster. Zusätzlich ist Hintergrund- und Weltwissen nötig, um Orte, Personen und Ereignisse darzustellen. Ferner sollte die Geschichte passend und nach Möglichkeit korrekt formuliert werden. Solche Aktivitäten laufen parallel ab und müssen von der schreibenden Person stetig überwacht und reguliert werden. All das macht das Schreiben einer Geschichte, aber auch anderer Texte, zu einer kognitiv höchst anspruchsvollen Tätigkeit. Wer sie meistert, darf sich als kompetente Schreiberin, als kompetenter Schreiber bezeichnen.
Dieses Kapitel geht der Frage nach, was Schreibkompetenz ist und in welchem Verhältnis sie zu den kognitiven Prozessen steht, die beim Schreiben ablaufen. Zunächst wird ausgehend von einem Kompetenzbegriff aus der Pädagogischen Psychologie dargelegt, wie Kompetenz in der Domäne Schreiben modelliert wird. Hierbei wird auch ein einschlägiges Schreibprozessmodell referiert, das für Kompetenzmodellierungen grundlegend ist (Teilkapitel 2.1). Im Anschluss daran werden zwei Schreibkompetenzmodelle genauer vorgestellt und miteinander verglichen (Teilkapitel 2.2). Nachfolgend wird das Vorhaben, sprachliche Erscheinungsformen auf den Ebenen Register und Vertextungsstruktur zu analysieren, in einem Schreibkompetenzmodell verortet (Teilkapitel 2.3).
2.1Schreibkompetenz: erfolgreiches Zusammenwirken von Schreibprozessen
Es existiert mittlerweile eine beträchtliche Menge an Definitions- und Modellvorschlägen, die Schreibkompetenz global zu beschreiben versuchen. Zentrale Bezugspunkte hierfür bilden einerseits Modellierungen des Schreibprozesses, insbesondere das Schreibprozessmodell von Hayes & Flower (1980) sowie die überarbeitete Version von Hayes (1996) und Hayes (2012), und andererseits Kompetenzkonzeptionen aus der Pädagogischen Psychologie.
Zunächst zu Letztgenannten. In der Psychologie wird Kompetenz als Gegenbegriff zur Intelligenz verstanden. Intelligenz bezeichnet, grob gesagt, die individuelle und unveränderbare kognitive Grundausstattung eines Menschen. Der Kompetenzbegriff erfasst jene kognitiven Bereiche, die durch Erfahrung und Lernen in Situationen beeinflusst werden können (Hartig & Klieme 2006: 129–131). Unter den vielfältigen Kompetenzdefinitionen hat sich der Zugang von Weinert (2001) in den Erziehungswissenschaften und in vielen schulischen Lehrplänen weitgehend durchgesetzt. Unter Kompetenzen versteht Weinert (2001: 27–28) „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. In dieser Definition werden neben kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten motivationale, volitionale und soziale Bereitschaften als Teilaspekte der Kompetenz genannt.
Die Schreibforschung sieht durchaus Anknüpfungspunkte zur Weinert’schen Kompetenzdefinition. Gerade für Fragen der Schreibkompetenz wird sie als relevant betrachtet (Becker-Mrotzek & Schindler 2007: 8; Schmitt & Knopp 2017: 240; Sturm & Weder 2020: 141–143). Dies vor allem deshalb, weil sich in den von Weinert erwähnten Kompetenzaspekten – den kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, der motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaft sowie der Situiertheit und Erlernbarkeit – Konvergenzen zeigen zu empirisch und theoretisch eruierten Faktoren, die sich auf Schreibkompetenz auswirken. Obwohl offensichtliche Parallelen zwischen kognitiven Prozessen beim Schreiben und der Weinert’schen Kompetenzdefinition bestehen, bildet sie für die konkrete Herleitung und Konzeptualisierung von Schreibkompetenz einen weniger gewichtigen Bezugspunkt. Viele Autorinnen und Autoren nehmen Schreibprozessmodelle respektive „das Zusammenspiel von verschiedenen Ressourcen und Wissensbeständen im Schreibprozess“ (Philipp 2020a: 19) als Referenz für die Konzeption von Schreibkompetenz (z. B. Schmitt & Knopp 2017; Sturm & Weder 2020; Fix 2008). Bevor also die Frage, was Schreibkompetenz ist und wie sie modelliert wird, beantwortet werden kann, ist es wichtig zu verstehen, wie Schreiben als kognitiver Prozess funktioniert. Deshalb wird als nächstes das in der Schreibdidaktik kanonisch gewordene Schreibprozessmodell von Hayes und Flower vorgestellt.
Das Modell beschreibt die beim Schreiben beteiligten und miteinander interagierenden Prozesse. Es stellt eine Synthese empirischer und theoretischer Arbeiten zum Schreibprozess dar und lässt auch das Aufzeigen der Komplexität des Schreibens zu. Es liegt in verschiedenen Varianten vor (Hayes & Flower (1980) und in überarbeiteten Formen von Hayes (1996) und Hayes (2012)). Hier wird die Modellvariante von Hayes (1996) herangezogen, weil sie im Vergleich zur früheren Version der Rolle von motivationalen Faktoren und dem Arbeitsgedächtnis Rechnung trägt. Das 2012er-Modell unterscheidet sich von der Version von 1996 insbesondere in der Darstellung und in der etwas anderen Betonung der Rolle des Arbeitsgedächtnisses. Abbildung 1 gibt das Modell der Schreibprozesse und -komponenten grafisch wieder:
Schreibprozessmodell nach Hayes (1996, 4), Musterung der Pfeile durch den Verfasser
Die zwei Hauptbestandteile des Modells sind die Aufgabenumgebung („The Task Environment“) und das Individuum („The Individual“). Die Aufgabenumgebung beinhaltet die soziale sowie die physische Umgebung. Der Kasten zum Individuum enthält die kognitiven Prozessbündel Motivation/Affekt, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis und kognitive Prozesse, die wiederum in untergeordnete Prozesse und Wissensbestände untergliedert sind. Das Modell wird hier verwendet, um die Nähe zu Schreibkompetenzmodellen zu illustrieren. Es wird deshalb davon abgesehen, die einzelnen Komponenten detailliert zu erläutern. Stattdessen werden zwei ausgewählte Zusammenhänge zwischen Elementen fokussiert, um die Komplexität des Schreibprozesses zu illustrieren.
Belastung des Arbeitsgedächtnisses (schraffierte Pfeile)
Beim Verfassen von Texten fällen Schreibende ständig Entscheidungen. Es finden laufend Abgleichungen statt zwischen Textzielen, bisher geschriebenem Text, Textinhalten, Adressaten- und Textmusterwissen sowie Formulierungsoptionen. Diese kognitiven Vorgänge können gleichzeitig relevant sein und müssen koordiniert werden – das ist eine Leistung des Arbeitsgedächtnisses (Kellogg & Whiteford 2012; Sturm & Weder 2020: 14). Da es nur beschränkte Kapazität hat, stellt es gewissermaßen einen Flaschenhals beim Schreiben dar. Es baut sich bis zum Erwachsenenalter aus und gewinnt an Schnelligkeit. Erwachsene verfügen auch über ein weiter entwickeltes Langzeitgedächtnis als Kinder. Es entlastet beim Schreiben das Arbeitsgedächtnis. Wenn etwa basale Schreibfertigkeiten automatisiert ablaufen oder wenn Wissen über Textsorten vorliegt, wird das Arbeitsgedächtnis dafür nicht oder kaum beansprucht (Sturm & Weder 2020: 15).
Abgleich mit Aufgabenumgebung (gepunktete Pfeile)
Im 1996er-Modell wird die Schreibaufgabe in der Aufgabenumgebung im Vergleich zum Modell von 1980 nicht mehr explizit aufgeführt. Sie tritt jedoch bei der Beschreibung der Überarbeitungsprozesse zum Vorschein. Aus didaktischer Perspektive ist klar, dass die Schreibaufgabe eine zentrale Rolle beim Schreiben einnimmt. Sie ist in schulischen Kontexten Dreh- und Angelpunkt für Planungs-, Formulierungs- und Revisionsprozesse. Die Schreibaufgabe bestimmt je nach Explizitheit und Art der Aufgabe das Anforderungsniveau und damit auch die Ansprüche an das Arbeits- und Langzeitgedächtnis. So ist aus Schreibentwicklungsstudien bekannt, dass Aufgaben zum Schreiben narrativer Texte leichter und besser gelöst werden als argumentative Schreibaufgaben, da das Verfassen narrativer Texte vergleichsweise weniger kognitiv belastend ist (Kellogg 2001), unter anderem weil die geforderten narrativer Textmuster bekannter und geläufiger sind. Die Schreibaufgabe beeinflusst auch motivationale und affektive Prozesse, die wiederum eine Rolle dabei spielen, wie (gut) die Aufgabe gelöst wird.
Hayes’ Schreibprozessmodell veranschaulicht insgesamt, wie eng die personenbezogenen Prozesse miteinander verquickt sind und wie sie mit der Aufgabenumgebung interagieren. Es verdeutlicht die Komplexität des Schreibens mit all seinen Komponenten. Viele Modellierungen zur Schreibkompetenz haben die individuellen Prozesskomponenten Motivation/Affekt, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis und kognitive Prozesse aus dem Hayes’schen Schreibprozessmodell in ihre Konzeptionen übertragen. Dies wird beispielsweise im Übersichtsbeitrag von Schmitt & Knopp (2017) ersichtlich. Die Autoren haben in einem multidisziplinären Zugang aus mehreren Modellierungen des Schreibprozesses und der Schreibentwicklung eine Synthese aus Studien zu Prädikatoren von Schreibkompetenz erstellt, in denen die individuellen Prozesskomponenten des Modells von Hayes wiedererkennbar sind. Schreibkompetenz erweist sich darin als das erfolgreiche Zusammenwirken von Schreibprozessen. Die Ergebnisse dieser Synthese führt folgende Übersicht auf:
Prädikatoren der Schreibkompetenz nach Schmitt & Knopp (2017: 241)
Die Abbildung 2 führt drei unterschiedliche Faktorenbündel auf, die die Schreibkompetenz prädizieren. Das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erstens die Kognition betreffen, zweitens die Motivation und Metakognition und drittens die Sprachkompetenz. Auf eine Erläuterung aller einzelnen Prädikatoren wird an dieser Stelle verzichtet. Vor dem Hintergrund dieser Faktorbündel definieren Schmitt & Knopp (2017: 239) Schreibkompetenz als „Ensemble zusammenwirkender Teilfähigkeiten, denen ‹sprachliche und kognitive Ressourcen sowie Wissen über Sachverhalte von Welt und Kommunikation› (Becker-Mrotzek 2014: 54) zugrunde liegen“.
In einschlägigen Definitionen und Konzeptionen zur Schreibkompetenz finden die von Schmitt & Knopp (2017) eruierten und von Sturm & Weder (2020: 144) explizit eingeforderten motivationalen, affektiven oder volitionalen Faktoren und Prädikatoren jedoch kaum Eingang, wie die nachfolgende Übersichtstabelle über Schreibkompetenzkonzepte zeigt. Stattdessen sind sprach- und textualitätsbezogene Merkmale wie Ausdruck oder Text(muster) durchgehend repräsentiert:
Feilke & Augst (1989); Augst & Faigel (1986)
Fix (2008)
Becker-Mrotzek & Schindler (2007)
Grabowski et al. (2007)
Baurmann & Pohl (2017); Pohl (2013)
Wrobel (2014)
Kompetenzaspekt/Teilkompetenz
Inhalt
Kognitive Problemdimension
Inhaltliche Kompetenz
Informationskompetenz
Kontextualisierungskompetenz
Sach-/Fachkompetenz
Ausdruck
Expressive Problemdimension
Formulierungskompetenz
Sprachproduktion (Lexik und Syntax)
Sprachliche Kompetenzen
Ausdruckskompetenz und Formulierungskompetenz
Sprach- und Textkompetenz
Adressatenorientierung
Soziale Problemdimension
Zielsetzungskompetenz
Leserorientierung
Sozial-kognitive Kompetenzen
Antizipationskompetenz
Diskurskompetenz
Text
Textuelle Problemdimension
Strukturierungskompetenz
Textmuster
Kommunikativ-pragmatische Kompetenzen
Textgestaltungskompetenz
Sprach- und Textkompetenz
Planung
Inhalte elizitieren
Strategische Kompetenzen
Planungskompetenz
Prozesskompetenz
Überarbeitung
Verschiedene „Prüfverfahren“ und Reflexionsprozesse
Strategische Kompetenzen
Überarbeitungskompetenz
Prozesskompetenz
Überblick über Konzeptionen der Schreibkompetenz, leicht modifiziert und ergänzt nach Pohl (2014a: 104)
Die Tabelle 1 stellt die Modelle in abstrahierter Form dar, um einen Vergleich zu ermöglichen. Der Komplexität der Ansätze wird dabei mitunter zu wenig Rechnung getragen, insbesondere bei dem Modell von Becker-Mrotzek & Schindler (2007), das jedoch später in Teilkapitel 2.2 genauer erläutert wird. Zudem lassen sich die aufgeführten Faktoren der einzelnen Modelle nicht immer exakt einem Kompetenzaspekt zuordnen. So ist beispielsweise die Zielsetzungskompetenz bei Fix (2008) in der oberen Tabelle der Kategorie Adressatenorientierung zugewiesen. Die Zielsetzungskompetenz ist jedoch auch für Planungs- und Überarbeitungsprozesse äußerst relevant.
Gemeinsam ist den Ansätzen, dass sie die Kompetenzkriterien theoretisch herleiten und sich vornehmlich auf Schreibprozessmodelle beziehen – wie etwa Baurmann & Pohl 2017; Grabowski et al. (2007); Wrobel (2014) – und/oder auf kognitionspsychologische Modelle – z. B. das Modell zur Unterscheidung von Wissenstypen von Mandel et al. (1986) bei Fix (2008), Becker-Mrotzek & Schindler (2007) und eingeschränkt Feilke & Augst (1989). Als weitere Gemeinsamkeit aller Modelle ist die Betonung der Mehrdimensionalität von Schreibkompetenz und die jeweils betonte Interdependenz der Faktoren zu nennen. Auffällig ist zudem, dass einzelne Modelle (z. B. Baurmann & Pohl 2017) motivationale und volitionale Aspekte als Einflussgrößen für Schreibkompetenz peripher aufführen, aber keines der Modelle diese Aspekte in den Kern der Schreibkompetenz aufnimmt. Andere Kontextfaktoren wie das Schreibziel/die Aufgabe und Leserorientierung/Adressatenorientierung sind aber durchwegs als Parameter enthalten.
Der augenfälligste Unterschied zwischen den Modellen besteht darin, dass die prozessualen Teilkompetenzen Planung und Überarbeitung in den Modellierungen von Feilke & Augst 1989, Augst & Faigel 1986 und Fix (2008) nicht vertreten sind. In den anderen Konzeptionen nehmen diese Prozesskompetenzen einen hohen Stellenwert ein.
2.2Zwei Schreibkompetenzmodelle im Vergleich
Im Folgenden werden zwei in der deutschsprachigen Schreibforschung prominente Modelle der Schreibkompetenz genauer vorgestellt und miteinander verglichen. Zuerst wird das Kompetenzmodell für den Bereich Schreiben von Baurmann & Pohl (2017) kurz umrissen. Danach wird das Kompetenzmodell Schreiben von Becker-Mrotzek & Schindler (2007) ausführlicher erläutert, in welchem sich das Vorhaben dieser Untersuchung verorten lässt.
Das Schreibkompetenzmodell von Baurmann & Pohl (2017: 94–98) trägt dem Umstand Rechnung, dass Schreibkompetenz eine prozess- und eine produktorientierte Seite aufweist:
Kompetenzmodell für den Bereich Schreiben von Baurmann & Pohl (2017: 96)
Die Prozessperspektive nimmt die drei Komponenten des Schreibprozessmodells von Hayes & Flower (1980) auf. Aus Prozesssicht sind die Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungskompetenz Teil der Schreibkompetenz. Für die Charakterisierung der Produktperspektive orientieren sich die Autoren an Vorarbeiten von Feilke & Augst (1989). Deren Annahme lautet, dass die Anforderungen an die schriftliche Kommunikation im Vergleich zur mündlichen aufgrund fehlender Ausdrucksmöglichkeiten durch Mimik und Gestik hoch sind. Im Modell von Baurmann & Pohl (2017) werden daraus für die Produktperspektive eine Ausdrucks-, Kontextualisierungs-, Antizipations- und Textgestaltungskompetenz hergeleitet.
Allgemeine kognitive Fähigkeiten, motivationale Faktoren sowie die verschiedenen Arten von Wissen (deklarativ, prozedural, metakognitiv/Problemlösungswissen) werden als Grundvoraussetzungen für das Schreiben anerkannt, stehen jedoch außerhalb des Kernmodells, weil sie für viele Kompetenzbereiche relevant seien, nicht nur für das Schreiben. Die Autoren betonen ferner, dass es keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen Prozess- und Produktaspekten gebe, diese aber sehr wohl zusammenwirken. Beispielsweise können produktseitige Schwächen in der Leserantizipation auf unzureichende Planung, unpassende Formulierungen oder auf oberflächliche Überarbeitungsprozesse zurückgeführt werden (Baurmann & Pohl 2017: 97). So gesehen sind die sieben im Modell genannten Prozess- und Produktkomponenten disparate Kompetenzaspekte, die für die Schreibförderung einzeln adressiert werden können und im Verbund die Schreibkompetenz eines Individuums definieren.
Einen anderen Zugang wählen Becker-Mrotzek & Schindler (2007). Schreibkompetenz wird in ihrem Modell nicht aus der Perspektive von Prozessen und Produkten, sondern von verschiedenen Wissensarten aus betrachtet. Diese wurden im oben beschriebenen Modell von Baurmann & Pohl (2017) weitgehend ausgeklammert. Becker-Mrotzek & Schindler ziehen die Wissensarten heran, um die genuin linguistischen und pragmatischen Aspekte des Schreibens für unterschiedliche Arten von Wissen zu beschreiben.
Zuerst werden die zwei theoretischen Bezugspunkte des Modells ausgeführt. Der erste Bezugspunkt ist die aus der Pädagogischen Psychologie stammende Differenzierung des Wissensbegriffs nach Mandl et al. (1986), die vier Arten von Wissen unterscheiden. Becker-Mrotzek & Schindler (2007) setzen die vier Wissenstypen deklaratives Wissen, Problemlöse-Wissen, prozedurales Wissen und metakognitives Wissen mit Faktoren der Schreibkompetenz in Beziehung. Der zweite Bezugspunkt ist das von Ossner (2006) entwickelte Kompetenzmodell für die Fachdidaktik Deutsch. Es wird unterteilt in die Bereiche Sprechen und Zuhören, Schreiben, Lesen und Umgang mit Texten sowie Sprache und Sprachgebrauch untersuchen. Becker-Mrotzeks & Schindlers Schreibkompetenzmodell kann als Ausdifferenzierung des Ossner’schen Modells für den Bereich Schreiben gesehen werden. Dadurch ergibt sich folgende Matrix, die die Schreibkompetenz definiert:
Schreibkompetenzmodell nach Becker-Mrotzek & Schindler (2007)
Die auf der Y-Achse abgebildeten Wissenstypen definieren Becker-Mrotzek & Schindler (2007: 9) mit Bezug auf Mandl et al. (1986) folgendermaßen:
Deklaratives Wissen: Faktenwissen, Wissen über Sachverhalte von Welt (= Wissen, was / „Knowing what“);
Problemlöse-Wissen: Methodisches Wissen zur Erkenntnisgewinnung (= Wissen, wie/ „Knowing how“);
Prozedurales Wissen: zu Prozeduren und Routinen verdichtetes Wissen, fließender Übergang zum Problemlösewissen;
Metakognitives Wissen: Bewusstheit des eigenen Tuns in einem Gegenstandsfeld und der eigenen Position zu diesem Gegenstandsfeld und zu diesem Tun oder, anders ausgedrückt, die Fähigkeit, das eigene Handeln und die eigene Kognition zum Gegenstand des Wissens und Nachdenkens zu machen.
Die Parameter auf der X-Achse (Anforderungen) werden mit den vier Wissenstypen in Bezug gesetzt. Jeder Anforderungsbereich wird (nach Möglichkeit) für alle vier Wissenstypen definiert. Dadurch spannt sich eine Kompetenzmatrix für den Bereich Schreiben auf. Kritisch anzumerken ist, dass die Anforderungsbereiche weder theoretisch noch empirisch hergeleitet werden; es handelt sich um Setzungen des Autors und der Autorin. Nachfolgend werden die Anforderungsbereiche von „innen“ nach „außen“, also von eher sprachnahen zu eher sprachfernen Bereichen erläutert.
Sprachproduktion i.e.S. umfasst Lexik und Syntax, verstanden als die Verwendung von Lexikon und syntaktischen Strukturen. Die Sprachproduktion i.e.S. gilt für den schriftlichen, mündlichen und gebärdeten Sprachgebrauch.
Textproduktion i.e.S. beinhaltet zusätzlich die Bereiche Textmuster und Leserorientierung. Unter Textmuster wird die inhaltliche Organisation der Texte in Abhängigkeit der Schreibaufgabe verstanden. Die Leserorientierung stellt gemäß Becker-Mrotzek & Schindler eigentlich keinen eigenen Anforderungsbereich dar, da sie sich in jedem der anderen Bereiche manifestiert. Sie wird in der Matrix aber u. a. wegen ihrer Wichtigkeit trotzdem gesondert dargestellt. Unter Leserorientierung werden „Textelemente, die explizit oder implizit dem Verstehensprozess des Lesens zugedacht sind“, verstanden (Becker-Mrotzek & Schindler 2007: 13), es handelt sich also um die Orientierung an einem „absenten“ Adressaten.
Textproduktion i.w.S. schließt zusätzlich die Orthografie als Anforderung ein und meint die Regeln zur Verwendung von Schriftzeichen.
Die domänenspezifischen Anforderungen des Schreibens umfassen zusätzlich den Aspekt Medien. Damit sind mediale Formen gemeint, die das Überdauern der Sprachproduktion sicherstellen, etwa Handschrift, Tastaturschrift oder andere mediale Formen wie Text-to-speech-Programme oder auch die Abspeicherung von Text im Gedächtnis.
Zusammengefasst beschreibt das Modell verschiedene Anforderungen, denen sich eine schreibende Person gegenüber sieht. Jede dieser Anforderungen manifestiert sich je nach Wissensart anders. Becker-Mrotzek & Schindler (2007: 16) gehen davon aus, dass Personen in den Bereichen Lexik, Syntax, Textmuster, Leserorientierung etc. über deklaratives, problemlösebezogenes, prozedurales und metakognitives Wissen verfügen, das in den jeweiligen Bereichen aber divers ausgeprägt sein kann. Die Summe des Wissens in den Bereichen bezeichnen sie als „Schreibwissen“ (Becker-Mrotzek & Schindler 2007: 16), das jedoch nicht mit Schreibkompetenz gleichzusetzen sei. Die Schreibkompetenz zeige sich, so Becker-Mrotzek & Schindler (2007: 16), immer vor dem Hintergrund der Schreibaufgabe. Schreibaufgaben, die hohe Anforderungen an Schreibende stellen, verlangen entsprechend mehr Schreibwissen zur Bewältigung der Aufgabe. Beispielsweise müssen für das Schreiben einer Argumentation Inhalte neu arrangiert werden. Das geforderte Textmuster ist komplex und wird, wie aus der Schreibentwicklungsforschung bekannt ist, später erworben als beispielsweise einfache Nacherzählungen von eigenen Erlebnissen. Schreibkompetenz sei demnach „das Produkt aus Anforderungsniveau der Schreibaufgabe und der Summe des anforderungsbezogenen Wissens“ (Becker-Mrotzek & Schindler 2007: 16). Maximale Schreibkompetenz zeigt sich, wenn Individuen eine maximale Schreibanforderung optimal zu bewältigen imstande sind. Umgekehrt liegt minimale Schreibkompetenz vor, wenn durch die Sprachproduktion nur ein Mindestmaß an Verständigung erreicht wird. Becker-Mortzek & Schindler räumen ein, dass offen bleibt, wie die Schwierigkeit einer Schreibaufgabe konkret zu bestimmen wäre. Aus der Schreibentwicklungsperspektive ist ferner ungeklärt, ob sich die Bereiche parallel, gleichzeitig, entwickeln oder – das wird angenommen – unterschiedlich schnell (Becker-Mrotzek & Schindler 2007: 17). Auf den ersten Blick ist man versucht, an diesem Modell zu kritisieren, dass es im Vergleich zu anderen Schreibkompetenzmodellen die Prozessperspektive vernachlässigt. Das ist jedoch nicht der Fall. Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungsprozesse können dem Problemlöse-Wissen im Sinne von Wissen über strategisch-methodisches Vorgehen, dem prozeduralen Wissen im Sinne etablierter Routinen oder dem metakognitiven Wissen im Sinne von kognitiver Überwachungs- und Steuerungsmechanismen zugeordnet werden. Somit sind die Prozessaspekte differenziert erfasst.
2.3Verortung des Analysevorhabens: Schreibleistungen, Schreibwissen, Schreibkompetenz
Das Modell von Becker-Mortzek & Schindler (2007) eignet sich zur Verortung des vorliegenden Vorhabens, da es im Gegensatz zu anderen Modellen in differenzierter Weise zwischen Schreibwissen und Schreibkompetenz unterscheidet. Schreibwissen ist demnach die Summe aus den vier Wissensarten für die relevanten Bereiche der Textproduktion, während sich Schreibkompetenz im Vermögen von Individuen zeigt, mental gespeichertes Schreibwissen auf eine Schreibaufgabe mit ihrer spezifischen Anforderung anzuwenden.
Die vorliegende Arbeit befasst sich jedoch nicht Schreibkompetenz im engeren Sinne, da sie nicht auf die Beurteilung abzielt, wie gut eine Schreibaufgabe bewältigt wird. Der Fokus des Vorhabens liegt vielmehr auf der Beschreibung von sprachlichen Merkmalen, die in Texten beobachtbar sind. Deshalb wird für die Zwecke dieses Vorhabens anstelle von Schreibkompetenz von Schreibleistung gesprochen. Der Begriff verweist auf die an der Textoberfläche manifesten sprachlichen Erzeugnisse von Schreibenden. Schreibleistungen sind also im Kontext einer Schreibaufgabe entstandene lesbare Spracherzeugnisse, denen spezifisches Schreibwissen im Sinne von Becker-Mrotzek & Schindler (2007) zugrunde liegt. Diese Schreibleistungen werden für die Ebene des Registers und der Vertextungsmuster beschrieben, ohne eine Qualitätseinschätzung durch Textrating vorzunehmen. Die im Rahmen dieser Untersuchung fokussierten Leistungen sind im Modell in den Bereichen der Textproduktion i.e.S. zu verorten. Konkret sind dies für die Ebene des Registers die Lexik und die Grammatik und für die Ebene der Vertextungsmuster die Textmuster. Die Analyse von Schreibleistungen auf diesen Textebenen beantwortet die Frage, wie Berufslernende ihr Schreibwissen in bildungssprachlich geprägtem Kontext in ihren Texten aktualisieren, jedoch nicht, wie gut sie dies tun. Schreibkompetenz verstanden als Zusammenspiel aller im Modell erwähnten Bereiche auf allen Wissensebenen vor dem Hintergrund einer konkreten Schreibaufgabe wird in diesem Vorhaben nicht erfasst. Hierfür müssten erstens Qualitätseinschätzungen gemacht werden, die sich eng auf die Schreibaufgabe beziehen und zusätzliche Textebenen wie den Inhalt oder die Orthografie berücksichtigen. Zweitens wären hierfür Prozessaspekte wie etwa Problemlösewissen, prozedurales und metakommunikatives Wissen einzubeziehen.
3Schreiben in der beruflichen Bildung
In diesem Kapitel wird der Forschungsstand zum Schreiben in der beruflichen Bildung skizziert (Teilkapitel 3.1). Da im empirischen Teil Schreibleistungen von Lernenden anhand von „Vertiefungsarbeiten“ analysiert werden, widmet sich das Teilkapitel 3.2 detailliert den Rahmenbedingungen, Bestandteilen und Aufgabenstellungen inklusive schwierigkeitsgenerierender Merkmale dieser Abschlussarbeiten.
3.1Forschungsstand zu Schreibleistungen von Berufslernenden
Das Forschungsfeld zu sprachlichen Kompetenzen in der beruflichen Bildung hat sich in den vergangenen zwanzig Jahr stark erweitert. Es lassen mindestens sechs Stränge identifizieren, zu denen im Folgenden einschlägige Forschungsarbeiten exemplarisch aufgeführt sind:
Erhebungen von sprachlichen Kompetenzen von (angehenden) Berufslernenden (VOLI; LAU; ULME I–III; Philipp 2015; Philipp 2018; Sturm 2014),
Interventionsstudien zur Förderung von Schreib- oder Sprachkompetenz (Giera 2020; Hoefele & Konstantinidou 2016; Konstantinidou, Hoefele & Kruse 2016; Konstantinidou et al. 2022),
Untersuchungen zu betrieblichen Text- und Schreibanforderungen (Efing 2011; Efing 2013; Efing 2014a; Steffan 2015),
Untersuchungen zum Verhältnis geforderter Ausbildungsreife und tatsächlicher Sprachleistungen (Baumann 2014; Efing 2011),
theoretische Beiträge zu Registerkonzeptionen (u. a. auch des Registers Berufssprache) (Braunert 1999; Efing 2014b; Efing 2022; Efing & Sander 2020; Sander 2021) und
betriebliche und schulische Sprachfördermaßnahmen (Überblick in Efing & Kiefer 2018).
Die Erläuterung des Forschungsstandes legt den Schwerpunkt auf empirische Studien, die sich auf die Textproduktion und damit auf die Schreibleistungen von Berufslernenden im deutschsprachigen Raum beziehen. Die Studien sind untereinander nur bedingt vergleichbar, weil sie unterschiedliche Zielsetzungen haben. Sie unterscheiden sich in Bezug auf Erhebungs-, Analyse- und Beurteilungsverfahren, Sample-Größen und Untersuchungsregionen.
Eine frühe umfassende Untersuchung zu Schreibkompetenzen von Berufslernenden in der Schweiz legte Wyss Kolb (1995) vor. Die Autorin untersuchte die Textqualität in Aufsätzen von Schweizer Berufslernenden1 des 11. und 12. Schuljahrs auf Basis des Zürcher Textanalyserasters (Nussbaumer & Sieber 1994). Die Analyse von 30 Texten ergab folgendes Bild: Zwar traten in den Texten Mängel im Bereich der Orthografie, Interpunktion und Syntax auf, doch bezeichnet Wyss Kolb (1995: 200) die Textqualität in kommunikativ-pragmatischer Hinsicht (Morphologie, Textaufbau, Satzverknüpfung und Semantik) als angemessen. Ferner verglich die Autorin in ihrer Untersuchung die Schreibleistungen von Berufslernenden mit jenen von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hinsichtlich Kriterien der Sprachnorm. Dabei zeigte sich, dass in Texten von Berufslernenden signifikant mehr Fehler in den Bereichen Orthografie, Interpunktion und Syntax zu beobachten sind. Die formale Qualität hingegen war auch bei diesen Texten auf hohem Niveau (Wyss Kolb 1995: 107, 142, 272). Da die Untersuchung testtheoretisch sehr heterogen ist (unterschiedliche Aufsatzarten und -längen, Alter der Lernenden, Messzeitpunkte), sind die Resultate kritisch zu betrachten (Neumann & Giera 2018: 331).
Die LAU-Studien („Aspekte der Lernausgangslage und der Lernentwicklung“) untersuchten im Längsschnitt verschiedene Fächer und unter anderem auch Schreibkompetenzen von Hamburger Schülerinnen und Schülern aus 100 Schulen der Klassenstufen 5, 7, 9 und 11. In der Klassenstufe 11 befand sich eine Gruppe der Jugendlichen in der gymnasialen Oberstufe, eine andere stand am Anfang einer beruflichen Ausbildung. Deshalb wurde für die Klassenstufe 11 zusätzlich zu LAU 11 das ULME-Projekt („Untersuchung der Leistung, Motivation und Einstellungen zu Beginn der beruflichen Ausbildung“) konzipiert, das die Kompetenzen von Jugendlichen zu Ausbildungsbeginn analysierte (Lehmann, Hunger et al. 2004; Neumann 2006). Die Schreibleistungen wurden nur gesamthaft für alle getesteten Jugendlichen der Klassenstufe 11, also jene aus der gymnasialen Stufe und jene in der beruflichen Ausbildung, ausgewertet (Neumann 2006). Die ULME-Studien – ULME I–III (Behörde für Schule und Berufsbildung Hamburg 2013; Lehmann, Ivanov et al. 2004; Lehmann, Seeber & Hunger 2006) berichten für das Fach Deutsch lediglich Leistungen zum Leseverständnis und zur Fehlersuche im Bereich der Rechtschreibung. Ergebnisse zu Schreibleistungen werden aus „auswertungstechnischen Gründen“ (Lehmann, Ivanov et al. 2004: 9) leider nicht berichtet. Im Rahmen von LAU 11/ULME verfassten Berufslernende sowie Schülerinnen und Schüler aus allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II im Schuljahr 2002/2003 Beschwerdebriefe (N = 3'517) und Antworten auf Beschwerdebriefe (N = 1'539). Die Texte wurden nach funktionalen, inhaltlichen, sprachlichen und formellen Merkmalen beurteilt. Inhaltliche und formale Merkmale wurden dichotom kodiert, sprachlich-textuelle Kriterien mittels einer fünfstufigen Skala doppelt blind geratet. Die Resultate förderten zutage, dass zwei Drittel der Jugendlichen einen hinreichend funktional ausgereiften Brief in Bezug auf Inhalt, Sprache und formale Korrektheit verfasst hatten. Ein Drittel verfasste Briefe auf tiefem Niveau. Die funktionalen Mängel zeigten sich u. a. im Adressatenbezug – etwa, wenn der Beschwerdebrief Angaben zum Schreibanlass oder zu Schreibzielen vermissen ließ (Neumann 2006: 28). Auf der Ebene der Korrektheit produzierten 21.4% der Probandinnen und Probanden fehlerfreie Texte. Zwei Drittel schrieben verständliche Texte. Mit Blick auf die Gesamtqualität der Briefe wurde festgestellt, dass 17.3% Texte nicht funktional und von niedriger Qualität waren, 65.3% von guter Qualität, 16.2% eine Mischung aus guten und ausgezeichneten Texten darstellten und 1.2% von ausgezeichneter Qualität waren (Neumann 2006: 28–29; Neumann & Giera 2018: 332). Interessant ist der Befund einer Nachuntersuchung von Neumann (2007), die nebst den Texten aus den LAU/ULME-Studien auch solche aus der DESI-Studie analysierte. Demnach waren Berufslernende insgesamt in der Lage, geringfügig bessere Beschwerdebriefe zu verfassen als Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Neumann 2007: 194). Mögliche Gründe für diesen Befund seien die erhöhte Schreibpraxis im beruflichen Alltag und das höhere Alter der Berufslernenden, von denen manche bereits über ein Abitur verfügten.
Andere groß angelegte Studien kamen zu weniger positiven Ergebnissen. Im Rahmen des BLK-Modellversuchs „VOLI: Vocational Literacy – Methodische und sprachliche Kompetenzen in der beruflichen Bildung“ (Biedebach 2006; Efing 2006; Efing 2008; Efing 2011) wurden zwischen 2004 und 2006 im Bundesland Hessen die sprachlichen Kompetenzen von Berufslernenden verschiedener Berufsrichtungen – Verkauf/Einzelhandel, Bäcker/Konditor, Metzger, Maurer, Frisör und andere – untersucht. Der Modellversuch hatte primär die Förderung sprachlicher Kompetenzen Berufslernender zum Ziel. Untersucht wurden 32 Klassen. Das Sample bestand aus 624 Lernenden hauptsächlich aus Teilzeitberufsbildungsklassen im Grundbildungsjahr. Gegenstand des Modellversuchs waren in erster Linie lesebezogene Kompetenzen von Berufslernenden, doch wurden auch Kompetenzen in der Textproduktion analysiert. Hierfür wurden zum einen 48 Lehrpersonen zu Problemen der Berufslernenden beim Schreiben befragt. Zum anderen wurden mit 415 Berufslernenden (fast zwei Drittel mit Hauptschulabschluss; 27% mit Realschulabschluss, 2% mit Abitur, 2% ohne Hauptschulabschluss, 4% sonstige; 31.8% mit Migrationshintergrund) Sprachstandardtests durchgeführt. Hierbei hatten die Lernenden die Aufgabe, eine kurze Inhaltszusammenfassung eines zuvor gelesenen Zeitschriftenartikels zum Thema „Alkoholunfälle im Straßenverkehr“ sowie einen persönlichen Kommentar dazu zu schreiben. Daraufhin wurden die Lehrpersonen und Lernende zum Testverlauf interviewt. Die Auswertung erfolgte in Form einer Eruierung von „Problemtypen“ (Efing 2008: 18). Hierbei wurden die „häufigsten und am schwersten wiegenden sprachlichen Problemtypen“ erhoben. Aus der Befragung der Lehrpersonen kristallisierte sich die Orthografie als primäres Problemfeld heraus. Efing (2011: 50) betont jedoch, dass dieses Verdikt „nicht unbedingt die realen Probleme spiegelt“ und auf einen „Defizitfokus der Lehrenden“ zurückgeführt werden könne. Die Analysen der Texte der Lernenden förderten Problemtypen auf verschiedenen Ebenen zutage. Diese werden im Folgenden ausführlicher erläutert, weil die Resultate auch für die vorliegende Forschungsarbeit relevant sind (Efing 2008: 22–28).
Ebene Orthografie/Interpunktion:
Fehler in der Groß-/Kleinschreibung, der Getrennt-/Zusammenschreibung von Wörtern, sinnenstellende Rechtschreibung, Interpunktion innerhalb von Sätzen und an Satzgrenzen.
Ebene Textorganisation, Textstruktur, Kohärenz und Inhalt:
Unangemessene Realisierung des geforderten Textmusters Zusammenfassung: Es treten Vermischungen von Textmustern auf. Zusammenfassungen enthalten persönliche Kommentare und Werturteile oder auch Aussagen auf einer Metaebene zum Test selbst. Damit einhergehend fiel das Fehlen sprachlicher Bausteine zur Realisierung der Textsorte auf.
Strukturierung: fehlende inhaltliche Abstraktion und Organisation der Inhalte aus dem Originaltext; kein kohärenter Gesamttext, unverbundene Übernahme von Textfragmenten aus dem Original, Fehlen oder unangemessener Einsatz von Kohäsionsmitteln, listenartige Aufzählung unverbundener Einzelsätze, keine ersichtliche Strukturierung in Einleitung, Mittelteil, Schluss.
Inhalt: Nur Inhalte aus der ersten Hälfte des Originaltexts werden verarbeitet, inhaltliche Redundanzen treten auf. Inhalte werden oft implizit ausformuliert. Inhaltliche Gedankengänge sind oft nur angedeutet und müssen von lesender Person rekonstruiert werden. Kausale Zusammenhänge werden nicht explizit hergestellt.
Ebene Stil (Lexik, Grammatik):
Formulierungen allgemein: wenig eigene Formulierungen; Übernahmen oder Paraphrasen aus Originaltext dominant.
„Parlando“-Muster (hierzu Näheres in Teilkapitel 5.2.3) im Bereich Grammatik und Stil. Fehlendes Gespür für angemessene Form der konzeptionellen Schriftlichkeit. Auftreten zahlreicher Elemente des mündlichen Sprachgebrauchs: im Bereich der Lexik z. B. Umgangssprache, Artikelkürzung („ne“ statt „eine“), du/ich-Verwendung in der Zusammenfassung, Gesprächspartikeln, Elisionen oder Wortfindungsschwierigkeiten; im Bereich Syntax z. B. weil mit Verbzweitstellung, Verbalsätze mit Subjekt-/Objektauslassung („[Ich] Fahre selber…“), Anakoluthe, Elisionen von Satzteilen, parataktischer Satzbau oder Ausklammerung.
Aus den Sprachanalysen wurde auch auf die Prozessebene rückgeschlossen. So wurde das ziellose „Drauflosschreiben“ anstelle eines Prozesses mit Planungs-, Formulierungs- und Überarbeitungsphase konstatiert (Efing 2008: 24). Die Analysen zeigen außerdem, dass die Vorbildung der Lernenden die Schreibleistungen beeinflusst. „Schüler mit höherer Vorbildung schreiben im Durchschnitt deutlich mehr und besser“ (Efing 2008: 31). Zudem erzielten Lernende mit Migrationshintergrund (um 8%) schlechtere Ergebnisse beim Lesen und Schreiben als Lernende ohne Migrationshintergrund (Efing 2006: 45), doch waren die Problemtypen bei beiden Gruppen die gleichen. Nennenswerte Unterschiede zwischen Berufsgruppen oder zwischen Frauen und Männern waren nicht auszumachen.
Baumann (2014) untersuchte in ihrer Dissertation Schreibfähigkeiten von Berufslernenden (N = 175) mit dem Ziel, diese vor dem Hintergrund der von der Bundesagentur für Arbeit geforderten „Ausbildungsreife“ zu reflektieren. Das ausgewertete Sample bestand aus 133 Texten von Lernenden aus Hamburger Berufsschulen aus den Berufszweigen Friseur, Anlagemechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und Verkäufer. Die Berufslernenden verfassten ein formales Bewerbungsschreiben und eine Bauanleitung (nach den Aufgaben aus dem FÖRMIG-Modell). Zusätzlich bearbeiteten sie die LAU-9-Aufgabe zum passiven Rechtschreibwissen. Ziel war es, Profile für Schreibkompetenz zu erstellen. Für das Rating der Texte kamen Kriterien des Zürcher Textanalyserasters zum Einsatz, zudem wurde die Textqualität global mit einer Likertskala beurteilt. Weiter setzte die Autorin ein Instrument zur Erhebung der Leserlichkeit sowie ein Beschreibungsmodell zur Eruierung der Normnähe ein. Baumann (2014) konstatiert Probleme im Bereich der Verständlichkeit (fachlich und sprachlich) sowie bei Textstrukturierungsmitteln. Nur 8.3% der Texte erwiesen sich als normnah, 31.6% waren normfern. Beim Verfassen von Bewerbungsschreiben zeigten sich 47.5% der Lernenden in der Lage, inhaltlich und formal angemessene Texte zu verfassen, 34% der Lernenden gelang dies weitgehend. Aus diesen Ergebnissen schlussfolgert die Autorin, dass auch Lernenden mit defizitären (Recht-)Schreibkompetenzen der Zugang zur Berufsbildung gelinge. Die von der Bundesagentur für Arbeit definierte „Ausbildungsreife“ müsse deswegen eher als Orientierungsnorm und nicht als Katalog von Eintrittskriterien betrachtet werden (Baumann 2014: 268).
Wenig Forschung existiert bislang zur Wirkung von Schreibfördermaßnahmen an Berufsfachschulen. In einer empirisch ausgerichteten Interventionsstudie mit Pretest-Postest-Control-Group-Design und Follow-up-Messung zeigen Hoefele & Konstantinidou (2016) und Konstantinidou et al. (2016), dass ein Schreibunterricht, der sich an der prozessorientierten Schreibdidaktik orientiert und Konzepte aus der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache aufnimmt, eine signifikante Steigerung der Schreibkompetenzen bei den Lernenden bewirkt. Das Sample bestand aus 278 Berufslernenden unterschiedlicher Berufsrichtungen. Die Texte der Lernenden wurden mithilfe eines Kriterienrasters, der sich an DESI- und VERA-Skalen sowie dem Zürcher Textanalyseraster orientiert, beurteilt. Bewertet wurden sprachliche Richtigkeit, Sprachstil, formale Textsortenkonventionen, Struktur und roter Faden, Inhalt und kommunikative Wirkung. Insbesondere in den Kategorien Inhalt, kommunikative Wirkung und Einhaltung von Textsortenkonventionen zeigten sich auch langfristig positive Effekte bei der Experimentalgruppe. Andere Merkmale wie Struktur und roter Faden, sprachliche Richtigkeit und Sprachstil konnten jedoch nicht verbessert werden. Ferner ergab die Untersuchung, dass Lernende des höheren Leistungsniveaus („Ausbildungsberufe mit höherem schulischen Anforderungsniveau“ (Hoefele & Konstantinidou 2016: 157–158)) bessere Texte schreiben als jene mit niedriger schulischer Vorbildung. Die Lernenden tieferer Leistungsniveaus haben sich jedoch über die Zeit stärker entwickelt als solche, die schon zu Beginn gute Leistungen zeigten. Zudem haben sich Lernende der Experimentalgruppe mit Deutsch als Muttersprache durch die Intervention stärker entwickelt als jene mit Deutsch als Zweitsprache.
Eine weitere Interventionsstudie der gleichen Forschungsgruppe (Konstantinidou et al. 2022), die einen etwas anders gelagerten Interventionsansatz – szenariobasierte Lese- und Schreibförderansätze – verfolgte, kam zu ähnlichen Resultaten. Die Studie wurde wiederum als Pretest-Postest-Control-Group-Design, jedoch ohne Follow-up-Messung, entworfen und hatte eine Stichprobengröße von N = 285 Berufslernenden aus fünf Schweizer Berufsfachschulen. In drei Szenarien wurden argumentative Schreibaufgaben eingebettet. Die Textqualität wurde anhand des Bewertungsrasters, das bereits in der vorangehenden Studie zur Anwendung kam, geratet. Es wurde ein kleiner experimenteller Interventionseffekt festgestellt, bei dem sich die Textqualität in der Experimentalgruppe signifikant besser entwickelte als in der Kontrollgruppe. Die Lernenden in Lehren mit tieferem Anspruchsniveau (zweijährige EBA-Lehren, d. h. Berufslehren mit eidgenössischem Berufsattest) profitierten stärker von der Intervention als jene in Berufslehren mit hohem Anspruchsniveau (drei- oder vierjährige EFZ-Lehren), wobei die Qualität der Texte der letztgenannten Gruppe zu beiden Messzeitpunkten deutlich höher war. Die Lernenden profitierten unabhängig von ihrem sprachlichen Hintergrund gleichermaßen von der Fördermaßnahme.
Zusammenfassung
Diese Übersicht über den noch immer eher begrenzten Forschungsstand zu Schreibleistungen von Berufslernenden zeichnet ein inkohärentes Gesamtbild mit divergierenden Ergebnissen. Trotzdem soll hier der Versuch einer Zusammenfassung zu textuellen Kriterien sowie zu Gruppenunterschieden unternommen werden.
Textuelle Kriterien:
Im Bereich der sprachlichen Korrektheit (Orthografie, Interpunktion, grammatikalische Richtigkeit) zeigt sich, dass sich Lernende zu Beginn der Ausbildung auf tiefem Niveau bewegen und gegen Ende leicht steigern. Im Vergleich zu Gymnasiastinnen und Gymnasiasten produzieren Berufslernende mehr Fehler beim Schreiben (Wyss Kolb 1995). Im Zuge der LAU/ULME-Studie (Lehmann, Hunger et al. 2004; Neumann 2006) schrieb rund ein Fünftel der getesteten Lernenden fehlerfrei. In der Untersuchung von Baumann (2014) schrieben Berufsschülerinnen und ‑schüler durchschnittlich jedes fünfte Wort falsch. Laut einer Studie zu basalen Schreib- und Lesekompetenzen (Sturm 2014) kann die Schreibflüssigkeit (verstanden als Flüssigkeit und Korrektheit) nicht bei allen Berufsschülerinnen und Berufsschülern in ausreichendem Masse vorausgesetzt werden.
Die Ergebnisse zur Textstruktur sind widersprüchlich. Während Wyss-Kolb (1995) kaum Textbaufehler konstatiert, wird die mangelhafte Textstruktur in der VOLI-Studie (Efing 2006; Efing 2008) als eines der Hauptprobleme markiert. Auch im PROSAB-Projekt zeigte sich, dass sich die Lernenden trotz intensiver Intervention im Strukturieren der Texte nicht verbessert haben (Konstantinidou, Hoefele & Kruse 2016).
Was die sprachlichen Mittel und die Formulierungen betrifft, sind die Ergebnisse ebenfalls disparat. Während Wyss Kolb (1995) den Einsatz der sprachlichen Mittel als angemessen bezeichnet, wird in der VOLI-Studie die Formulierungsfähigkeit der Lernenden bemängelt. Auch im Rahmen der Intervention in der PROSAB-Studie konnten sich die Lernenden im Bereich Sprachstil nicht verbessern.
Befunde zur funktionalen Angemessenheit und zur Einhaltung von Textnormen weisen die gleiche Heterogenität auf. Gemäß LAU-Studie verfassten zwei Drittel der Berufslernenden einen funktional ausgereiften Brief. Auch in der Untersuchung von Baumann (2014) waren rund 70% der Lernenden in der Lage, Textnormen adäquat oder weitgehend adäquat einzuhalten. In der VOLI-Studie hingegen wurden fehlende Textsorten- und Textmusterkenntnisse konstatiert.
Gruppenspezifische Unterschiede von Schreibleistungen:
Die oben referierten Studien weisen Schreibleistungen teilweise gruppenspezifisch aus. Von besonderem Interesse für dieses Vorhaben sind jene Gruppenvariablen, die in der Analyse verwendet werden. Der Forschungsstand stellt sich diesbezüglich folgendermaßen dar:
Vorbildung (Schulstufe, die vor Beginn der beruflichen Ausbildung besucht wurde)
Der Zusammenhang zwischen Vorbildung und Schreibleistungen scheint eindeutig zu sein: Je höher das Anspruchsniveau der zuletzt besuchten Schulstufe ist, desto besser sind die Texte der Lernenden. Dies zeigte sich in der VOLI-Studie und in der ULME-Untersuchung2.
Anspruchsniveau der beruflichen Ausbildung





























