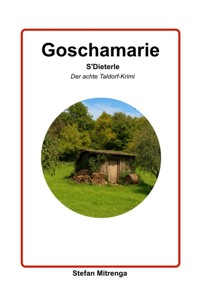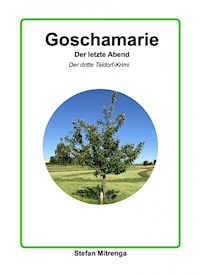Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach sexuellen Eskapaden muss der Kriminalpsychologe Beller aus Berlin verschwinden. Seine Chefin versetzt ihn ans andere Ende der Republik. In Friedrichshafen soll er die Sicherheitsplanungen zum Seehasenfest, einem beliebten Kinder- und Familienfest, unterstützen. Was wie ein Urlaub beginnt wird für Beller zur größten Herausforderung seiner Laufbahn: beim Einholen des Seehas auf dem Bodensee bringen Kriminille drei Schiffe der Weißen Flotte in ihre Gewalt und fordern für die Passagiere an Bord eine nie dagewesene Lösegeldsumme. Beller und seine Friedrichshafener Kollegen setzen alles daran, die Geiseln zu retten und die Täter zu fassen, doch die Geiselnehmer sind ihnen immer einen Schritt voraus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schwarzer Seehas
Thriller
Impressum
Texte: © Copyright by Stefan Mitrenga 2021Umschlaggestaltung: © Copyright by Kai Mitrenga 2021Korrektur: Claudia Kufeld, Kierspe
Verlag:Stefan MitrengaBodenseestraße 1488213 [email protected]: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Die nachfolgende Geschichte ist frei erfunden, auch die Personen und ihre Handlungen. Eventuelle Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig.
Prolog
22. März 1942
Ein eiskalter Windstoß ließ den Mann auf dem Landungssteg frösteln. Er schlug den Kragen seines Ledermantels hoch und zog den Hals ein. Er war allein in diesem Teil der Danziger Werft. Weiter vorne, wo rund um die Uhr an neuen Kriegsschiffen gearbeitet wurde, brannte Licht in den Hallen und das monotone Klopfen der Nietenhämmer hallte durch die Nacht. Der Mann zog den Ärmel hoch und warf einen Blick auf seine Kienzleuhr; ein Geschenk seines Vaters.„Verdammt“, fluchte er in seinen Kragen. Er hatte auf keinen Fall zu spät kommen wollen und war nun fast eine halbe Stunde zu früh. Kurz überlegte er sich bei den Hallen Schutz zu suchen, wählte aber stattdessen eine kahle Eiche, deren Stamm wenigstens einen schmalen Windschatten bot. So hatte er sich seinen großen Tag nicht vorgestellt.Seit er in seiner Kindheit Jules Vernes „20.000 Meilen unter dem Meer“ gelesen hatte, war er von U-Booten fasziniert gewesen. Diese majestätischen Stahlkolosse, die unbemerkt durch die Weltmeere ziehen konnten und von keiner irdischen Instanz kontrollierbar schienen. Die Ernüchterung kam, als er nach dem Weltkrieg die ersten Bücher über echte U-Boote las. Sie waren alles andere als elegante Meeresriesen. Im Grunde waren sie nur abgedichtete Boote, die bei Gefahr für kurze Zeit untertauchen konnten. Unter Wasser bewegten sie sich nur langsam, da ihr Antrieb für die Fahrt an der Oberfläche entwickelt worden war. Eine offene Kommandobrücke und teils Geschütze auf dem Vorderdeck sorgten für die schlechteste Stromlinienform, die denkbar war. U-Bootangriffe erfolgten immer im aufgetauchten Zustand und auf Sichtweite, so wollten es die völkerrechtlichen Doktrinen des Krieges, das Abtauchen diente lediglich der Flucht.Der Mann schüttelte den Kopf. „Was für ein Schwachsinn!“Warum verschwendete man so eine wunderbare Waffe? Es würde doch auch niemand einen Speer aus bestem Stahl schmieden, um dann die Spitze stumpfzuschleifen. Er hatte von Anfang an eine ganz andere Vision gehabt: seine U-Boote würden die meiste Zeit unter Wasser fahren, sie würden sich dem Feind völlig unbemerkt nähern und dann aus nächster Nähe, wie aus dem Nichts, zuschlagen. Und genauso unerkannt würden sie wieder entkommen.Als er die Volksschule verlassen hatte, ermöglichte ihm ein Onkel den Besuch des Gymnasiums und unterstützte ihn auch während des darauffolgenden Ingenieurstudiums mit dem nötigen Geld. Einen Studiengang für U-Boote gab es nicht und so spezialisierte er sich auf alles, was mit Druck zu tun hatte und Materialien, die unter Druck bestehen mussten. Doch auch während des Studiums wurde er enttäuscht. Die meisten seiner Dozenten waren uralt und in ihren Ansichten unglaublich konservativ. Sie hatten sich seit gefühlten fünfzig Jahren nicht mehr fortgebildet, dabei hatte es gerade beim Material erstaunliche Entwicklungen gegeben. Die Überalterung der Professoren war an allen Universitäten ein Problem; der Krieg hatte unter den jungen Männern viel zu viele Opfer gefordert. Also suchte er selbst nach interessanten neuen Materialien und stellte seine eigenen Berechnungen an. Sein mathematisches Talent half ihm dabei. Er löste Rechenprobleme in Minuten, für die andere mehrere Tage oder gar Wochen brauchten. Noch vor seinem Abschluss hatte er sich deutschlandweit einen Namen gemacht und häufig fragten ihn andere Ingenieure um Rat.Für seine Doktorarbeit kehrte er schließlich zu den Visionen seiner Jugend zurück und beschrieb eine neue Art von U-Boot, die alles übertraf, was je dagewesen war: unglaubliche Tauchzeiten und Geschwindigkeiten unter Wasser, in Einklang mit immensen Abmessungen und trotzdem niedrigem Materialbedarf. Alles war bis ins kleinste Detail berechnet und gezeichnet, es fehlte nur noch jemand, der diese U-Boote baute.Doch es kam niemand.Seine Doktorarbeit verstaubte in den unendlichen Reihen der Universitätsbibliothek zwischen tausenden anderer unbeachteter Werke.Dann kam der zweite Weltkrieg.Bereits als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler gewählt worden war, war er in die Partei eingetreten. Ein Muss in seiner Position. Er hatte nun selbst einen Lehrstuhl an einer angesehenen Universität und beriet neuerdings Rüstungsfirmen bei der Konstruktion ihrer Waffen und Maschinen. Die Rüstung war schon zu Zeiten der Weimarer Republik leise wieder angelaufen, vor allem nachdem die interalliierte Militärkommission 1927 ihre Kontrollen eingestellt hatte. Unter Hitler gab es dann kein Halten mehr und der Etat des Kriegsministeriums schoss in schwindelerregende Höhen. Panzer, Schiffe und Flugzeuge wurden gebaut - und endlich auch wieder U-Boote.Er erinnerte sich noch genau an den Morgen im Juli 1941, als er in seinem Büro unerwarteten Besuch erhielt.„Guten Morgen Dr. Liebrecht“, begrüßte ihn sein Gast und setzte sich unaufgefordert in den Sessel vor seinem Schreibtisch. Erst vermutete er in dem Mann einen Gesandten der Gestapo oder gar der SS, doch irgendwie passte er nicht in deren Bild.„Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe, aber ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen.“Dr. Liebrecht musterte den kleinen Mann von oben bis unten: sein Schädel war kahlrasiert, sogar die Augenbrauen fehlten, auf seiner Nase trug er eine Brille mit runden Gläsern. Sein Anzug war unauffällig, schien aber maßgeschneidert. Das Auffälligste an dem Mann aber waren seine stechend blauen Augen, die sein Gegenüber fest im Blick behielten.„Mein Name ist Ummenhofer, Georg Ummenhofer, und ich bin hier, um Ihnen ein einmaliges Angebot zu machen.“Wenigstens werde ich nicht verhaftet, dachte Dr. Liebrecht und entspannte sich etwas in seinem Stuhl.„Was kann ich für Sie tun?“Ummenhofer schüttelte den Kopf. „Aber nicht doch: ich kann etwas für Sie tun!“Dr. Liebrechts Alarmglocken läuteten. Echte Geschenke oder Gefallen gab es in dieser Zeit nicht. Stets kam ein „aber“, verbunden mit einer erwarteten Gegenleistung.„Ich möchte ihr U-Boot bauen“, sagte Ummenhofer beiläufig, gerade so, als ginge es darum ein Kaffeekränzchen zu veranstalten. Dr. Liebrecht blieb die Luft weg. Machte sich dieser Mann über ihn lustig?„Hören Sie – wenn das hier ein Spaß werden soll, ist unser Gespräch beendet.“Ummenhofer beugte sich über den Schreibtisch und sah Dr. Liebrecht starr in die Augen.„Wer mich kennt, der weiß, dass ich keinen Spaß mache.“Er ließ seine Worte einen Moment wirken. Liebrecht spürte die Gefahr, die sie ausstrahlten und wich instinktiv zurück.„Ich möchte ihr U-Boot bauen, besser gesagt der Führer persönlich hat Interesse daran.“Liebrecht dachte sich verhört zu haben. Hitler selbst sollte von seinen Plänen erfahren haben? Ein schier unmöglicher Zufall. Andererseits befand sich Deutschland im Krieg und suchte ständig nach neuen Ideen und Waffen, die kriegsentscheidend sein könnten. „Natürlich wären diese U-Boote den alten Modellen weit überlegen“, begann Liebrecht zögerlich. Im Folgenden erläuterte er die Vorzüge seiner Entwicklung. Die hohe Unterwassergeschwindigkeit, der quasi reinelektrische Antrieb, der eine annähernd lautlose Fahrt erlaubte, da die Schraube ohne anfällige Mechanik direkt auf die Welle des Elektromotors montiert wurde und natürlich die hohe Reichweite, die seiner Meinung nach durch neuentwickelte Akkumulatoren sogar noch größer war als in seinen ursprünglichen Berechnungen.All das hörte sich Ummenhofer lächelnd an. Als Liebknecht geendet hatte, zeigte er mit dem Finger auf ihn. „Und genau deshalb wollen wir ihr U-Boot bauen.“ Er neigte den Kopf und schürzte die Lippen. „Aber …“Liebrecht stöhnte innerlich auf: da war das „aber“ mit dem er gerechnet hatte.„Aber … ich brauche etwas, das ich dem Führer zeigen kann. Wissen Sie, Hitler ist ein ausgesprochenes Augentierchen!“Während Ummenhofer über seine Formulierung lachte, sah sich Liebrecht panisch im Zimmer um. Wie konnte dieser Mann den Führer als Augentierchen bezeichnen? Wenn das irgendwer gehört hatte und meldete, würden sie mit Sicherheit beide im Gefängnis landen.Ummenhofer sah seine Bestürzung und winkte ab.„Keine Panik, mein Lieber. Der Führer und ich, wir sind … na sagen wir einfach: er schätzt mich als Berater.“Liebrecht war immer noch unsicher und sprach unwillkürlich leiser.„Und was also brauchen Sie von mir?“„Ein funktionierendes Schiff. In sechs Monaten. Schaffen Sie das?“Liebrechts Mund stand offen, während er versuchte, die Information zu verarbeiten.„Sechs Monate?“, stammelte er. „Wie soll das gehen? Ich habe … ich kann nicht ... also ich müsste …“„Faseln Sie nicht“, unterbrach ihn Ummenhofer schroff. „Ich habe schon einiges vorbereitet. Sie müssen nach Danzig. Auf der dortigen Werft steht alles für Ihr Projekt bereit. Falls doch etwas fehlt, werde ich dafür sorgen, dass Sie es bekommen.“Liebrecht nickte apathisch.„Und noch eins: ich erwarte nicht, dass Sie in diesen sechs Monaten ein komplettes Boot fertigstellen – ich erwarte einen funktionsfähigen Prototyp. Höchstens zwanzig Meter lang?“Liebrecht verstand nicht. „Was wollen sie denn mit so einem Spielzeug?“„Ich weiß. Laut Ihren Plänen wäre das Boot sechsundsiebzig Meter lang. Ich bezweifle aber, dass Sie das in den sechs Monaten realisieren können. Außerdem denke ich an die Materialkosten … immerhin ist es nur ein Prototyp. Die Hauptsache ist, dass es funktioniert. Bekommen Sie das hin?“Liebrechts Gedanken rasten. Auch bei der geringeren Größe wäre es ein immenser Kraftakt. Wenn wirklich alles vorbereitet war, könnte er es schaffen, aber er müsste sofort aufbrechen. Hier hielt ihn nichts. Er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Er vögelte gelegentlich eine der Sekretärinnen, doch das war nichts Verbindliches.„Ich schaffe das“, sagte er nach kurzem Überlegen und spürte erst als er es aussprach, dass er einen Pakt geschlossen hatte.Das war vor mehr als sechs Monaten gewesen. Zwei Tage nach ihrem Gespräch hatte er sich auf den Weg nach Danzig gemacht. Ummenhofer hatte nicht übertrieben: in einer kleinen, etwas abseits gelegenen Halle, in der bis vor kurzem noch zivile Yachten gebaut worden waren, fand er alles, was er brauchte. Die Tage verbrachte er auf der Werft, die Nächte in einem hübschen Haus, das nur zehn Gehminuten entfernt lag. Es hatte sogar einen gepflegten Garten, aus dem er sich bedienen konnte. Manchmal fragte er sich, was aus den Bewohnern geworden war.Wie er es für die spätere Produktion vorgesehen hatte, wurde auch der Prototyp in Sektionen gebaut. Die Einzelteile, angefertigt nach seinen Plänen, kamen aus ganz Norddeutschland. Das hatte den Vorteil, dass die Ressourcen – Material und Fachkräfte – nicht an einem Ort gebündelt werden mussten. Sollte eine Produktionsstätte ausfallen, womit man im Krieg rechnen musste, konnte deren Arbeit an anderer Stelle fortgeführt werden, ohne dass das Gesamtprojekt gefährdet war. Wenn die Produktion anlief, konnten die Einzelsektionen in der Werft wie am Fließband zusammengesetzt werden.Probleme gab es nur mit den Elektromotoren. Die ersten, die geliefert wurden, waren nicht genau austariert und verursachten Vibrationen, die unter Wasser zu Geräuschen geführt und langfristig Schäden an den Verankerungen bewirkt hätten. Erst beim dritten Versuch war die Spulenwicklung des Motors so exakt, dass sich alle Werte innerhalb der Toleranz befanden.Liebrecht sah erneut auf die Uhr. Noch fünf Minuten. Von den Werfthallen her näherte sich langsam ein Fahrzeug mit abgedunkelten Scheinwerfern und parkte einige Meter vor dem Landungssteg. Kurze Zeit tat sich gar nichts, dann wurden die hinteren Türen des Maybach geöffnet. Zwei Männer stiegen aus und kamen auf ihn zu.„Schön zu sehen, dass Sie pünktlich sind“, begrüßte ihn Ummenhofer und gab ihm die Hand. Der andere Mann hielt sich im Hintergrund. So wie Ummenhofer trug auch er einen schweren Ledermantel, seinen breitkrempigen Hut hatte er zum Schutz vor dem Wetter tief ins Gesicht gezogen. Als er endlich vortrat, gefror Liebrecht das Blut in den Adern. Er kannte das Gesicht nur zu gut, war es doch in den letzten Wochen ständig auf den Titelseiten der Zeitungen gewesen. Vor ihm stand der erst vor kurzem ernannte Reichskriegsminister. Albert Speer. Ein panischer Reflex wollte seinen Arm nach oben reißen und das „Heil Hitler“ lag ihm schon auf der Zunge, doch Speer ging dazwischen.„Wagen Sie es ja nicht, mich zu grüßen“, zischte er bedrohlich. „Es muss ja nicht jeder mitbekommen, wer ich bin.“Speers Angst war berechtigt. Die Feinde des Reiches hatten dazugelernt und erst kürzlich zwei hochrangige Offiziere ermordet. Dabei hatten die Heckenschützen auf die Person geschossen, die ihrem Stand gemäß gegrüßt wurde. Seitdem verzichtete man gerne mal auf den Hitlergruß.„Wie lange noch?“, fragte Ummenhofer und schaute aufs Meer. Liebrecht schob den Ärmel hoch und sah auf seine Uhr. „Wenn alles glatt läuft noch fünf Minuten.“Für diese Demonstration hatte Ummenhofer sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: das U-Boot war vor knapp zehn Stunden in Kolberg gestartet und sollte nun, nach fast zweihundertfünfzig Kilometern Tauchfahrt, vor ihnen auftauchen.„Ich habe es übrigens noch etwas spannender gemacht“, sagte Ummenhofer und lächelte schief.Liebrecht schreckte auf.„Sie haben doch versprochen, dass Ihr Boot so leise ist, dass es nicht geortet werden kann …“Liebrecht nickte.„… deshalb habe ich zwei unserer besten U-Bootjäger auf seinem Kurs positioniert. Sie hatten die Anweisung das Gebiet feinmaschig nach Unterwasseraktivitäten abzusuchen. Wir werden sehen, ob sie erfolgreich waren.“Liebrecht lief trotz der Kälte Schweiß über den Rücken. Dieser Wahnsinnige hatte tatsächlich noch eins draufgesetzt. Und wofür? Nur um vor Speer glänzen zu können? Er schüttelte unmerklich den Kopf. Oder war er nur darauf aus, seine Unfähigkeit zu beweisen? In dem Fall würde er den Tag vermutlich nicht überleben. Er sah erneut auf seine Kienzleuhr. Seine Hand zitterte. Verdammt, das Boot müsste jetzt da sein.Auch Speer sah auf seine Uhr. Seine Hand zitterte kein bisschen. Er bedachte Liebrecht mit einem skeptischen Blick von der Seite.„Die fünf Minuten sind um“, stellte er fest und wandte seinen Blick hinaus aufs Meer.Komm schon, komm schon, komm schon, bettelte Liebrecht in Gedanken und suchte die Wasseroberfläche ab. Er erschrak, als sich ein Schwarm Möwen kreischend in die Luft erhob und davonflatterte. Dort, wo die Vögel eben noch mit den Wellen auf und ab geschaukelt waren, erhob sich ein massiver Schatten aus dem Wasser. Ohne jegliches Geräusch hielt er auf den Landungssteg zu.„Endlich“, entfuhr es Liebrecht.„Sie haben daran gezweifelt?“, grinste Ummenhofer. „Sie sollten mehr Vertrauen in ihr Boot haben.“Das habe ich, du arroganter Sack, ärgerte sich Liebrecht, aber die zusätzlichen U-Bootjäger waren nie Teil des Plans gewesen.Das U-Boot war nun noch zwanzig Meter entfernt und tauchte weiter auf. Über seine gesamte Länge ragte es rund einen halben Meter aus dem Wasser. Ein metallisches Schaben war das erste Geräusch, das die Männer am Steg von dem Boot hörten. Kurz darauf flammte ein schwaches Licht auf und eine Person reckte den Kopf aus dem Turm. Mit leisen Worten gab er Anweisungen nach unten und manövrierte das Schiff behutsam an den Landungssteg.Speer schritt das Boot in seiner gesamten Länge ab. Natürlich hatte er die Pläne studiert, doch es war etwas anderes, das fertige Objekt zu sehen. Es wirkte riesig und er schauderte bei der Vorstellung, dass dies nur der Prototyp war mit gerade mal einem Viertel der Originalgröße. Ganz anders als die alten U-Boote, bemerkte Speer staunend. Eleganter. In seiner Form erinnerte es ihn an einen großen Fisch. Außer dem Turm ragte nichts aus dem Bootskörper. Er wusste, dass für das Boot keine Bordgeschütze vorgesehen waren. Seine einzige Bewaffnung bestand aus fast fünfzig Torpedos der neuesten Bauart, was vollkommen ausreichend war. In Führungskreisen befürchtete man eine Invasion alliierter Truppen, die mit Schiffen das Festland erreichen könnten. Flugzeuge waren geeignet für Bombenangriffe, doch um eine große Zahl Soldaten zu befördern zu unsicher, weshalb der Seeweg die einzige Lösung war. Und nun hatten sie eine Waffe, die ungesehen und ungehört bis auf kurze Entfernung an die Kreuzer und Transportschiffe herankommen konnte, um ihre todbringenden Torpedos abzufeuern. Speer lächelte, als er sich die entsetzten Gesichter der feindlichen Kapitäne vorstellte, die mitansehen mussten, wie ein Schiff nach dem anderen um sie herum versenkt wurde und schließlich auch ihr eigenes.„Sie haben dem Reich eine mächtige Waffe geschenkt“, sagte Speer und legte Liebrecht die Hand auf die Schulter. „Wir werden ihr Boot bauen. So schnell wie möglich.“ Er sah zum Bug des U-Bootes und entdeckte den ordentlichen Schriftzug: „Nautilus“„Etwas kindisch, finden Sie nicht?“Liebrecht zuckte zusammen. Er wusste, dass Jules Verne von einigen in der Partei als nicht konform angesehen wurde.„Es ist … es ist nur ein Arbeitsname …“, stammelte er, doch zu seiner Überraschung lächelte Speer.„Ich finde ihn mehr als passend, aber für die Serienproduktion bleiben wir dann doch bei der alten Nomenklatur. Halten Sie sich bereit. Ich denke, wir beginnen in Kürze. Ich werde das noch mit dem Führer besprechen, aber ich bin mir sicher, dass er begeistert sein wird.“Speer wandte sich um und ging zurück zum Wagen.„Auch ein Augentierchen“, flüsterte Ummenhofer grinsend. „Hab ich Ihnen doch gesagt. Glückwunsch: jetzt haben Sie Ihre U-Bootproduktion. Und wer weiß: vielleicht werden Ihre Schiffe den Krieg entscheiden.“Auch Ummenhofer wandte sich um, doch Liebrecht hielt ihn zurück. „Was passiert denn jetzt mit der Nautilus? Immerhin ist sie voll funktionsfähig.“„Machen Sie sich keine Sorgen: wir haben bereits eine Verwendung gefunden. Eine sehr wichtige sogar.“Liebrecht war enttäuscht. Er hing an diesem Prototyp und hätte an ihm gerne noch einige Dinge ausprobiert. „Wo kommt sie hin?“Ummenhofer verzog die Lippen zu einem Schmollmund. „Jetzt seien Sie doch nicht so sentimental. Es wird ihrem Schiff gutgehen. Glauben Sie mir. Aber leider werden Sie es nie wiedersehen. Bauen Sie Ihre U-Bootflotte, das war es doch was Sie immer wollten.“
Luftlinie rund fünfhundertsiebzig Kilometer entfernt stand Judith Cwiertnia am nächsten Tag an ihrer Werkbank und zog die letzten Schrauben an. Die Nazis hatten sie und ihre Familie in Polen verhaftet und auf verschiedene Lager verteilt. Vielen Juden erging es ähnlich. Doch ihre Ausbildung als Uhrmacherin bewahrte sie vor dem Konzentrationslager, stattdessen wurde sie zur Zwangsarbeit in der Torpedoversuchsanstalt Eckernförde eingeteilt. Sie bemühte sich, ihre Arbeit gut zu machen, in der Hoffnung, dass auch ihre Familie davon profitierte.Vor ihr lag ein Torpedo aus einer kleinen Sonderserie. Die normalen Torpedos waren rund sechs Meter lang, dieser hier war mit zweieinhalb Metern vergleichsweise winzig. Sie setzte die Verschlusskappe auf und drehte die fünf Muttern mit der Hand auf die Gewindestangen. Wichtig war, sie danach mit exakt einhundertfünf Newtonmetern anzuziehen. So lautete die Vorgabe. Sie sah sich nach ihrem Drehmomentschlüssel um, der auf der anderen Seite der Werkbank lag. Sie war am Ende ihrer Schicht und müde und hatte keine Lust durch den ganzen Raum zu laufen. Außerdem konnte sie sich auf ihr Feingefühl verlassen. Sie nahm die normale Ratsche und zog die Schrauben an. Immer über Kreuz, damit die empfindliche Blattdichtung nicht beschädigt wurde. Bei vier der Schrauben lag sie verblüffend dicht an den einhundertfünf Newtonmetern, doch bei der letzten unterschätzte sie ihre Kraft und erreichte einhundertfünfzehn Newtonmeter. Die Dichtung wurde gequetscht und ein feiner Riss entstand, so fein, dass er für das menschliche Auge nicht sichtbar war. Judith begutachtete zufrieden ihre Arbeit und wischte mit einem Lumpen über den Torpedo, bis er im Licht der Neonröhren glänzte und befestigte eine grüne Plakette an der Spitze. Das war’s für heute, freute sie sich und rief nach dem Aufseher, der sie zurück in ihren Block bringen würde.
15. September 1944Ummenhofer schwitzte in seinem schweren Mantel. Am Morgen war es kühl gewesen, doch nun bereute er die Wahl seiner Kleidung. Schal und Handschuhe hatte er bereits im LKW abgelegt. Er hasste es zu warten, doch im Krieg gingen die Uhren anders. Der Transport war für zehn Uhr angekündigt. Nun war es kurz vor elf. Er hatte Lust jemanden anzuschnauzen, doch niemand wagte es, sich ihm zu nähern. Im Lager kannte man ihn, wenngleich niemand wusste, welche Funktion er innehatte. Er trug keine Uniform und auch sonst keine Kennzeichen. Tatsächlich war er nicht einmal in der Partei. Der Führer hatte ihn schon mehrmals darauf angesprochen, aber er hatte sich immer herausreden können. Ummenhofer war schon immer klar gewesen, dass es im Krieg Gewinner und Verlierer gab. Wer sich mit Haut und Haaren der Partei verschrieb, würde im Fall einer Niederlage zu den Verlierern gehören, darum war er nicht Mitglied und stand auf keiner der endlos geführten Listen. Trotzdem hatte er durch seine Freundschaft mit Hitler, der sehr viel Wert auf seinen Rat legte, enormen Einfluss. Er liebte es in der zweiten Reihe zu stehen – die in der ersten Reihe wurden auch als erste erschossen. Sollte Hitler am Ende den Krieg verlieren, würde sein Name nirgends auftauchen, noch nicht mal beim Einwohnermeldeamt. Aber natürlich hoffte er auf den Sieg und tat alles, was er konnte, um den Führer zu unterstützen. Seine besondere Gabe war es, Talente zu entdecken. Ein echter Coup war ihm mit Wernher von Braun gelungen, den er 1932 direkt von der Universität zum neuen Raketenprogramm geholt hatte. Seitdem hatte der Mann unglaubliches geleistet. Kurz darauf wurde Hitler Reichskanzler und wurde auf Ummenhofers Begabung aufmerksam. In den nächsten Jahren war er für einige Neubestzungen innerhalb der Partei verantwortlich. Auch in Liebrecht hatte er sich nicht getäuscht. Seine neuen U-Boote galten mittlerweile als die Waffe, die den Krieg entscheidend beeinflussen könnte. Ummenhofer gönnte es dem jungen Ingenieur, den er seit dem Abend in der Danziger Werft nicht mehr gesehen hatte. Er hätte ihm zugetraut in den sechs Monaten, die er an dem Prototyp gearbeitet hatte, auch ein Boot in Originalgröße zu bauen, doch er hatte bereits einen anderen Plan im Hinterkopf gehabt und dafür brauchte er den sehr viel kleineren Prototyp.Seine aktuelle Aufgabe unterschied sich sehr von seinen bisherigen. Vor ein paar Jahren hatte Hitler ihn in einem Gespräch unter vier Augen gebeten, einen Plan zu erarbeiten, um große Geldbeträge sicher außer Landes zu schaffen. Ummenhofer hatte nicht gefragt, wofür das Geld bestimmt war – ob für das Reich, für die Partei oder Hitler selbst, es war ihm egal. Schnell war klar gewesen, dass nur die Schweiz als sicherer Ort in Frage kam, doch mit dem Fortschreiten des Krieges war an einen normalen Grenzverkehr nicht mehr zu denken. Er hatte vorsichtig Kontakt mit mehreren Schweizer Banken aufgenommen, ohne zu verraten, wer der neue Kunde war. Wieder half es, dass er offiziell nichts mit Hitler und der Partei zu tun hatte. Er entschied sich für eine der kleineren familiengeführten Banken, die zu ganz besonderen Zugeständnissen bereit war. Die Gier überflügelte die Skrupel des Bankdirektors, denn auch wenn Ummenhofer als Geschäftsmann aus Deutschland auftrat, war klar, dass er in diesen Zeiten nur ein Freund des Reiches sein konnte. Dass es eine jüdische Familie war, die die Bank führte, entlockte Ummenhofer immer wieder ein Lächeln.Der Schlüssel war Liebrechts U-Boot-Prototyp gewesen – die Nautilus. Er hatte das zwanzig Meter lange Schiff auf einem Eisenbahnwagen, der extra angefertigt worden war, durch ganz Deutschland transportiert. Eine Ummantelung aus Brettern hatte verhindert, dass jemand Wind davon bekam. Derartig maskierte Transporte waren zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich und erregten nur wenig Aufsehen. In Friedrichshafen fand die Nautilus dann ihr erstes Zuhause. In einer Werfthalle, in der vormals Fähren gebaut worden waren, blieb sie unter Verschluss. Wenn sie nachts zu ihren Fahrten aufbrach, wurde streng darauf geachtet, dass keine Schaulustigen in der Nähe waren. Auf Schweizer Seite hatte er über die Bank einen alten Fischereibetrieb aufgekauft und über dem Bootsanleger eine kleine Halle errichtet, so dass sie auch hier unbeobachtet blieben.Doch dann rückten die Luftangriffe der Alliierten immer weiter ins Landesinnere vor, bis sie schließlich auch Friedrichshafen erreichten. Zahlreiche Rüstungsbetriebe hatten ihren Sitz am Ufer des Bodensees: Zeppelin, Maybach, Dornier und die Zahnradfabrik. Hektisch wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Produktionsstätten zu verlagern und so stieß man auf die Molassefelsen bei Überlingen, die direkt an der Bahnlinie lagen. Das weiche Gestein ließ sich leicht aushöhlen, die Arbeitskräfte dafür kamen überwiegend aus dem Konzentrationslager in Dachau. In rund hundert Tagen sollte in den geschaffenen Höhlen die Produktion von Rüstungsgütern wieder anlaufen. Doch auch Ummenhofer brauchte einen neuen Platz für die Nautilus. Durch Zufall stieß er auf die pompöse Villa im Stil der Zwanzigerjahre, die einem reichen Optiker gehörte. Der Mann fiel seit Jahren durch seine ablehnende Haltung gegenüber der Partei auf – ein Wunder, dass er noch nicht eingesperrt worden war. Ummenhofer änderte das mit einem einzigen Anruf und machte sich sofort daran, über der kleinen Anlegestelle eine Halle zu bauen. Mit über dreißig Metern war sie lang genug für die Nautilus. Der Optiker hatte den Privathafen für seine private Yacht bauen lassen. Dekadent.Ummenhofer wohnte auch in der Villa. Der Kapitän der Nautilus war zum Schein als Diener und Gärtner eingestellt worden, der Maschinist des U-Boots offiziell als Verwalter. Es hatte sich herausgestellt, dass zwei Mann ausreichten, um das kleine U-Boot sicher zu bedienen. Und so gingen die Lieferungen in die Schweiz weiter.Heute sollte eine neue Ladung eintreffen. Endlich entdeckte Ummenhofer am Horizont die Rußwolke der Lok. Anderthalb Stunden Verspätung. Eine Schande. Als der Zug einfuhr, standen die Soldaten schon zum Entladen bereit. Gut zwanzig neue Arbeiter wurden auf dem wartenden LKW zusammengepfercht. Ausgemergelte Kreaturen, von denen manche schon auf dem Weg zum Fahrzeug zusammenbrachen. Zwei weitere Soldaten kümmerten sich um Ummenhofers Lieferung. Die Holzkisten ähnelten in ihrer Form gewöhnlichen Munitionskisten, waren aber um ein Vielfaches schwerer. Nur Ummenhofer wusste, dass jede Kiste exakt zwanzig Kilo Gold enthielt. Diesmal waren es sechs Stück. Die kleinen Barren im Inneren waren frisch gegossen und neutral gestempelt – also ohne Hakenkreuz oder andere Kennzeichnungen. Die Herkunft des Goldes interessierte Ummenhofer nicht, doch er ahnte, dass darin eine Menge Zahngold und geschmolzene Schmuckstücke verarbeitet waren.Gerade als sein Fahrer den LKW zum Tor lenkte, gab es bei einer der Baracken einen kleinen Tumult. Er sah hinüber und beobachtete, wie Soldaten eine Gruppe Häftlinge auseinander trieb. Ein Schuss fiel. Einer der Gefangenen blieb reglos liegen. Ummenhofer sah wieder nach vorn. Er musste an andere Dinge denken. Heute Nacht würde die Nautilus wieder in See stechen.
08. August 1998
„Hier sind deine Sachen“, sagte der Wärter unfreundlich und warf Barnsteiner eine Tüte zu. Der kontrollierte den Inhalt und sah den Uniformierten herausfordernd an.„Da fehlen zweitausend Mark in meinem Geldbeutel!“„Als ob du jemals so viel Kohle besessen hättest.“Der Wärter unterschrieb auf einem Formular und bedeutete Barnsteiner das Gleiche zu tun. Knurrend setzte er seine Unterschrift auf das Papier und ließ sich von einem anderen Wärter zum Ausgang bringen. Es war ein seltsames Gefühl nach vier Jahren einfach so durch die Tür zu gehen. Nach draußen. In die Freiheit.Bernd Barnsteiner war ein gewöhnlicher Kleinkrimineller gewesen und hatte sich mehrmals bei Einbrüchen erwischen lassen und so war es irgendwann mit den Bewährungsstrafen vorbei gewesen. Zu fünfeinhalb Jahren hatte ihn der Richter verurteilt, wegen guter Führung durfte er nach vier Jahren und zwei Monaten gehen. Heute. Seine „gute Führung“ bestand vor allem darin, während seiner Haft den Realschulabschluss nachzuholen und eine Lehre zum Kfz-Mechaniker zu beginnen. Die Beschäftigung war ihm nur recht gewesen. Wer sich das Gefängnis wie eine Ein-Sterne-Urlaubspension vorstellte, hatte keine Ahnung von der Realität. Schon nach der ersten Woche in der Zelle hatte ihn die Langeweile fast verrückt gemacht. Hinzu kam der Verlust jeglicher Privatsphäre. Die Zellen wurden regelmäßig durchsucht und außer zum Sport und zum Hofgang war er mit seinem Zellengenossen auf sechs Quadratmetern eingeschlossen. Er hätte es schlimmer erwischen können als mit Juri. Der gebürtige Russe war eine echte Fachkraft auf dem Gebiet des Autodiebstahls, glänzte aber nicht durch übermäßige Intelligenz. Dafür war er skrupellos. Als Bernd einmal Ärger mit einem anderen Häftling hatte, regelte Juri die Streiterei durch ein körperbetontes Gespräch unter der Dusche. Nach seinem zweiwöchigen Aufenthalt auf der Krankenstation war der andere überaus freundlich gewesen.Nun war er also draußen. Die restliche Strafe war zur Bewährung ausgesetzt und an Bedingungen geknüpft: er musste sich einmal die Woche bei seinem Bewährungshelfer melden, hatte einmal im Monat eine Sitzung beim Psychologen und musste seine Lehre fortsetzen. Die Sozialarbeiterin des Gefängnisses hatte ihm eine entsprechende Stelle besorgt. Mit ihr hatte er sich gut verstanden. Sie war hübsch genug gewesen, um ihn gelegentlich in seinen feuchten Träumen zu besuchen. Vielleicht sollte er sie mal anrufen? Jetzt, wo er frei war. Die vier Jahre im Knast waren auch vier Jahre ohne Sex gewesen. Manche Häftlinge arrangierten sich mit der Situation und halfen sich gegenseitig, doch das war für ihn nie in Frage gekommen. Er freute sich auf seinen ersten Abend in Freiheit, den er schon seit Wochen geplant hatte: er würde schön essen gehen – nichts Ausgefallenes – aber in ein Restaurant, in dem der Koch mit Gewürzen umgehen konnte. Der Gefängnisfraß hatte sich nur in den Farbnuancen von Grau unterschieden, geschmeckt hatte er immer gleich fad. Mit vollem Bauch und nach dem ein oder anderen Bier würde er sich einen Besuch im Bordell gönnen. Das Mädchen tat ihm jetzt schon leid: alles, was sich in vier Jahren angestaut hatte, würde sich in ihr entladen. Die Vorfreude ließ ihn lächeln.
Er erwachte am nächsten Morgen mit einem ordentlichen Kater. Es waren nur fünf Bier gewesen, doch auch an den Alkohol war er nicht mehr gewöhnt. Das Fest im Bordell war wesentlich kürzer verlaufen, als er es sich vorgestellt hatte. Das blonde Mädchen mit den riesigen Brüsten hatte sich sehr geschickt angestellt, so dass er nach heftigen zehn Minuten zu einem lautstarken Ende gekommen war. Und dafür hundertfünfzig Mark? Nun ja – gute Fachkräfte waren eben teuer.Er mochte die neue Wohnung, die ihm ebenfalls die Sozialarbeiterin vermittelt hatte. Zwar nur ein Zimmer, dafür aber mit einer hübschen Küchenzeile und einem kleinen Balkon. Und günstig war sie obendrein. Große Sprünge konnte er mit seinem Lehrlingsgehalt nicht machen, doch der Staat bezahlte einen Wohnungszuschuss. Für die Arbeit in der Gefängniswerkstatt hatte er einen beschämenden Stundenlohn erhalten, der auf sein Konto eingezahlt worden war. Doch wie bei einer Geldanlage wirkte die Zeit Wunder und es befanden sich bei seiner Entlassung über zehntausend Mark auf dem Sparbuch. Ein Fernseher. Er brauchte unbedingt einen Fernseher. Einen von diesen neuen flachen Bildschirmen. Dafür würde das Geld bestimmt reichen.Sogar die Post wusste schon von seinem neuen Wohnort. Er legte zwei Briefe beiseite und studierte das Prospekt eines Elektronikmarktes. Tatsächlich fand er einen Fernseher, der ihm gefiel und im Angebot war. Siebenhundertneunundneunzig Mark. Akzeptabel. Der Markt hatte an diesem Samstag bis zwanzig Uhr geöffnet und er plante seine Shoppingtour für den späten Nachmittag. Mit einem Seufzer öffnete er einen der beiden Briefe. Eine Bank bot ihm eine Kreditkarte zu „sensationellen“ Konditionen an. Aha. Wussten die nicht, dass er gerade aus dem Knast kam? Er zerknüllte den Brief mitsamt dem Umschlag und warf ihn in den Papierkorb. Der zweite Brief sah nicht nach Werbung aus. Er war schwerer und das Papier wertiger. Der Absender war ein Notar Kuschel in Ravensburg. Er erinnerte sich, dass er seinem ehemaligen Vermieter noch sechs Monatsmieten schuldig war. Wenn der diese nun einforderte, war es mit dem neuen Fernseher vorbei. Missmutig überflog er das Schreiben, stutzte und setzte nochmal neu an. Es ging um eine „Erbsache“. Er runzelte die Stirn und suchte nach einem Namen. Wer ihm etwas hinterlassen hatte, stand nirgends, aber er war in dem Schreiben als „Begünstigter“ benannt. Das war doch gut, oder? Er legte den Kopf in den Nacken und überlegte angestrengt, wer ihm etwas vererben würde. Zu seinen Eltern hatte er schon seit Jahren kaum mehr Kontakt. Sie waren nicht zu seiner Verhandlung erschienen und hatten ihn auch nicht im Gefängnis besucht, aber er hätte es mitbekommen, wenn ihnen etwas zugestoßen wäre. Außer ihnen hatte er keine Familie. Er las weiter: Der Notar bat ihn zu einem persönlichen Gespräch in seiner Kanzlei am kommenden Dienstag. Na prima. Ab Montag war er in seinem neuen Ausbildungsbetrieb, da kam es sicher gut gleich am zweiten Tag frei zu nehmen. Er warf den Brief mit etwas zu viel Schwung auf den Tisch, so dass er auf der gegenüberliegenden Seite hinunterfiel. Die Sache hatte doch bestimmt einen Haken. Es wäre das erste Mal, dass er etwas geschenkt bekäme. Er beschloss, später darüber nachzudenken und machte sich auf den Weg zum Elektronikmarkt. Der neue Fernseher war eindeutig wichtiger.
Barnsteiner hatte ein faules Wochenende hinter sich. Die meiste Zeit hatte er auf der Couch verbracht und dämliche amerikanische Serien angeschaut, die zu jeder Tages- und Nachtzeit liefen. Nur zweimal war er aus dem Haus gegangen, um an der Tankstelle Bier zu holen. Allmählich vertrug er den Alkohol wieder. Obwohl seine Wohnung nur wenig größer war als die Zelle, die in den letzten Jahren sein zu Hause gewesen war, fühlte er sich wohl. Eine Tür, die man selber auf und zu machen konnte, war echter Luxus.Am Montag erschien er verkatert an seinem neuen Arbeitsplatz, aber wenigstens war er pünktlich. Es gefiel ihm dort ganz gut: der Chef machte einen strengen, aber freundlichen Eindruck und auch die Kollegen waren nett. Dass er der einzige deutsche Lehrling war, machte ihm nichts aus. Nach Feierabend ging er mit den anderen noch ein Bier trinken und erfuhr, dass jeder von ihnen schon mal im Knast war. Er glaubte nicht, dass sein Chef eine übertrieben soziale Ader hatte, sondern einfach nur gern die staatlichen Zuschüsse für seine kriminelle Belegschaft einsackte, doch das störte Barnsteiner nicht.„Ich brauche morgen Vormittag frei“, hatte er seinem Chef gesagt, der gerade im Büro Rechnungen sortiert hatte. „Und ich brauche eine neue Frau“, hatte sein Chef ihn angeknurrt. „Im Ernst? An deinem zweiten Tag?“„Ist `ne Erbsache“, hatte Barnsteiner gleichgültig geantwortet und seinem Chef den Brief gezeigt, der ihn flüchtig überflog.„Kaum raus aus dem Knast und schon ein dickes Erbe. Weißt du um wieviel es geht?“Barnsteiner hatte mit den Schultern gezuckte. „Ich weiß noch nicht mal, wer mir was vererbt hat. Deshalb will ich ja auch hin.“Sein Chef hatte ihn daraufhin misstrauisch angesehen. „Ist ok. Aber nur der Vormittag. Pünktlich nach der Mittagspause bist du wieder da, sonst reiße ich dir den Arsch auf.“„Damit kann ich leben“, hatte Barnsteiner erwidert und das Büro verlassen.
Um acht Uhr morgens klopfte er an die Tür der Kanzlei. Als sich nichts tat, klopfte er erneut. Eine Klingel gab es nicht. Endlich Geräusche. Sicherungsketten wurden zurückgeschoben und ein Schlüssel kratzte im Schloss.Ein faltiges Gesicht spähte durch den schmalen Spalt und musterte seinen Besucher.„Barnsteiner?“Barnsteiner nickte und der Notar öffnete die Tür. Der Mann schien unendlich alt zu sein. Sein kahler Schädel saß auf einem viel zu dünnen Hals, der beim Gehen leicht nach vorne wippte. Er mochte einmal eine imposante Erscheinung gewesen sein, doch die Jahre hatten ihn gebeugt und er benutzte bei jedem seiner Tippelschritte einen Gehstock. Barnsteiner folgte ihm durch den Flur in ein muffiges Büro. Die Vorhänge waren zugezogen und es roch nach altem Staub und Mottenkugeln. Die Einrichtung war unglaublich altmodisch: dunkle Eichenmöbel, schwere Teppiche, wulstig gepolsterte Ledersessel.„Schön, dass Sie kommen konnten“, sagte der Notar und ließ sich hinter seinem Schreibtisch nieder. Den Stock legte er auf die Arbeitsplatte. „Sie fragen sich bestimmt, wer Ihnen etwas vererbt haben könnte.“ Er kicherte vergnügt, wobei sein ganzer Körper wackelte.„Deshalb bin ich hier“, antwortete Barnsteiner unsicher. „Um wen geht es und um was geht es?“Notar Kuschel hob mahnend die Hand. „Nicht so schnell, nicht so schnell. Es ist in diesem Fall nicht so einfach … oder eigentlich doch ganz einfach.“Barnsteiner zog die Stirn kraus. Wollte der Gnom ihn verarschen? Er spürte wie Wut in ihm Aufstieg.„Es geht um einen Onkel Ihrer Mutter“, begann der Notar zu erklären. „Er verstarb bereits vor zwei Jahren, doch er gab Anweisungen, Sie erst nach Ihrer Entlassung aus der Haft zu informieren.“Prima, dachte Barnsteiner: dass ich im Knast war, weiß wohl jeder.„Und nun kommen wir schon zu der ersten Entscheidung, die Sie treffen müssen: wollen Sie das Erbe annehmen?“„Was?“, platzte Barnsteiner heraus. „Ich habe doch keine Ahnung, was mich erwartet. Und wenn ich ehrlich bin: an einen Onkel meiner Mutter kann ich mich noch nicht einmal erinnern.“„Ja, ja, ja“, sinnierte Notar Kuschel, „er lebte sehr zurückgezogen. Und ich verstehe Ihre Bedenken, aber ich kann Ihnen versichern, dass es sich für Sie lohnen wird.“„Geht es etwas konkreter?“„Hmmm …“, der Notar legte den Kopf in den Nacken als müsste er erst darüber nachdenken. „Im Wesentlichen geht es um ein Häuschen am See, ein paar Quadratmeter Grund drumherum und noch ein paar Kleinigkeiten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Alles ohne Schulden, Kredite oder andere Verpflichtungen. Nichts, was Ihnen Probleme bereiten könnte.“Barnsteiner war sprachlos. Ein Häuschen am See? Noch ein bisschen Land? Alles ohne Belastungen? Zu gut um wahr zu sein.„Was muss ich tun?“, fragte er skeptisch und der Notar schob ihm einige Papiere über den Tisch.„Unterschreiben Sie!“Barnsteiner hatte keine Lust die Dokumente durchzulesen und blickte sie widerwillig an. „Was ist das?“„Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie das Erbe an. Darüber hinaus verpflichten Sie sich, Stillschweigen über den genauen Umfang des Erbes zu bewahren. Worum es genau geht, sehen Sie später.“„Später?“Der Notar nickte. „Sobald Sie unterschrieben haben, zeige ich Ihnen, was Ihnen der Onkel Ihrer Mutter hinterlassen hat. Ich versichere Ihnen: Sie werden es nicht bereuen.“Wieder kicherte der Notar und Barnsteiner hatte das komische Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Trotzdem griff er zum Kugelschreiber und setzte seine Unterschrift auf das letzte Blatt. Was sollte schon passieren? Im Moment besaß er nichts und alles, was hinzukam, war gut. Ein Haus? Toll! Sogar am See.Notar Kuschel kontrollierte die Dokumente und legte sie in eine Schublade.„Dann los. Schauen wir es uns an.“„Moment“, unterbrach Barnsteiner, „ich muss nach der Mittagspause wieder bei der Arbeit sein, sonst bekomme ich Ärger.“Der Notar war schon an der Tür und wandte sich um. „Das schaffen wir locker. Vertrauen Sie mir!“
Barnsteiner war erleichtert, als kurz darauf ein schwarzer Bentley vorfuhr und sie im Fond des Wagens Platz nahmen. Er wäre nur ungern in einen Wagen gestiegen, bei dem der alte Notar am Steuer saß.Sie verließen Ravensburg und fuhren westwärts Richtung Meersburg, blieben aber auf der Bundesstraße bis zur Abfahrt Überlingen. Der Fahrer setzte zielsicher den Blinker und hielt auf die Altstadt zu, doch kurz bevor sie den Hafen erreichten – Barnsteiner konnte das Blau des Bodensees schon leuchten sehen – bog er scharf links in einen schmalen Privatweg. Die Straße führte durch einen Wald, dessen Blätterdach so dicht war, dass der Fahrer das Licht einschaltete. An einem schmiedeeisernen Tor stoppte der Bentley.„Das muss ich persönlich machen“, seufzte der Notar und quälte sich aus dem Auto. Barnsteiner beobachtete, wie er am rechten Torpfosten hantierte und die beiden Torflügel kurz darauf geräuschlos zur Seite schwangen. Der Wald wurde nun lichter, eher eine Parkanlage mit vereinzelten Bäumen. Barnsteiner beugte sich neugierig vor, um den Verlauf des Weges einsehen zu können. „Das ist ja ein Traum“, flüsterte er, als ein kleines Haus zwischen ein paar riesigen Weiden auftauchte.„Freut mich, dass es Ihnen gefällt“, grinste der Notar, „aber hier wohnt der Gärtner, und wir wollen ihm doch nicht sein zu Hause wegnehmen, oder?“Barnsteiner sah den Notar mit offenem Mund an, der mit seiner knochigen Hand nach vorne zeigte. „Das ist Ihr Haus!“Der Weg machte eine leichte Rechtskurve und sie passierten die letzten Bäume. Vor ihnen ragte eine wunderschöne Villa im Stil der Zwanzigerjahre empor. Der Marmor blendete in der Sonne und Barnsteiner kniff die Augen zusammen. Der Bentley hielt vor der Eingangstür, deren Vordach links und rechts von zwei Säulen getragen wurde.„Willkommen in Ihrem neuen Zuhause“, rief Notar Kuschel und stieg aus dem Wagen. Barnsteiner folgte ihm staunend. Der ordentlich gerechte Kies knirschte unter seinen Schritten, als sie zur Eingangstür gingen.„Schön, dass Sie da sind“, begrüßte sie ein Mann in Gärtnerkleidung. „Bitte entschuldigen Sie meine Aufmachung, aber es ist gerade verdammt viel zu tun.“ Er streckte Barnsteiner die Hand entgegen. „Mein Name ist Brugger, Gärtner und Kapitän!“Barnsteiner nickte nur und griff nach der angebotenen Hand. Hatte der Mann gerade „Gärtner und Kapitän“ gesagt? Dann kann man hier sicher mal zum Angeln rausfahren. Ein Kapitän hatte bestimmt auch ein Boot.„Ah – und da kommt mein Maschinist!“, rief der Gärtner und zeigte auf einen Mann, der aus einem Anbau heraustrat.„Freut mich sehr“, sagte er kurz darauf und schüttelte Barnsteiners Hand. „Ich bin Schmidt – Verwalter und Maschinist.“Die beiden Männer machten einen sympathischen Eindruck, doch Barnsteiner war viel zu überwältigt, um ihre Begrüßung zu erwidern. Sein Blick schweifte über die Villa, die ihm jetzt nicht mehr so riesig vorkam. Die Eingangsseite schätzte Barnsteiner auf eine Breite von vielleicht fünfzehn Metern, die Fassade reichte zwei Etagen in die Höhe, bevor das Dach anfing. Auf der rechten Seite schmiegte sich ein fensterloser einstöckiger Anbau an das Haus, der mit seinem Flachdach nicht zu dem Anwesen passte. Er schien nach hinten länger zu sein als das eigentliche Gebäude und bis ans Wasser zu reichen.„Kommen Sie doch herein“, forderte Brugger sie auf. „Es ist schön, wieder jemanden im Haus zu haben. Seit Ummenhofer vor zwei Jahren gestorben ist, stand das Wohnhaus leer.“Barnsteiner folgte den anderen in die Eingangshalle. Dunkle Holzvertäfelungen ließen den Raum kleiner wirken als er war, schwere Teppiche dämpften ihre Schritte. An den Wänden hingen Portraits von Menschen, die er nicht kannte. Zahlreiche Türen führten in angrenzende Räume, eine geschwungene Steintreppe in den ersten Stock.„Kleine Führung gefällig?“, bot Schmidt an.Barnsteiner schaute ratlos zu Notar Kuschel, der ihm auffordernd zunickte.„Gehen Sie nur. Ich warte hier.“