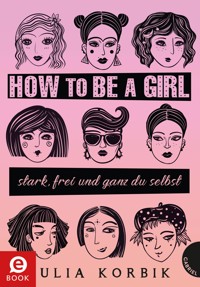19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ob #metoo oder die Proteste im Iran: In den letzten Jahren gab es zahlreiche Anlässe, bei denen Frauen füreinander eintraten. Ein Prinzip, das schon die Feminist:innen der 1970er-Jahre propagierten – nicht umsonst lautete einer ihrer bekanntesten Slogans: Sisterhood is powerful! Aber Schwesterlichkeit ist mehr als Networking, mehr als weibliche Solidarität. Es ist eine politische Praxis. Julia Korbik setzt sich mit dem Prinzip der Schwesterlichkeit auseinander, will verstehen, wie sie aussehen kann – und was sie verhindert. Sie hinterfragt den Feminismus der letzten Jahre und erforscht dieses Thema anhand persönlicher Anekdoten, Beispiele aus Literatur, Popkultur, Geschichte und Gesellschaft inspirierend, nuanciert und neugierig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Julia Korbik
Schwestern
Die Macht des weiblichen Kollektivs
Über dieses Buch
Ob #metoo oder die Proteste im Iran: In den letzten Jahren gab es zahlreiche Anlässe, bei denen Frauen füreinander eintraten. Ein Prinzip, das schon die Feminist:innen der 1970er Jahre propagierten – nicht umsonst lautete einer ihrer bekanntesten Slogans: Sisterhood is powerful! Aber was bedeutet das überhaupt: Schwesterlichkeit als Prinzip? Die feministische Bewegung ist ein gutes Beispiel dafür, dass Schwesterlichkeit und Solidarität unter Frauen nicht einfach gegeben sind. Denn soziale Bewegungen sind nun mal divers, und selbst wenn es ein gemeinsames Ziel gibt, existieren doch unterschiedliche Ansichten darüber, wie es zu erreichen ist. Schwesterlichkeit ist mehr als Networking, mehr als weibliche Solidarität. Es ist eine politische Praxis. Julia Korbik setzt sich mit dem Prinzip der Schwesterlichkeit auseinander, will verstehen, wie sie aussehen kann – und was sie verhindert. Sie hinterfragt den Feminismus der letzten Jahre und erforscht dieses Thema anhand persönlicher Anekdoten, Beispielen aus Literatur, Popkultur, Geschichte und Gesellschaft inspirierend, nuanciert und neugierig.
Vita
Julia Korbik ist freie Journalistin und Autorin in Berlin. Bei Rowohlt erschien von ihr zuletzt «Oh, Simone! Warum wir Beauvoir wiederentdecken sollten», das zahlreiche Leser*innen dazu verführte, sich neu in Simone de Beauvoirs Werk und Leben zu vertiefen. Ihre journalistischen Schwerpunkte sind Politik und Popkultur aus feministischer Sicht. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Luise-Büchner-Preis für Publizistik ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Miriam Bröckel
ISBN 978-3-644-01752-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«I am continually moved to discover I have sisters.»[1]
Gloria Steinem
PrologTücher
Das Theater war bis auf den letzten der rotsamtenen Plätze besetzt. Wohin man schaute: Frauen, Hunderte von Frauen, dazwischen nur verstreut ein paar Männer. Es war laut, die Stimmung euphorisch. Immer wieder brandete Applaus auf. Immer wieder hielten die vier Frauen vorne auf der Bühne inne, warteten gutmütig, bis es ruhiger wurde, und setzten dann ihr Gespräch fort. Schließlich nahmen eine Gitarristin und eine Sängerin den Platz auf der Bühne ein. Sie performten einen Song namens Queer Tango – und in den Rängen gab es kein Halten mehr: Der ganze Saal klatschte, sang und tanzte. Selbst nachdem das Duo die Bühne verlassen hatte und die Veranstaltung offiziell beendet war, blieben viele der Frauen auf ihren Plätzen oder bewegten sich nur sehr langsam Richtung Ausgang. Sie sangen weiter, offenbar ein Protestlied, sie reckten ihre Fäuste in die Höhe. Energisch, entschieden.
Von meinem Platz auf einem der oberen Ränge beobachtete ich das Geschehen. Der Gesang, der Applaus, sie verdichteten sich zu einer Atmosphäre, die so gesättigt war, dass ich meinte, sie mit den Händen fassen, in sie hineingreifen zu können. Ich war als Gast einer deutschen Kultureinrichtung nach Buenos Aires gereist, um dort auf einer Konferenz namens La asamblea de las mujeres (dt. Die Versammlung der Frauen) über Feminismus zu sprechen. Was für eine mitreißende Erfahrung: Die Argentinier:innen diskutierten leidenschaftlich und viel, jedes der zahlreichen Events war gut besucht, und das Ganze hatte etwas von einer Party. Die Abschlussveranstaltung im historischen Nationaltheater Cervantes brachte abends einige der bekanntesten Feminist:innen des Landes auf die Bühne.
Obwohl die Konferenz ein breit gefächertes Themenspektrum bot, überlagerte in diesem Frühjahr 2019 ein Thema alle anderen: der Kampf für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. 2018 hatte das argentinische Parlament eine Legalisierung noch abgelehnt, doch im Oktober 2019 standen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen an – eine Chance, welche die Aktivist:innen der landesweiten Kampagne für ein Recht auf eine legale, sichere und kostenlose Abtreibung nutzen wollten. Schon am ersten Tag der Konferenz hatte ich die grünen Tücher mit dem weiß aufgedruckten Kampagnennamen bemerkt, die viele der Teilnehmer:innen trugen. Als Halstuch, ums Handgelenk gewickelt, an der Handtasche befestigt. Auf den Straßen von Buenos Aires boten Verkäufer:innen diese und andere Tücher zum Verkauf. Für fast jeden politischen Geschmack war etwas dabei: Tücher, die den Einfluss der Kirche auf den Staat anprangerten, oder solche, die mit dem weißen Kopftuch bedruckt waren, dem Symbol der Madres de Plaza de Mayo – Mütter, deren Kinder während der argentinischen Militärdiktatur «verschwunden» waren und die sich nun dafür einsetzten, dass diese Phase der argentinischen Geschichte aufgearbeitet und ihrer Opfer gedacht wird.
Auch an diesem, dem letzten Abend der Frauenkonferenz waren die grünen Tücher omnipräsent und bildeten einen lebendigen Kontrast zum goldgediegenen Dekor des Theaters. Während sich der Saal unter uns leerte, tauschte ich begeisterte Blicke mit meiner Sitznachbarin, einer deutschen Feministin und Journalistin, die wie ich nach Buenos Aires eingeladen worden war. Später schwärmten wir unseren Gastgeber:innen gegenüber von der Veranstaltung: was für ein Zusammenhalt! Von den Argentinier:innen, das stand fest, konnten wir in Sachen feministischer Organisation und Solidarität noch einiges lernen. Unsere Begeisterung löste allgemeine Heiterkeit aus. Ein Mitarbeiter erklärte lachend, hinter den Kulissen sei von Zusammenhalt oft nicht viel zu spüren gewesen: Da weigerte sich die eine, mit der anderen in einer Diskussionsrunde zu sitzen, hatte diese jene mal öffentlich kritisiert und so weiter. Ich musste schmunzeln: Die argentinische ähnelte der deutschen feministischen Szene doch mehr, als ich gedacht hatte. Aber in Argentinien gab es eben auch ein großes gemeinsames Ziel – legale Abtreibung –, hinter dem sich die meisten Feminist:innen sammeln konnten und für das sie bereit waren, Unstimmigkeiten zumindest zeitweise hintanzustellen. Das sollte sich lohnen: Im Dezember 2020 wurden Schwangerschaftsabbrüche in Argentinien legalisiert.
Als ich am Ende meines Argentinien-Aufenthalts ins Flugzeug stieg, hatte ich nicht nur ein grünes Tuch im Gepäck, sondern auch verschiedene Überlegungen. Einige davon trug ich bereits seit einiger Zeit mit mir herum, aber bisher waren sie nicht mehr als Fragmente gewesen, Teile von etwas, dessen Form sich mir entzog. Nach Buenos Aires konnte ich die Form plötzlich klar erkennen: Schwesterlichkeit.
In Buenos Aires hatte ich gespürt, welche Energie und Macht entstehen kann, wenn Frauen, wenn Feminist:innen sich zusammentun und organisieren. Und doch war dieses feministische Wir längst nicht so geeint, wie es nach außen den Anschein erweckte. Was einerseits das Klischee bestätigt, Frauen im Allgemeinen und Feminist:innen im Besonderen würden immer nur streiten und seien sich bei so ziemlich gar nichts einig. Andererseits war das, was ich in Argentinien gesehen und erlebt hatte, real: dieses Gemeinschaftsgefühl, dieser feministische Zusammenhalt. Und ich habe es in den letzten Jahren auch bei anderen Gelegenheiten gespürt: beispielsweise bei #MeToo, dem Women’s March und bei den Protesten gegen § 219a StGB (ein Paragraf, der hierzulande sogenannte «Werbung» für Schwangerschaftsabbrüche verbot). Einer der bekanntesten Slogans der feministischen Bewegung der 1970er lautete Sisterhood is powerful!, und es gibt viele Beispiele, die das belegen. Die zeigen, was passiert, wenn Frauen sich zusammentun und solidarisch füreinander eintreten, wenn sie gemeinsam für ihre Anliegen kämpfen. Denn, das lehrt die Geschichte: Tun Frauen es nicht selbst, tut es im Zweifelsfall auch niemand anderes für sie.
Mir gefällt der Gedanke, dass Schwesterlichkeit mich mit anderen Frauen, anderen Feminist:innen verbindet, uns wie ein unsichtbarer Faden verknüpft. Aber dieser Gedanke kommt mir manchmal auch naiv und romantisch vor. Die feministische Bewegung ist so divers und heterogen – können wir da überhaupt von Schwesterlichkeit sprechen? Und wie kann diese aussehen? Welche Voraussetzungen benötigt sie? Darauf gibt es nicht nur eine Antwort, sondern viele Antworten. Und diese sind interessanter, aber auch komplizierter als oft und gerne zitierte Aussagen wie die der ehemaligen US-amerikanischen Außenministerin Madeleine Albright: «Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen.»[2] Ein solcher Spruch macht sich gut auf einem T-Shirt oder in einem Kalender, der Zitate von inspirierenden Frauen versammelt. Er ist schlagkräftig und einprägsam – aber er sagt uns nichts darüber, was genau das bedeuten soll: anderen Frauen zu «helfen» (für Albright war die Sache klar: Es bedeutet, Hillary Clinton zu wählen).
Schwesterlichkeit als Konzept ist heute etwas aus der Mode gekommen. Vielleicht, weil der Begriff vage esoterisch klingt und nach Frauen, die sich an den Händen fassen und im Kreis tanzen. Vielleicht, weil er so altmodisch wirkt, wie etwas, das besser zu älteren Generationen von Feminist:innen passt als zu heutigen. Für mich ist Schwesterlichkeit ein feministisches Konzept, das auch heute noch Potenzial besitzt. Das inspirieren kann und uns darüber nachdenken lässt, wie politische Solidarität unter Frauen trotz ihrer Verschiedenheiten möglich ist. Es ist kein abstraktes Konzept, keine organisierte Gemeinschaft – wie es der Begriff Schwesternschaft impliziert –, sondern eine lebendige, solidarische Praxis. Und eine optimistische, denn sie geht davon aus, dass die Welt besser, gerechter, gleichberechtigter werden kann, wenn Frauen Banden bilden.
Dieses Buch ist eher eine Erkundung als ein Manifest. Es geht mir weniger darum, alle Antworten zu haben – und mehr darum, die (hoffentlich) richtigen Fragen zu stellen. Vor allem Fragen nach dem feministischen Wir: ein Wir, das umstritten war und ist; das behauptet und eingefordert wird; das manchmal vereint und oft spaltet. Ich möchte zeigen, wie politische, wie feministische Schwesterlichkeit aussehen kann, Vorstellungen liefern, Bilder, Geschichten, Ideen. Ich möchte den Begriff der Schwesterlichkeit mit Leben und Farbe füllen.
Das Tuch hat heute einen Ehrenplatz in meiner Wohnung. Wenn ich am Schreibtisch sitze, befindet es sich genau in meinem Blickfeld: leuchtendes Grün, um eine Regalhalterung gewickelt. Eine Erinnerung, eine Inspiration. Erst nach meiner Rückkehr aus Argentinien fand ich heraus, dass der Name der Konferenz in Buenos Aires – La asamblea de las mujeres – auf eine klassische griechische Komödie von Aristophanes zurückgeht: In Die Weibervolksversammlung (auch: Frauen in der Volksversammlung) übernehmen Frauen in Athen die Macht. Was passiert? Natürlich nichts Gutes: Die Frauen legen Besitztümer und Gelder zusammen, beschließen gleiche Löhne für alle und etablieren die freie Liebe, bei der Frauen sich ihre Sexualpartner:innen aussuchen können. Diese sozialistische Utopie endet im Chaos, und es zeigt sich, dass Frauen, zumal in größeren Gruppen, nicht zu trauen ist. Zwar geht Aristophanes auch mit Männern nicht zimperlich um: Die Frauen beschließen ja nur deshalb, die Herrschaft in Athen zu übernehmen, weil die rein männliche Politik von Habsucht, Krieg und Streitereien geprägt ist. Doch am Ende lautet die Moral von der Geschichte vor allem, dass Frauen unfähig und naiv sind und von wahrer Politik keine Ahnung haben. Oder? Nicht ganz. Denn sosehr Aristophanes sich auch über die politischen Träumereien der Frauen lustig macht, stellt er sie gleichzeitig auch als eine latente revolutionäre Macht dar. Eine Macht, die im Kollektiv entsteht. Schwesterlichkeit.
1Von Brüdern und Schwestern
Im November 2017 machte der französische Autor und Philosophie-Professor Raphaël Enthoven das, wofür der Sender Europe 1 ihn damals bezahlte, nämlich das aktuelle Geschehen aus philosophischer Perspektive zu kommentieren. Thema diesmal: Bei Demonstrationen anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt an Frauen waren in mehreren französischen Städten Plakate mit der Aufschrift Liberté, Égalité, Sororité (dt. Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit) geschwenkt worden. Nach seiner Reaktion gefragt, hielt Enthoven – gekleidet in existenzialistisches Schwarz, die charismatischen Augenbrauen perfekt geformt – ein atemloses Plädoyer gegen den Begriff sororité. Dieser sei schlicht unnötig, schließlich handele es sich bei fraternité, Brüderlichkeit, um einen «generischen» Begriff, der sowohl Männer als auch Frauen einschließe; ähnlich wie der Begriff hommes ja nicht nur Männer bezeichne, sondern Menschen. Niemandem, so Enthoven, käme es in den Sinn, Frauen von der fraternité auszuschließen. Andersherum seien Ausschluss und Exklusivität aber das Ziel der sororité. Diese sei nämlich «weder republikanisch noch demokratisch noch feministisch noch egalitär», sondern Ausdruck einer Clan-Mentalität. Doch damit nicht genug: fraternité durch sororité zu ersetzen, würde den Wahlspruch der Französischen Republik – Liberté, Égalité, Fraternité – «feminisieren und verunstalten». Enthovens Fazit, vorgetragen im Ton eines leidensfähigen Professors, der das Offensichtliche erklären muss, lautete: «Die Schwesterlichkeit ist für die Brüderlichkeit das, was ein Club von Unterstützern für eine Nation ist.»[3] Übersetzt bedeutet das, die selbst ernannten «Schwestern» sollen sich bitte mit einer Art Cheerleader-Rolle zufriedengeben und damit, ihre – sehr viel wichtigeren – «Brüder» zu unterstützen. Et voilà, Thema abgehandelt und beendet. Enthoven lehnte sich zurück, sichtlich zufrieden mit seinem Schlusswort.
Seine Ausführungen mögen polemisch und gönnerhaft sein, in einer Sache aber hat Enthoven recht: Auf rein semantischer Ebene bezeichnet der Begriff fraternité ein «Band der Solidarität, das alle Mitglieder der menschlichen Familie vereinigen sollte»[4]. Alle Mitglieder, nicht nur Männer. Historisch aber war Brüderlichkeit männlich konnotiert, und das nicht nur im Französischen.
Ursprünglich stammt der Gedanke der Brüderlichkeit aus der antiken Philosophie der Stoa, auch Stoizismus genannt, die ungefähr 300 v.Chr. in Griechenland begründet wurde. Zur stoischen Gemeinschaft konnte prinzipiell jeder Mensch gehören, ob Bürger:in oder Sklav:in, ob Griech:in oder Barbar:in (eine Bezeichnung für alle, die nicht beziehungsweise schlecht Griechisch sprachen oder Völkern angehörten, die aus damaliger griechischer und römischer Sicht weniger entwickelt waren). Das stoische Ideal war eine universelle, moralische Gemeinschaft. Eine schöne Zusammenfassung davon liefert der römische Kaiser und Stoiker Mark Aurel in seinen Selbstbetrachtungen:
«Alles ist wie durch ein heiliges Band miteinander verflochten. Nahezu nichts ist sich fremd. Alles Geschaffene ist einander beigeordnet und zielt auf die Harmonie derselben Welt. Aus allem zusammengesetzt ist eine Welt vorhanden, ein Gott, alles durchdringend, ein Körperstoff, ein Gesetz, eine Vernunft, allen vernünftigen Wesen gemein, und eine Wahrheit, sowie es auch eine Vollkommenheit für all diese verwandten, derselben Vernunft teilhaftigen Wesen gibt.»[5]
Das klingt wunderbar gleichberechtigt und weltoffen. Doch war es tatsächlich so, dass auch Frauen – die laut Stoa genau wie Männer als vernunftbegabte Wesen galten – dieser imaginierten Gemeinschaft angehören konnten? Theoretisch ja, der stoische Tugendweg stand Frauen ebenso offen wie Männern.[6] Doch eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gemeinschaft bedeutete das nicht, im Gegenteil: Stoiker wie Epiktet stellten die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen nicht infrage; die natürliche Aufgabe der Frau sahen sie in der Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten.[7]
Das Christentum griff die Vorstellung einer Gemeinschaft aller Menschen auf, ersetzte die kosmologische Begründung der Stoa (nach der das göttliche Prinzip den Kosmos durchwirkt) jedoch durch eine theologische: Demnach sind alle Menschen Kinder Gottes, und somit automatisch Brüder.[8] Aufrufe zu Brüderlichkeit finden sich folglich an vielen Stellen in der Bibel. So schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Thessalonicher: «Von der brüderlichen Liebe aber ist nicht not, euch zu schreiben; denn ihr seid selbst von Gott gelehret, euch untereinander zu lieben.»[9] Der christliche Bruderbegriff setzt sich über alle Grenzen hinweg und findet seinen deutlichsten Ausdruck in dem Gebot: «Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.»[10]
Der Brüderlichkeits-Begriff, wie wir ihn heute kennen und verstehen, wurde während der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution im 18. und 19. Jahrhundert geprägt. Dort traf der universalistische, alle Menschen betreffende Anspruch der Brüderlichkeits-Norm auf die gesellschaftliche Realität, nämlich die Gründung des modernen Staates – und diese war eine Angelegenheit der Männer. Der Sozialwissenschaftler Alex Demirović stellt fest:
«In den bürgerlichen Theorien über den Gesellschaftsvertrag stehen im Zentrum des Zusammenschlusses die Männer: Es sind die männlichen Vorstände der Familien, die sich vertraglich zusammentun, um den Staat zu bilden. Entsprechend konnten die Frauen auch in der modernen Gesellschaft über lange Zeit aus dem Bereich der Öffentlichkeit herausgehalten werden. Der Bereich des Politischen ist der für die Väter, die Söhne, die Brüder.»[11]
Während der Aufklärung erhielt der Begriff der Brüderlichkeit folglich eine politische Dimension, denn er stand in enger Verbindung mit dem Projekt der Revolution sowie der Nationenbildung. Er wurde als eine Form der Solidarität verstanden, die einen Staat, eine Nation oder eine Gesellschaft im Inneren zusammenhält: durch gemeinsame Herkunft, Geschichte, Kultur oder Ideale.[12]Dem Rechtswissenschaftler Michel Borgetto zufolge, der die Entwicklung der Parole Liberté, Égalité, Fraternité im Kontext der Französischen Revolution untersuchte, bezeichnete fraternité nun nicht mehr eine religiöse Brüderlichkeit, die auf der Beziehung zwischen Gott und den Menschen, und auch keine philosophische Brüderlichkeit, die auf der Wesensgleichheit aller Menschen basiert. Stattdessen sei die revolutionäre Brüderlichkeit eine politische Brüderlichkeit, die auf der Zugehörigkeit zur gleichen Gemeinschaft gründe.[13] Weil Frauen (in Frankreich wie anderswo) aus dem Bereich der Öffentlichkeit und damit auch aus dem des Politischen ausgeschlossen wurden, konnten sie nicht Teil dieser Brüderlichkeit sein. Die Französische Revolution mag einen universellen Anspruch gehabt haben, aber die 1789 veröffentlichte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bezog sich nur auf Männer.
Gegen diesen Ausschluss protestierten Frauen, und keine tat es energischer als die Schriftstellerin Olympe de Gouges. Sie veröffentlichte im September 1791 ihre Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin und schrieb in der Präambel: «Die Mütter, die Töchter, die Schwestern, Vertreterinnen der Nation, verlangen, als Nationalversammlung konstituiert zu werden.»[14] De Gouges schwebte eine autonome Bewegung vor, die sich für die Rechte von Frauen engagieren würde. In der Postambel ihrer Erklärung wandte sie sich deshalb dezidiert an Frauen als potenzielle Mitstreiterinnen: «Meine Mitbürgerinnen, wäre es nicht an der Zeit, dass auch unter uns eine Revolution stattfindet? Oder sollten die Frauen auf ewig voneinander isoliert bleiben und nur dadurch der Gesellschaft zugehören, dass sie ihr eigenes Geschlecht verleumden und beim anderen Mitleid erregen?»[15] Es ist ein Aufruf, politisch aktiv zu werden, sich solidarisch mit anderen Frauen zu zeigen und für die eigenen Rechte einzustehen. Es ist ein Aufruf zur Schwesterlichkeit. Und warum sollte nicht auch Königin Marie-Antoinette Teil dieses Bündnisses sein? In einem ihrer Erklärung vorangestellten Brief adressierte de Gouges sie direkt: «Unterstützt eine so schöne Sache, Madame; verteidigt dieses unglückliche Geschlecht, und bald werdet Ihr die Hälfte des Königreichs auf Eurer Seite haben, und von der anderen mindestens ein Drittel.»[16] Marie-Antoinette wird hier einerseits als Königin angesprochen, als Repräsentantin von Macht und Autorität. Und andererseits als Frau, als Schwester, als Gleichgesinnte. Es ist eine schöne Vorstellung: Eine Königin wird zur Revolutionärin und stellt sich an die Seite ihrer Schwestern, um für Emanzipation und Gleichberechtigung zu kämpfen. Die Geschichte aber hatte mit Marie-Antoinette und Olympe de Gouges anderes vor: Erstere wurde im Oktober 1793 mit der Guillotine hingerichtet, Zweitere wenige Wochen später als Royalistin angeklagt und ebenfalls enthauptet. Der Traum von einer Revolution der Frauen, er endete – zumindest in Frankreich – auf dem Schafott.
Obwohl andere den Traum der Schwesterlichkeit weiterträumten, erwiesen sich Begriff und Idee der Brüderlichkeit als erstaunlich langlebig. So heißt es in Artikel 1 der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen sich zueinander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.» Auch hier wird Brüderlichkeit also – mal wieder – als geschlechtsneutraler Begriff vorausgesetzt. Und mal wieder sollen Frauen sich bei etwas sprachlich «mitgemeint» fühlen, von dem sie historisch, gesellschaftlich und politisch ausgeschlossen wurden.
Ein Beispiel dafür ist auch das Lied der Deutschen, dessen dritte Strophe die deutsche Nationalhymne bildet. Der Text lautet bekanntermaßen: «Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! / Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand!» Frauen sind dabei offiziell mitgemeint, aber ich bin sicher nicht die Einzige, vor deren innerem Auge Männer Seit an Seit und brüderlich vereint herummarschieren, wenn sie diese Zeilen hört. Frauen kommen explizit nur in der zweiten Strophe des Liedes der Deutschen vor: «Deutsche Frauen, deutsche Treue / Deutscher Wein und deutscher Sang / Sollen in der Welt behalten / Ihren alten schönen Klang.» Während also die Männer brüderlich mit Herz und Hand nach Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland streben, müssen Frauen zusammen mit Treue, Wein und Sang als urdeutsche Symbole herhalten. Als vor einigen Jahren die damalige Gleichstellungsbeauftragte im Bundesfamilienministerium, Kristin Rose-Möhring, den Vorschlag machte, die Nationalhymne geschlechtergerecht umzuschreiben und zum Beispiel den Begriff «brüderlich» durch «couragiert» zu ersetzen, war die Empörung groß. Auch Johan Schloemann sah das Vorhaben in der Süddeutschen Zeitung kritisch, vor allem aus Gründen des Versmaßes, eines – Achtung, Zungenbrecher! – katalektischen trochäischen Vierhebers. Dieser verlange am Anfang der Zeile ein anfangsbetontes Wort. «Couragiert» aber sei endbetont. Wie also, so Schloemann, könne man «brüderlich» ersetzen? Sein Vorschlag lautet: «[M]it anfangsbetonten Varianten wie ‹Voller Freud›, ‹Voller Kraft› oder ‹Gleichen Sinns›. Oder auch, wenn ein äquivalentes Adjektiv gesucht wird: ‹Gleichgesinnt› oder ‹Freundschaftlich›.»[17] Über den letzten Teil dieses Absatzes bin ich gestolpert: Sind «gleichgesinnt» oder «freundschaftlich» tatsächlich äquivalente Adjektive, die Brüderlichkeit ersetzen können? Ich würde sagen nein, denn beiden Adjektiven fehlt die politische Konnotation von Brüderlichkeit. Es ist kein Zufall, dass der Name der postfaschistischen italienischen Partei Fratelli d’Italia als Brüder Italiens übersetzt wird, und nicht als Geschwister Italiens, obwohl fratelli im Italienischen sowohl Brüder als auch Geschwister bedeutet. Und niemand käme wohl auf die Idee, eine solche Partei Sorelle d’Italia zu nennen, Schwestern Italiens.
Die Genese des Brüderlichkeits-Begriffs zeigt also, dass dieser nicht ohne Weiteres als geschlechtsneutral verstanden werden kann. Lea Susemichel und Jens Kastner merken in ihrer Anthologie Unbedingte Solidarität an, Brüderlichkeit sei «von Heroismus und kämpferischer Entschlossenheit geprägt, denn historisch waren Treue, Loyalität und Pflichtbewusstsein assoziierte Attribute von Freundschaft und Kameradschaft, die traditionell eng mit dem Konzept von Solidarität verknüpft und dementsprechend männlich entworfen wurden.»[18]
Doch Versuche, sich kritisch mit dem Begriff auseinanderzusetzen, ihn zu erweitern oder ihm etwas entgegenzustellen, beispielsweise in Form von Schwesterlichkeit, gelten gemeinhin als überflüssig oder als radikalfeministisches Vorhaben, Männer auszugrenzen. Fast hört man Raphaël Enthoven seufzen: Ach, Frauen – warum nur verstehen sie nicht, dass auch sie Brüder sind? Er ist jedoch nicht der Einzige, der Schwesterlichkeit, Wort wie Konzept, kaum etwas abgewinnen kann. Während meiner Recherchen war ich erstaunt, wie selten das Thema in der Forschung überhaupt vorkommt und, wenn ja, wie wenig ernst es genommen wird. Das fängt schon bei der Begrifflichkeit an. Der Mittelalterhistoriker Klaus van Eickels konstatiert, dass es im Deutschen und in anderen europäischen Sprachen kein weibliches oder geschlechtsneutrales Äquivalent zu Bruder und Brüderlichkeit gebe, welches über dieselben Konnotationen verfügen würde: «Der Begriff Schwester ist zwar ähnlich emotionsgeladen wie der des Bruders, doch fehlte dem Verhältnis von Schwestern zueinander offenbar die soziale Relevanz, die die Bildung eines eigenen Abstraktums oder Adjektivs erfordert hätte.»[19] Als ich das las, musste ich unwillkürlich lachen. Denn ja, «offenbar» fehlte dem schwesterlichen Verhältnis die soziale Relevanz, aber das hat Gründe und ist nicht so zufällig, wie die Formulierung glauben lässt. Das Verhältnis zwischen Schwestern galt deshalb als sozial weniger relevant, weil Frauen in Geschichte und Gesellschaft allgemein als weniger relevant galten; ihre Beziehungen untereinander wurden im Vergleich zu denen zwischen Männern daher als unwichtig oder zumindest unwichtiger abgetan. Was zählte, waren einerseits die brüderlichen Beziehungen zwischen Männern und andererseits das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau. Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern, zwischen Schwestern, zwischen Freundinnen, kam nicht die gleiche Bedeutung zu. Dass sich zum Begriff der Brüderlichkeit nicht parallel ein weibliches Pendant entwickelte, ist also kein Wunder.
Vielleicht ärgert mich die Abwertung von schwesterlichen Beziehungen so sehr, weil ich selbst als Ältere von zwei Schwestern aufgewachsen bin und die Beziehung zu meiner jüngeren Schwester Johanna mit die wichtigste in meinem Leben ist. Doch auch unabhängig davon kann man sich die Frage stellen, warum gerade Brüder so idealisiert und als Sinnbild für Zusammenhalt und Solidarität hochgehalten werden, schließlich wimmelt es in Mythologie, Geschichte und Kultur von Brüdern, die sich aus Machtgier gegenseitig ermorden: In der Bibel erschlägt Kain den Abel; in der römischen Mythologie tötet Romulus Remus; in der ägyptischen Mythologie ermordet Set Osiris; in der griechischen Mythologie töten sich Eteokles und Polyneikes im Kampf gegenseitig; in Shakespeares Hamlet wird der herrschende König von seinem Bruder ermordet; in Disneys Der König der Löwen wird Mufasa von seinem Bruder Scar eine Klippe hinuntergestoßen und damit in den sicheren Tod; in Francis Ford Coppolas Der Pate II lässt Michael Corleone seinen älteren Bruder Fredo erschießen; in Marvels Black Panther tötet König T’Chaka seinen jüngeren Bruder N’Jobu; und in Game of Thrones bringt Stannis Baratheon seinen jüngeren Bruder Renly mithilfe eines Schatten-Mörders um. Der Brudermord ist jedoch nicht auf Mythologie und Kultur beschränkt, sondern findet sich auch in der Geschichte: Im ottomanischen Reich wurde er von Mehmed II. als politische Praxis legalisiert, die den Staat vor Erbstreitigkeiten, Bürgerkrieg und Unruhen schützen sollte.[20] Während der Tang-Dynastie im chinesischen Kaiserreich ermordete Prinz Li Shimin seinen älteren Bruder, den Kronprinzen Li Jiancheng, und seinen jüngeren Bruder Li Yuanji; drei Tage nach dem Coup wurde Li Shimin zum neuen Kronprinzen ernannt, und kurze Zeit später folgte er seinem Vater auf den Thron.[21] All diese Brüder mögen sich nicht unbedingt durch Liebe und Loyalität zueinander auszeichnen, aber auch diese mörderische Form der Brüderlichkeit besitzt eine politische Konnotation und Relevanz, denn es geht dabei um Macht.
Der Schwesterlichkeit fehlt diese politische Relevanz, zumindest im Deutschen. Der Duden versteht unter dem Begriff eine «schwesterliche Art, Gesinnung»[22], was maximal vage klingt. Damit auseinandergesetzt hatte ich mich nie wirklich, bis ich vor einiger Zeit eine Lesung mit der französischen Schriftstellerin Chloé Delaume moderierte. Delaume hat zwei Bücher veröffentlicht, die die Schwestern im Titel tragen: den Essay Mes bien chères sœurs (etwa: Meine lieben Schwestern) und die Anthologie Sororité. Vor der Veranstaltung tranken Delaume und ich zusammen Kaffee und tauschten uns über das Konzept der Schwesterlichkeit aus. Sie habe gehört, so Delaume, dass die sororité im Deutschen keine richtige Entsprechung habe. Ich antwortete, doch, die gäbe es: Schwesterlichkeit. Delaume guckte skeptisch und sagte, nach allem, was sie wisse, fehle dem deutschen Begriff die politische Konnotation, die der französische Begriff habe. In meinem Kopf begann es zu arbeiten, ich überlegte und ahnte: Delaume hat recht. Der Larousse, das französische Pendant zum Duden, bestätigt das: sororité, heißt es dort, stehe für eine «attitude de solidarité féminine»[23], also eine Haltung weiblicher Solidarität. Bereits 1546 definierte der Schriftsteller und Humanist François Rabelais sororité als eine «Gemeinschaft von Frauen», die sich durch eine «Beziehung, Schwesternqualität» auszeichne.[24] Im mittelalterlichen Latein hatte der Begriff sororitas noch eine «religiöse Gemeinschaft von Frauen» bezeichnet[25] – so, wie sich der deutsche Begriff Schwesternschaft immer noch auf Nonnen oder Krankenschwestern bezieht (ein weiterer Grund, weshalb ich von Schwesterlichkeit spreche). Es ist also Rabelais zu verdanken, dass Schwesterlichkeit in Frankreich seit dem 16. Jahrhundert politisch konnotiert ist und so auch im Wörterbuch steht. Doch der Begriff gehörte lange Zeit nicht zum allgemeinen Wortschatz und wurde kaum benutzt. In den letzten Jahren aber hat er in Frankreich eine Renaissance erlebt, davon zeugen unter anderem die Plakate mit der Aufschrift Liberté, Égalité, Sororité, die Raphaël Enthoven so in Rage brachten. Die fraternité ist Teil des Wahlspruchs der Französischen Republik und damit enorm sichtbar: Sie prangt an Gebäuden und auf französischen Euromünzen. Ob man will oder nicht, man wird ständig mit ihr konfrontiert – dass Feminist:innen das kritisch sehen und dem etwas gegenüberstellen wollen, überrascht also nicht. Und dabei geht es um mehr als nur darum, fraternité durch sororité zu ersetzen: Es geht darum, etwas existent zu machen. Oder, wie Chloé Delaume sagt: «Was nicht benannt wird, existiert nicht.»[26] Das Wort sororité zu benutzen, bedeutet für sie, die Zukunft zu verändern.[27]
In Frankreich brauchte es die feministische Bewegung der 1960er und 1970er, um den Begriff aktiv zu verwenden, ihn in die Öffentlichkeit zu holen und zu einem politischen Konzept zu machen. Vorbild dafür waren US-amerikanische Feminist:innen, die das Konzept der sisterhood als Gegenentwurf zur brotherhood entwickelten.[28] Im Englischen handelte es sich dabei um einen Neologismus, eine Wortneuschöpfung im Dienste des militanten Feminismus. Das war notwendig, weil der bereits existierende Begriff sorority für eine Verbindung weiblicher Studierender steht (auch eine Art von Schwesterlichkeit, aber eine, bei der, so das Klischee, Partys, griechische Buchstaben und elaborierte Aufnahmerituale mehr im Vordergrund stehen als politischer Aktivismus). Sisterhood ist in diesem Kontext ein dezidiert politischer Begriff, weil er in bewusster Abgrenzung zur männlichen brotherhood und mit dem Ziel geschaffen wurde, ein weibliches, feministisches Zusammengehörigkeitsgefühl zu etablieren. Das Cambridge Dictionary definiert sisterhood dementsprechend als «a strong feeling of friendship and support among women who are involved in action to improve women’s rights.»[29] Und laut dem amerikanischen Wörterbuch Merriam-Webster bedeutet der Begriff «the solidarity of women based on shared conditions, experiences or concerns.»[30]
Eines springt sofort ins Auge: Sowohl in der englischen als auch in der französischen Definition von Schwesterlichkeit geht es um Solidarität. Aber was bedeutet das konkret: Solidarität unter Frauen? Die Probleme beginnen bereits damit, dass Solidarität einer dieser vagen Begriffe ist, die vieles meinen können. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er oftmals synonym für Unterstützung, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft oder Verantwortung benutzt und insbesondere seit der Covid-19-Pandemie wird mit dem Begriff etwas sorglos umgegangen. So ertappte ich mich selbst dabei, wie ich in den frühen, ängstlichen, verwirrenden Wochen und Monaten der Pandemie am Telefon zu meiner Mutter sagte, wir müssten jetzt alle «solidarisch miteinander» sein – ohne dass ich eine wirkliche Vorstellung davon hatte, was das bedeuten soll. Später beschwerte ich mich bei meiner Schwester über Menschen, die in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maske tragen und sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollten. «Unsolidarisch» fand ich diese Menschen. Den Begriff auszusprechen, hinterließ ein schales Gefühl im Mund, ein Gefühl von «wir» gegen «die anderen». Allerdings, darauf verweisen Lea Susemichel und Jens Kastner, gehört auch das zum Verständnis von Solidarität: «Jedes Kollektiv braucht ein konstituierendes Außen, gegen das es sich zusammenschließt.»[31]
Ganz grundsätzlich, und im ethisch-politischen Sinne, bezeichnet Solidarität eine Haltung der Verbundenheit und des Zusammenhalts, ein Eintreten füreinander und vor allem für Menschen, die die gleichen Werte und Überzeugungen teilen wie man selbst.[32] Der Philosoph Kurt Bayertz drückt es so aus: «In der Regel verstehen wir unter ‹Solidarität› ein wechselseitiges Einstehen von Personen füreinander, die durch spezifische Gemeinsamkeiten miteinander verbunden sind. Man ist solidarisch mit Menschen, deren Geschichte, deren Überzeugungen oder Interessen man teilt […].»[33] Doch für die Schweizer Philosophin Rahel Jaeggi braucht es mehr als das: Solidarität dürfe nicht gleichgesetzt werden mit bloßer Verbundenheit oder Gemeinschaft, sondern sie benötige ein gemeinsames Ziel.[34]
Der Begriff Solidarität, wie er heute verstanden wird, hat seine Wurzeln in der Arbeiter:innenbewegung. Dort gehörte er gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu den leitenden Wertideen, mit denen neue Formen wechselseitiger Bindungen beschrieben werden sollten. Darüber hinaus meinte Solidarität auch ein bestimmtes, widerständiges Verhaltensmuster, das Arbeiter:innen von den besitzenden Klassen unterscheiden sollte. Solidarität war somit ein politischer Kampfbegriff: Es ging um eine Solidarität unter Gleichen, die auf gemeinsamen Abhängigkeiten basierte.[35] Nach dem Zweiten Weltkrieg verankerte die SPD Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität als «Grundwerte des Sozialismus» in ihrem Godesberger Grundsatzprogramm von 1959.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat der Begriff Solidarität zunehmend den der Brüderlichkeit ersetzt, um den Fokus auf diverse Formen gegenseitiger Unterstützung zu legen.[36] Und sicher auch, weil Brüderlichkeit die Frauen, die Schwestern, historisch ausgeschlossen hat. Aber, wieder die Frage: Meinen die beiden Begriffe Brüderlichkeit und Solidarität tatsächlich dasselbe? Klaus van Eickels verweist darauf, dass Solidarität eine Gemeinschaft heraufbeschwört, die auf gemeinsamen Interessen und Zielen beruht. Brüderlichkeit hingegen beruhe auf der Fiktion, «dass eine Gruppe durch ein natürliches Band zusammengehalten wird, das der Verfügung des Einzelnen entzogen ist.»[37] Es wird nicht explizit gesagt, aber dieses «natürliche Band» scheint das Geschlecht zu sein.
Auch wenn es um weibliche Solidarität geht, wenn die sisterhood beschworen wird, schwingt dabei immer mit, dass Frauen untereinander miteinander solidarisch sein sollen, weil sie … nun ja, Frauen sind. Das erscheint mir zugleich simpel und kompliziert. Und es frustriert mich: weil diese Art von Solidarität biologisch determiniert ist und außerdem impliziert wird, sie sei gegeben. Doch Solidarität, welcher Art auch immer, existiert nicht einfach, sondern muss errungen, muss hergestellt werden: Solidarität ist nicht, sie entsteht. Sie wird geschaffen, und zwar im konkreten Handeln.[38] Das Gleiche gilt für Schwesterlichkeit.
Doch erstaunlich viele Menschen scheinen der Meinung zu sein, dass genau das nicht möglich ist: Solidarität unter Frauen, Schwesterlichkeit. Schließlich streiten Frauen immer nur, sind eifersüchtig aufeinander und machen sich gegenseitig das Leben schwer. Haben Frauen eine Meinungsverschiedenheit, steht die Diagnose sofort fest: Zickenkrieg! Sind Frauen anderen Frauen gegenüber aggressiv, arrogant oder abwertend, handelt es sich selbstverständlich um Stutenbissigkeit. Wenn zwei Frauen sich streiten, freut sich die Öffentlichkeit. Seit Jahren berichten Medien über eine angebliche Fehde zwischen Meghan, Herzogin von Sussex (geborene Markle), und Catherine, Prinzessin von Wales (geborene Middleton): Es geht um Tränen, Eifersucht und um einen Lipgloss, den Catherine angeblich nicht mit Meghan teilen wollte. Im Frühjahr 2023 dann eine neue Frauen-Fehde: Hailey Bieber, verheiratet mit Sänger Justin Bieber, lästerte zusammen mit Freundin Kylie Jenner in einem TikTok-Video über Justin Biebers Ex-Freundin, die Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez. Zumindest interpretierten diverse TikTok-User:innen das so. Bieber und Jenner bestritten, sich über Gomez lustig gemacht zu haben, doch das Internet war nicht überzeugt – schließlich, so das Gerücht, sei Hailey Bieber seit Jahren eifersüchtig auf Selena Gomez. Bieber erhielt böse Kommentare und Morddrohungen, und Gomez sah sich genötigt, öffentlich zu einem freundlicheren Miteinander aufzurufen.
Das Stereotyp von Frauen, die sich um einen Mann streiten, ist fest in unserer Kultur verankert. 1998 sangen Brandy und Monica in The Boy is Mine über einen Mann, den beide für sich beanspruchten: «You need to give it up / Had about enough / It’s not hard to see / The boy is mine.» Im 2007 veröffentlichten Song Misery Businessder Band Paramore teilt Sängerin Hayley Williams gegen eine Konkurrentin aus: «Once a whore, you’re nothing more». Allerdings war Williams damals erst 19 Jahre alt und hat seitdem klargemacht, dass sie einen solchen Song heute nicht mehr schreiben würde.[39] Ähnlich widersprüchliche Gefühle scheint Taylor Swift gegenüber ihrem 2010er-Song Better than revenge zu haben. Auch hier geht es um eine Konkurrentin: «She’s not a saint and she’s not what you think / She’s an actress, whoa / She’s better known for the things that she does / On the mattress, whoa.» Swift schrieb den Song, als sie 18 war, spielt ihn heute nicht mehr live und änderte 2023 die entsprechende Liedzeile auf der Neuaufnahme ihres ursprünglich 2010 erschienenen Albums Speak Now (was die Zeile, ehrlich gesagt, nicht besser macht).
Es scheint, als könnten Frauen sich nur negativ aufeinander beziehen, in Form von Konkurrenz und Eifersucht. Und das gilt selbst für Schwestern, wie die Ballade The Twa Sisters