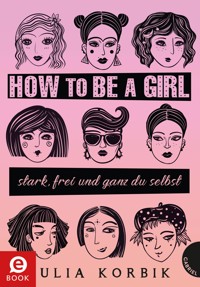Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Wie in „Oh, Simone!“ schreibt Julia Korbik in ihrem neuen Buch über eine weitere große Ikone der französischen Literatur: Françoise Sagan. Françoise Sagan ist mehr als nur eine Schriftstellerin – sie ist ein Mythos. Mit gerade einmal 18 Jahren katapultiert sie der bahnbrechende Erfolg ihres Debütromans "Bonjour Tristesse" 1954 in die Öffentlichkeit, und sie wird zur Projektionsfläche, zur ewigen Kindfrau, die in schnellen Autos und mit jeder Menge Alkohol durch ihr Leben braust. Welchen Preis hat die Freiheit? Mit Hingabe und Esprit schreibt Julia Korbik über eine Schriftstellerin, die, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und zwischen zwei Wellen der Frauenbewegung, nach ihrem Platz in der Welt sucht. "Bonjour Liberté" verbindet Zeit- und individuelle Geschichte und zeigt, dass es sich lohnt, auf der eigenen Freiheit – als Frau – zu bestehen. Aber eben auch, dass dieses Vorausgehen Mut erfordert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wie in ihrem Roman »Oh, Simone!« schreibt Julia Korbik in ihrem neuen Buch über eine weitere große Ikone der französischen Literatur: Françoise Sagan.Françoise Sagan ist mehr als nur eine Schriftstellerin — sie ist ein Mythos. Mit gerade einmal 18 Jahren katapultiert sie der bahnbrechende Erfolg ihres Debütromans »Bonjour Tristesse« 1954 in die Öffentlichkeit, und sie wird zur Projektionsfläche, zur ewigen Kindfrau, die in schnellen Autos und mit jeder Menge Alkohol durch ihr Leben braust. Welchen Preis hat die Freiheit? Mit Hingabe und Esprit schreibt Julia Korbik über eine Schriftstellerin, die, vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und zwischen zwei Wellen der Frauenbewegung, nach ihrem Platz in der Welt sucht. »Bonjour Liberté« verbindet Zeit- und individuelle Geschichte und zeigt, dass es sich lohnt, auf der eigenen Freiheit — als Frau — zu bestehen. Aber eben auch, dass dieses Vorausgehen Mut erfordert.
Julia Korbik
Bonjour Liberté
Françoise Sagan und der Aufbruch in die Freiheit
Hanser Berlin
Inhalt
Vorwort
Prolog
Teil I
Teil II
Teil III
Teil IV
Dank
Epilog
Anmerkungen
Literatur
Für meine Großeltern
»Alles in allem geben
Whisky, Ferrari, Glücksspiel
ein unterhaltsameres Bild ab
als Stricken, Haushalt, Sparsamkeit …«1
Vorwort
»Wurde 1954 mit einem schmalen Roman berühmt, Bonjour Tristesse, der für einen weltweiten Skandal gesorgt hat. Nach einem Leben und einem Werk, die genauso angenehm wie verpfuscht waren, war ihr Tod nur noch für sie selbst ein Skandal.«1 Diese Zeilen schrieb FranÇoise Sagan Ende der 1980er, gut fünfzehn Jahre vor ihrem Tod als Nachruf auf sich selbst. Es sind nur wenige Zeilen, aber in ihnen steckt so viel von dem, was Sagan ausmachte: ein leiser Humor, Selbstironie, aber auch eine gewisse Melancholie. Und, natürlich, der Verweis auf ihr berühmtestes Werk, Bonjour Tristesse, das sie als gerade einmal 18-Jährige weltbekannt machte.
Sagan war vieles: eine Frau, die mit ihrem Ruhm eine komplizierte Hassliebe verband; die nach außen hin das lustige Partygirl gab und sich in Wahrheit unendlich einsam fühlte; die sich darüber ärgerte, auf Klischees reduziert zu werden, und diese Klischees gleichzeitig gekonnt bediente: schnelle Autos, Whisky, Glücksspiel, Urlaub in Saint-Tropez; die augenscheinlich frei war, und doch gefangen in sich selbst. Schon früh hat Sagan erkannt, dass sie, um sich zu schützen, in der Öffentlichkeit eine Maske aufsetzen muss. Eine Verkleidung, die es ihr erlaubt, in eine Rolle zu schlüpfen: in die der berühmten Schriftstellerin Françoise Sagan. So trug sie zur eigenen Legendenbildung bei.
Diese Legende entstand in den 1950er Jahren. In dieser Zeit wurde Sagan zum Gesicht eines neuen Frankreichs; einer Generation, die als Kinder den Zweiten Weltkrieg miterlebt und nun genau ein Ziel hatte: sich in die Zukunft zu werfen, ungehemmt, frei und furchtlos. In den Jahren zwischen 1950 und 1960 wurde aus einem Mädchen, das heimlich davon träumte, berühmt zu sein, ein lebender Mythos. Aus der 1935 geborenen Françoise Quoirez, Tochter einer großbürgerlichen Familie, wurde Françoise Sagan, eine Skandalschriftstellerin. Doch nicht nur deshalb liegt der Fokus in diesem Buch auf den 1950er Jahren. Sondern auch, weil damals langsam Bewegung in das starre Geschlechterkorsett kam. Allgemein gelten die 1960er als das revolutionäre Jahrzehnt, als die Zeit, in der Frauen in der westlichen Welt erneut und vehement begannen, sich gegen die für sie vorgesehene gesellschaftliche Rolle aufzulehnen. Aber: Diese Auflehnung machte sich bereits in den 1950ern bemerkbar. So auch in Frankreich, wo viele Frauen, die sich während des Krieges auf verschiedene Weise um ihre Heimat verdient gemacht hatten, nicht länger bereit waren, sich brav auf Haushalt und Ehemann zu konzentrieren. Die strikten Geschlechterrollen galten noch, ja, aber sie wurden von Frauen mehr und mehr hinterfragt. Françoise Sagan aber hinterfragte nicht, sie machte einfach. Als junge Frau in einer Zeit, in der Frauen wenig durften und viel mussten, beanspruchte sie für sich große persönliche Freiheiten und wagte einen eigenen Lebensentwurf. Oft rieb sie sich an gesellschaftlichen Konventionen, aber nicht zuletzt auch an sich selbst.
Eine fahnenschwingende Feministin, das muss erwähnt werden, war Françoise Sagan nicht. Was vor allem an ihrer hartnäckigen Weigerung lag, sich in irgendeine Schublade stecken zu lassen: Ihre Lebensphilosophie war freiheitsbasiert und entschieden individualistisch. Um Ideologien machte sie einen großen Bogen. Was nicht heißt, dass sie feministische Anliegen nicht aktiv unterstützte. So unterschrieb sie aus voller Überzeugung 1971 das Manifest der 343, in dem die Legalisierung der Abtreibung gefordert wurde — nur um später ihren Namen unter »einer beängstigend dicken Schlagzeile« wiederzufinden: »Frauen, euer Bauch gehört euch!«2 Sagan war das viel zu plakativ und, nun ja, dramatisch. Belustigt erinnerte sie sich später:
»Also, ich schwöre, wenn ich gewusst hätte, in welcher Weise mein Engagement verwertet werden würde, hätte ich nie unterschrieben. Meine Mutter hat danach übrigens zehn Tage lang kein Wort mit mir gesprochen — nicht, weil ich ihr das x-te Enkelkind verweigerte, sondern weil ich es zugelassen hatte, dass eine Zeitschrift, egal welche, etwas über meinen Bauch schrieb.«3
Anders gesagt: Mehr gesellschaftliche Rechte für Frauen? Oui! Aber bitte, ohne ordinär zu werden. Sagan mochte wie eine Revolutionärin wirken, ihren bürgerlichen Habitus aber wurde sie nie richtig los.
Gut möglich, dass die soeben erwähnte Geschichte über Sagans Mutter, die tagelang nicht mit ihrer Tochter sprach, nie so passiert ist. Denn Sagan hatte einen Hang zum Flunkern, dazu, Geschehenes ein wenig interessanter und dramatischer darzustellen, als es eigentlich war. Das macht sie mitunter schwer zu fassen. Hinzu kommt, dass Sagan andere Menschen, sogar enge Freund*innen, stets gekonnt auf Abstand hielt. Selbst in ihren autobiografischen Texten bleibt sie in ihrer Rolle der charmanten Geschichtenerzählerin, die fröhlich aus dem Nähkästchen plaudert, ohne jemals wirklich etwas von sich preiszugeben. Ich habe trotzdem versucht, mich Françoise Sagan zu nähern. Genau hinzuschauen. Dabei war mir von Anfang an klar, dass Bonjour Liberté keine klassische Biografie werden würde, sondern ein Schlaglicht auf die wahrscheinlich wichtigsten Jahre in Sagans Leben — die Jahre, in denen aus einer unbekannten Pariserin mit abgebrochenem Studium ein weltberühmter Star wurde.
Und ein Star ist sie auch heute noch. Siebzehn Jahre nach ihrem Tod erliegen die Menschen noch immer ihrem Charme: Als im Spätsommer 2019 ein bisher unveröffentlichter Roman von Françoise Sagan erschien, Die dunklen Winkel des Herzens, war das in Frankreich eine literarische Sensation. Schon Wochen vorher war in den Medien und der Pariser Verlagswelt von einem mysteriösen Buch die Rede gewesen, dessen Auflage satte 250.000 betragen würde. Fünfundsechzig Jahre nachdem ihr aufsehenerregendes Debüt Bonjour Tristesse erschienen war, bewies sich wieder einmal die anhaltende Strahlkraft der Françoise Sagan. Sie war und ist unwiderstehlich.
Gründe dafür gibt es viele. Ein herausragender ist Sagans Sinn für Humor. Sie selbst befand: »Ich denke, dass das beste Gegenmittel der Humor ist.«4 Das Gegenmittel wofür? Für das Leben natürlich, mit all seiner Einsamkeit und Absurdität, mit seinen rauschhaften Höhenflügen und niederschmetternden Talfahrten. Sagan konnte über sich selbst lachen und schaffte es so fast immer, die Sympathien auf ihrer Seite zu haben. Und dann ist da natürlich die Literatur, ihre vielen Bücher, die sie hinterlassen hat. Wunderbar leicht geschriebene Bücher, die schwierige Themen verhandeln: die Unmöglichkeit der Liebe, Einsamkeit, die Sehnsucht danach, verstanden zu werden. Es sind zeitlose und wichtige Themen, die sich durch ihr gesamtes Werk ziehen, angefangen mit ihrem Debüt Bonjour Tristesse.
Vor allem aber verkörpert Françoise Sagan Freiheit. Unbeirrt ging sie ihren eigenen Weg. Schwerer Rückschläge, emotionaler Krisen und Enttäuschungen zum Trotz, strahlte sie eine fröhliche Leichtsinnigkeit aus, eine ungestüme Bereitschaft, sich ins Leben zu werfen. Eine Überzeugung, dass Leben das ist, was man draus macht — und dass es oft die kleinen Momente des Glücks sind, die zählen: ein Nachmittag, den man lesend im Bett verbracht hat; ein Essen mit Freund*innen; der Geruch von Meer; der Fahrtwind in den Haaren.
Françoise Sagan ist ein personifiziertes Schulterzucken. Ein lässiges »Na und?«. Warum so sein wie alle anderen, wenn man einzigartig sein kann? Warum sich mit dem monotonen Alltag abfinden, wenn es doch so viele Möglichkeiten gibt, sich das Leben schöner zu machen? Ich habe das Gefühl, dass ich von Sagan noch einiges lernen könnte, nicht nur, was savoir vivre angeht: Zum Beispiel, dass Humor manchmal tatsächlich die beste Waffe ist, dass man sich seine Kämpfe sorgfältig aussuchen sollte und dass am Ende zählt, was man wirklich getan hat. Würde ich als Beifahrerin neben der wie ein Schlot rauchenden und viel zu schnell fahrenden Sagan im Auto sitzen wollen? Eher nicht. Aber einen Whisky würde ich gerne mit ihr trinken — und mich von Sagans Lässigkeit und joie de vivre anstecken lassen.
Prolog
Paris 1954
Das leise Bimmeln der Türglocke lässt die Verkäuferin von ihrem Buch aufblicken. Sie lächelt der Kundin, die soeben den Laden betreten hat, freundlich zu — ein Blick, der, so hofft sie, sowohl ein »Willkommen« ausdrückt als auch ein »Ich bin für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen«. Insgeheim hofft die Verkäuferin jedoch, dass die Kundin keine Hilfe benötigt. Hinter der Ladentheke, das Buch so in den Händen haltend, dass der Titel versteckt ist, liest sie weiter:
»… hielt mich fest und küsste mich. Ich erinnere mich noch an den Geschmack dieser atemlosen, wirkungslosen Küsse und wie Cyrils Herz an meines schlug im Takt der Wellen, die sich auf dem Sand brachen … Eins, zwei, drei, vier Herzschläge, dann jenes weiche Geräusch auf dem Sand, eins, zwei, drei … eins … Sein Atem ging ruhiger, sein Küssen wurde genauer, intensiver, ich hörte das Meeresrauschen nicht mehr, aber in meinen Ohren das schnelle, fortgesetzte Pochen meines eigenen Bluts.«1
Das ist doch … unerhört, denkt die Verkäuferin. Unerhört und — sinnlich. Sie liest weiter: »Eines Abends schreckte Annes Stimme uns auf. Cyril lag an mich geschmiegt …«2
»Entschuldigen Sie, Madame.«
Die Kundin, die gerade hereingekommen ist, steht nun vor ihr. Unwillig blickt die Verkäuferin auf. Die Kundin ist jung, vielleicht vierzehn oder fünfzehn, zumindest sieht sie so aus, mit ihrer schmalen Figur und dem jungenhaften Kurzhaarschnitt.
»Wie kann ich Ihnen helfen, Mademoiselle?«, fragt die Verkäuferin. Hinter der Ladentheke hat sie den Zeigefinger der rechten Hand ins Buch gelegt, um die Seite nicht zu verblättern. »Ich bin auf der Suche nach einem guten Roman«, sagt die Kundin, nicht besonders laut, ihr Blick ist auf den Boden gerichtet. »Haben Sie Empfehlungen für mich?«
Die Arbeit ruft, leider. Die Verkäuferin greift nach einem Bleistift, legt ihn ins Buch. Ein improvisiertes Lesezeichen. Während sie die Ladentheke umrundet, versucht sie, ihrem Gesicht einen dienstbeflissenen und aufgeschlossenen Ausdruck zu verleihen. Sie zeigt der Kundin mehrere Romane, französischsprachige Autor*innen, Übersetzungen … Marguerite Duras’ Die Pferdchen von Tarquina, zwar schon ein Jahr alt, aber warum nicht? Oder etwas von Simone de Beauvoir? Ihr neuer Roman wird im Oktober erscheinen, man munkelt, sie könne dieses Jahr den Prix Goncourt erhalten. Ray Bradbury vielleicht? Sein Fahrenheit 451 liegt in französischer Übersetzung vor. Auch den aktuellen Roman von Alain Robbe-Grillet hat sie da, obwohl sie mit dieser Bewegung des sogenannten Nouveau roman nicht viel anfangen kann. Was bitte war schlecht am »alten« Roman?
Die Kundin hört höflich zu, aber so richtig scheint sie die Auswahl an Romanen nicht zu begeistern. Ihr Blick wandert über die Verkaufsauslage und bleibt an einem Buch hängen. Sie nimmt es in die Hand und hält es hoch, so, dass die Verkäuferin den Buchdeckel — weiß, mit einem grünumrandeten Rechteck in der Mitte — sehen kann: »Was ist mit diesem hier?« Die Verkäuferin kennt den Buchdeckel und das dazugehörige Buch nur allzu gut, liegt es doch hinter dem Tresen und wartet darauf, weitergelesen zu werden. Sie verzieht missbilligend den Mund: »Das haben wir gestern reinbekommen. Aber ehrlich gesagt, würde ich es Ihnen nicht empfehlen. Ein kleines Luder hat es geschrieben. Ich habe darin herumgeblättert, und, nun, Mademoiselle, darin werden abscheuliche Dinge erzählt.«
Abscheulich ja. Aber auch anregend, entfesselnd. Und deshalb denkbar ungeeignet für die zarten Seelen junger Leserinnen, findet die Verkäuferin. Das ältere Ehepaar, das vor dem Regal mit Lyrik und Theaterstücken steht, schaut interessiert herüber. Die Kundin hält immer noch das fragliche Buch in der Hand und sagt, plötzlich entschlossen: »Ich nehme es.« Das »trotzdem« am Ende des Satzes spricht sie nicht aus, die Verkäuferin hört es dennoch ganz genau. Was soll’s, sie hat ihr Bestes gegeben, die junge Mademoiselle von dieser schändlichen Lektüre abzubringen. Sollen sich doch deren Eltern mit den Konsequenzen moralisch zweifelhafter Einflüsse herumschlagen. An der Kasse nimmt sie das Geld der Kundin entgegen, 390 Francs für 180 Seiten.
»Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, Mademoiselle.«
»Merci, Madame, das wünsche ich Ihnen auch. Au revoir.«
Die Ladenglocke bimmelt, hinter der Kundin fällt die Tür ins Schloss. Die Verkäuferin vergewissert sich mit einem Rundumblick, dass die anderen Kund*innen — das ältere Ehepaar, ein junger Mann mit Hornbrille — keine Hilfe benötigen, bevor sie den Bleistift aus ihrem Buch nimmt und weiterliest: »… wir waren halb nackt im schattig-roten Licht des Sonnenuntergangs …«3
*
Die Kundin tritt auf den Boulevard Saint-Germain hinaus, ihr soeben gekauftes Buch in den Händen. Sie atmet die frische Frühlingsluft ein — und ihre Angespanntheit aus. Die Frau schaut auf das Buch. Um den unteren Teil des weißen Buchdeckels windet sich eine gelbe Bordüre, darauf abgedruckt: das Schwarz-Weiß-Foto einer jungen Frau sowie der Slogan Le diable au cœur, den Teufel im Herzen. Die junge Frau berührt das Gesicht auf der Bordüre, liest den Titel: Bonjour Tristesse. Sie klemmt sich das Buch unter den Arm, fischt in ihrer Handtasche nach Feuer und Zigaretten und zündet sich eine an. Sie inhaliert tief. Ein Lächeln stiehlt sich auf ihr Gesicht. Mit dem Buch unterm Arm und der Zigarette in der Hand läuft Françoise Sagan los, vorbei am Café Les Deux Magots, vorbei an der Assemblée Nationale, in Richtung Seine.4
Teil I
Mademoiselle Niemand 1950—1954
»Ich möchte nicht erwachsen sein. Voilà.«1
Am 21. Juni 1935, einem Freitag, findet in Paris ein großer Kongress statt. Geladen haben eine Reihe französischer Schriftsteller*innen, darunter André Malraux und Paul Nizan, denen die Ereignisse im Deutschen Reich Sorgen bereiten. Es sind berechtigte Sorgen, denn auf der anderen Seite des Rheins macht sich das NS-Regime daran, die durch den Versailler Friedensvertrag mühsam verhandelte Nachkriegsordnung zu unterhöhlen: Demokratische Wahlen auf regionaler Ebene sind bereits abgeschafft und durch das sogenannte Führerprinzip ersetzt worden, die Deutsche Reichsmarine heißt jetzt »Kriegsmarine«, und auch eine deutsche Luftwaffe gibt es wieder. Der Nationalsozialismus, das zeigt sich immer mehr, ist eine reale Bedrohung. Und so folgen über 250 Künstler*innen aus aller Welt der Einladung ihrer französischen Kolleg*innen, sich zum Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur zusammenzufinden.
Während man sich in Paris über die politische Rolle und Verpflichtung von Kunst und Literatur austauscht, findet 600 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ein Ereignis statt, von dessen literarischer Bedeutung die so leidenschaftlich diskutierenden Schriftsteller*innen, genau wie der Rest der Welt, erst Jahre später erfahren werden. Achtzehn Jahre später, um genau zu sein.
*
An diesem Freitag, den 21. Juni 1935, wird in Cajarc, im Südwesten Frankreichs, eine künftige Schriftstellerin geboren. Ihr Name: Françoise Quoirez. Eigentlich wohnt Familie Quoirez in Paris, in einer großzügig geschnittenen Wohnung auf dem Boulevard Malesherbes am bürgerlich-beschaulichen rechten Ufer der Seine. Doch es ist Familientradition, dass alle Kinder in Marie Quoirez’ Heimat Cajarc geboren werden — so auch die jüngste Tochter Françoise. Cajarc, das ist ein von Felsen eingerahmter mittelalterlicher Ort, der zum Zeitpunkt von Françoises Geburt knapp über 1000 Einwohner*innen zählte. Die nächste Stadt, Cahors, ist 50 Kilometer entfernt, bis zur nächstgrößeren Stadt Toulouse sind es über 100 Kilometer. In den Gassen und Straßen von Cajarc reihen sich pittoreske Häuser aneinander, auch Reste einer Befestigungsanlage aus dem 13. Jahrhundert gehören zum Stadtbild. Hier gehen die Uhren langsamer als in der schnelllebigen französischen Hauptstadt.
*
Die Familie von Marie Quoirez, geborene Laubard, ist nicht reich, aber dank des Besitzes einiger Mühlen und Meiereien in der eher ärmlichen Region rund um Cajarc durchaus wohlhabend. Körperliche Arbeit ist in der Familie allerdings verschrien. Ihr Großvater, so Françoise, habe ein Arbeitsgerät niemals auch nur angefasst.2 Ganz anders die Familie von Pierre Quoirez, kleinbürgerliche Industrielle aus dem nordfranzösischen Béthune, die verschiedene Zechen, Sägewerke und Fabriken besitzt — von denen aber viele während des Ersten Weltkriegs zerstört worden sind. Pierre machte seinen Abschluss am ingenieurswissenschaftlichen Institut industriel du Nord in Lille, wohl mit dem Ziel, eines Tages die Leitung der Familienbetriebe zu übernehmen. Pierre Quoirez und Marie Laubard lernten sich Anfang der 1920er auf einer Hochzeit in Saint-Germain-en-Laye kennen und heirateten 1923 in Cajarc. Ein Jahr später wurde ihre Tochter Suzanne geboren, 1927 folgte Sohn Jacques. Ein weiterer Sohn, Maurice, benannt nach Maries im Krieg gefallenen Bruder, starb kurz nach der Geburt. Für die Eltern muss das ein traumatisches Erlebnis gewesen sein, vor ihren Kindern würden sie Maurice später nie erwähnen. Gemäß großbürgerlicher Tradition und um Marie zu entlasten, wurde 1931 Julia Lafon eingestellt, eine junge Frau Anfang zwanzig. Sie ist Haushaltshilfe und Kindermädchen, eine Bezugsperson vor allem für Françoise, die Jüngste.3
Pierre und Marie Quoirez, jung und charmant, lieben es, auf Partys zu gehen und bei sich zu Hause große Gesellschaften zu geben. Ein altes Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn im Dreiteiler, mit akkurat gestutztem Schnurrbart, das dunkle Haar elegant pomadiert, und sie mit langem Rock, unter einem Hut hervorlächelnd. Pierre Quoirez verdient als Ingenieur der Compagnie générale de l’électricité (C. G. E.) gut, man kann sich ein angenehmes Leben leisten. Glücklicherweise, denn das Ehepaar Quoirez hat einen teuren Geschmack: »Sie hatten beide Spaß am Feiern, Spaß an schnellen Sportwagen. Sie fuhren mit voller Geschwindigkeit auf den Straßen spazieren.«4 Man versagt sich nichts und verbringt die Wochenenden gerne außerhalb von Paris, beispielsweise in Deauville. Die Kinder werden derweil in der Obhut Julia Lafons zurückgelassen, die für sie kocht und sich vor allem um Nesthäkchen Françoise kümmert. Fast täglich gehen sie gemeinsam in einen nahegelegenen Park. Die Eltern Quoirez verlassen sich auf Julia Lafon und genießen die vielen Auszeiten, die sie sich dadurch vom Familienleben nehmen können.5
Ihr Vater ist laut Françoise »einer der witzigsten und originellsten Menschen, die ich getroffen habe«6. Da gibt es zum Beispiel die Anekdote, wie Pierre Quoirez einmal zu spät zum Abendessen kam und beschloss, einen ganz besonderen Auftritt hinzulegen. Schwungvoll stürmte er ins Esszimmer und rief: »Ich komme, im Galopp … im Galopp!« Als er vor sich nur konsternierte und überraschte Gesichter sah, dämmerte ihm, dass er sich wohl in der Etage vertan hatte. Aber ein Pierre Quoirez verzagt nicht. Er trat den Rückzug an und rief dazu: »Ich gehe wieder, im Galopp … im Galopp!«7 In der Familie und im Bekanntenkreis wird Pierre Quoirez dafür geschätzt, nie seine Gelassenheit und Beherrschung zu verlieren. Er ist ein Freigeist, liebt es, zu provozieren, sagt stets seine Meinung und hat vor nichts und niemandem Angst — schon gar nicht vor dem, was andere über ihn denken.8 Aber: So brillant und unterhaltsam Pierre Quoirez auch ist, so verletzend und zynisch kann er sein. Sein Humor verwandelt sich dann blitzschnell in triefenden Sarkasmus, begleitet von ätzenden Bemerkungen, die genau da treffen, wo es am meisten wehtut. Seine Kinder Suzanne und Jacques behandelt Pierre Quoirez oft herablassend, gibt sich autoritär und cholerisch. Seine älteste Tochter hält Pierre Quoirez für nicht besonders intelligent, seinen Sohn für einen Taugenichts — und das lässt er die beiden auch spüren.9 Françoise, sein Nesthäkchen, hingegen überschüttet Pierre Quoirez seit ihrer frühesten Kindheit mit Zuneigung und Aufmerksamkeit. Seine »Kiki« darf ihn sogar, ein einzigartiges Privileg, duzen.10 Sie wird verhätschelt und verwöhnt, mit ihr ist Pierre Quoirez nachsichtig und zärtlich. Kein Wunder, dass er für Françoise stets eine Art Held sein wird.
Marie Quoirez ihrerseits ist »kultiviert und geistesabwesend«11. Oft hat sie den Kopf in den Wolken, wirkt zerstreut und ist mehr mit der Planung einer Abendgesellschaft beschäftigt als mit dem Familienalltag. Eine nur schwer zu fassende Person, mondän, frivol, ein bisschen verrückt — aber meistens fröhlich.12 Für Françoise ist sie »eine charmante Freundin. Sie ist zärtlich, schamhaft und hat einen Sinn für alles Komische.«13 Letzteren teilt sie mit Ehemann Pierre. Trotzdem streiten die beiden oft, was bei den Quoirez jedoch zur ehelichen Harmonie beiträgt: »Sie verstanden sich nicht gut, außer, wenn sie sich stritten. Kurz gesagt, in dem Moment, wo sie ihre Verschiedenheit bewiesen, schätzten sie sich noch mehr.«14
Jedes Jahr verbringt die Familie einen Teil des Sommers bei der Großmutter mütterlicherseits in Cajarc. In Françoises Erinnerungen mischen sich Farben und Gerüche mit Augenblicken und Szenerien: ein sprudelnder Schaumwein, den der Vater auf dem Jahrmarkt gewonnen hat; Versteckspiele in leerstehenden Häusern; die Weinlese im Herbst und der Geschmack des zuckrigen Weinmosts. Im Sommer ist es in Cajarc heiß und trocken, die drückende Hitze entlädt sich regelmäßig in heftigen Gewittern. Diese wilde, unzähmbare Natur beeindruckt Françoise, prägt sie — als Erwachsene wird es sie immer wieder raus aus Paris und hinein ins Freie ziehen, ans Meer, in die Normandie. In Cajarc gibt es Raum zum Atmen, Weite, Leere.15
*
Françoise hat in der Idylle Cajarcs gerade ihren vierten Geburtstag gefeiert, als Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Marie Quoirez hört im Radio die Nachricht und fängt prompt an zu weinen. Françoise, die nicht versteht, warum ihre Mutter so traurig ist, wird von Bruder Jacques aufgeklärt: »Es ist, weil Frankreich bedroht wird.«16 Im ganzen Land bricht Panik aus, auch bei Familie Quoirez. Pierre und Marie lassen die drei Kinder bei der Großmutter in Cajarc, während sie selbst nach Paris fahren, um einige Habseligkeiten zu holen. Der Familienlegende nach handelte es sich bei besagten Habseligkeiten vor allem um die umfangreiche und exklusive Hutsammlung von Mama Marie, die diese keinesfalls zur Kriegsbeute werden lassen wollte.17 Die Hüte erfolgreich in Sicherheit gebracht, kehren Mama und Papa Quoirez aus Paris nach Cajarc zurück. Zusammen mit ihren Kindern lassen sie sich im nahegelegenen Cahors nieder, damit Jacques und Suzanne das dortige Gymnasium besuchen können.18 In Cahors erleben sie, wie Frankreich monatelang im sogenannten Sitzkrieg ausharrt, man spricht von der drôle de guerre, dem seltsamen Krieg. Pierre Quoirez wird an die Maginot-Linie eingezogen: ein aus Bunkern bestehendes Verteidigungssystem entlang der französischen Grenze zu Belgien, Luxemburg, Deutschland und Italien. Die Familie ist verunsichert und voller Sorge. Was wird mit Papa Pierre geschehen? Ist er in Gefahr? Wird er je zurückkehren?
Am 14. Juni 1940 besetzen die deutschen Truppen Paris, welches zu diesem Zeitpunkt bereits von zwei Dritteln der Bewohner*innen verlassen worden ist. Insgesamt befinden sich über acht Millionen Französ*innen auf der Flucht, in überladenen Autos, auf Fahrrädern oder nur mit ein paar Habseligkeiten unterm Arm — für viele ein traumatisches Erlebnis, denn begleitet wird die Flucht von den Kugeln deutscher Kampfflugzeuge, von Tod und Verzweiflung.19 Der Ministerpräsident Paul Reynaud tritt zurück und Marschall Philippe Pétain wird mit der Regierungsbildung beauftragt. Mit dem am 22. Juni unterzeichneten Waffenstillstand fügt sich Frankreich Hitlers Bedingungen, der Norden und Westen des Landes fallen als zone occupée unter deutsche Besatzung. Charles de Gaulle, Brigadegeneral und ehemaliger Schützling Pétains, lehnt den Waffenstillstand ab und setzt nach Großbritannien über. Von dort lanciert er seinen Appell: »Muss alle Hoffnung schwinden? Ist die Niederlage endgültig? Nein! […] Was auch immer geschieht, die Flamme des französischen Widerstands soll nicht mehr erlöschen und wird nicht erlöschen.«20 Innerhalb weniger Wochen ist das politische System der Dritten Französischen Republik in sich zusammengebrochen. Pétain gründet in der freien Zone, in Vichy, den État français, der mit Hitler-Deutschland kollaboriert. Vielen Französ*innen erscheint das als die einzige Lösung: Pétain, ein gefeierter Nationalheld, der sich während des Ersten Weltkriegs um sein Vaterland verdient gemacht hatte, wird schon im besten Interesse Frankreichs handeln.21
Die französische Kapitulation bedeutet, dass Pierre Quoirez nach nur zehn Monaten aus dem Kriegsdienst entlassen und nach Hause geschickt wird. Anders als viele Kinder und Jugendliche erlebt Françoise den Krieg also in Anwesenheit beider Eltern, und Marie Quoirez muss nicht täglich damit rechnen, zur Witwe und alleinerziehenden Mutter gemacht zu werden. Die wiedervereinte Familie Quoirez zieht im Herbst 1940 nach Lyon um. Ihr Vater, so Françoise, habe keine Lust gehabt, im besetzten Paris »den ganzen Tag die Deutschen zu sehen«22. Eine fundierte politische Haltung hat man im Hause Quoirez nicht wirklich. Pierre Quoirez besteht einzig darauf, seine Stimme nicht der kommunistischen Partei zu geben, Marie Quoirez wählt, entsprechend der Familientradition, rechts.23 Die damalige politische Nicht-Haltung der Quoirez entspricht allgemein der des französischen Bürgertums: Man ist mehr oder weniger antisemitisch, ohne jedoch Hitlers Rassenideologie gutzuheißen, unterstützt heute Pétain, morgen de Gaulle — je nachdem, aus welcher politischen Richtung der Wind gerade weht.24 Jacques besucht in Lyon eine Jesuitenschule, Suzanne hat sich für ein Kunststudium entschieden. Françoise, das Nesthäkchen, wird in die Schule Cours de la Tour Pitra geschickt. Lernen tut sie dort nicht viel, was vor allem an den ständigen Bombenwarnungen liegt, die den Unterricht unterbrechen. Wie die anderen Schülerinnen singt Françoise brav Loblieder auf Marschall Pétain, den Retter Frankreichs: »Maréchal, nous voilà, devant toi le saveur de la France.«25 Die Eltern Quoirez haben im nahegelegenen Saint-Marcellin ein Wochenendhaus namens La Fusillère gemietet, wohin die Familie sich immer öfter zurückzieht. Die allgemeine Stimmung ist gedrückt, aber Pierre Quoirez gibt sich Mühe, so etwas wie Heiterkeit in den Alltag zu bringen. Um seiner Familie eine Freude zu machen, besorgt er eines Tages ein Perlhuhn — eine richtige Delikatesse, gerade in kargen Kriegszeiten. Als er mit seiner Beute zurückkehrt, stehen Frau und Kinder aufgereiht vor La Fusillère, bereit, den großen Helden zu empfangen. Mit einer feierlichen Geste öffnet Pierre Quoirez den Kofferraum und verkündet stolz: »Schaut, was ich gefunden habe.« Und das Perlhuhn, die Haxen zusammengebunden, erhebt sich in den Himmel und fliegt davon. Stille. Pierre Quoirez schließt den Kofferraum und geht wortlos ins Haus, Marie und die Kinder folgen ihm: »Wir haben über diese Geschichte zwanzig Jahre lang gelacht.«26
Der Krieg ist für Kinder eine seltsame Zeit. Die Schriftstellerin Flora Groult, Jahrgang 1924, schreibt in dem zusammen mit ihrer älteren Schwester Benoîte Groult »vierhändig« verfassten Kriegstagebuch: »Am liebsten möchte ich nur noch Trübsal blasen. Ich finde es ungerecht, dass der Krieg mir meine Jugend nimmt.«27 Die Kriegsgeneration wächst in dem Bewusstsein auf, dass sich alles ständig ändern kann, das Leben eine Aneinanderreihung von Unwägbarkeiten und Eventualitäten ist. Für Françoise fühlt sich der Krieg jedoch wie nie endende Ferien an. Oder wie ein großes Spiel — allerdings eines mit unklaren Regeln.28 Oft langweilt Françoise sich furchtbar, jeder Tag ist gleich. Suzanne und Jacques sind mit Studium und Schule beschäftigt, Papa Pierre kümmert sich um seine Arbeit, Mama Marie versucht, den täglichen Bedürfnissen ihrer Familie nachzukommen, und veranstaltet in Lyon große Abendgesellschaften. Trotz Langeweile und Unsicherheit hat Françoise großes Glück, den Krieg in Anwesenheit beider Eltern und ohne existenzielle Nöte zu verbringen. Dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, wird sie später immer wieder feststellen, wenn ihre Freundinnen von deren Kindheit erzählen.
*
Einzelne Episoden stechen aus dem grauen Einerlei des Kriegsalltags hervor, Françoise kann sich Jahrzehnte später noch an sie erinnern. So taucht irgendwann, 1940, ein junger Mann bei den Quoirez in La Fusillère auf, der von sich selbst behauptet, ein Résistance-Kämpfer zu sein. Pierre Quoirez ist nicht zu Hause, und als der Mann darum bittet, seinen Lieferwagen abstellen zu dürfen, weil die Deutschen im Anmarsch seien, antwortet Marie Quoirez fröhlich: »Natürlich!« Sie fragt nicht nach, was sich in dem Wagen befindet. Abends, beim Familienessen, fällt ihr wieder ein, dass draußen ein Lieferwagen mit unbekanntem Inhalt steht. Pierre Quoirez, misstrauisch, begibt sich nach draußen und schaut nach. Und siehe da: Der Wagen ist voller Waffen! Pierre Quoirez handelt sofort und fährt den Wagen wutschnaubend in ein abgelegenes Feld. Kurze Zeit später stehen die Deutschen vor der Tür: Drei ihrer Offiziere seien auf offener Straße getötet worden. Sie durchsuchen das Haus, die Garage, alles. Familie Quoirez steht draußen aufgereiht, mit dem Rücken an der Mauer, wie die anderen Einwohner*innen von Saint-Marcellin auch, zitternd vor Angst. Doch die Deutschen finden nichts und ziehen ab. Hat der junge Mann seinen Wagen bei den Quoirez geparkt, um diese verdächtig zu machen? Handelt er im Auftrag der Deutschen? Der Verdacht liegt nahe. Vielleicht ist er aber auch einfach nur leichtsinnig und unbedacht (und damit kein großer Gewinn für die Résistance). So oder so: Es dauert nicht lange, bis der angebliche Résistance-Kämpfer wieder auftaucht und sich seelenruhig nach seinem Lastwagen erkundigt. Statt auf die gutgläubige Marie trifft er diesmal auf einen erbosten Pierre, der ihn ordentlich verprügelt. Françoise kommt sich vor wie in einem Western: »Das sind Erinnerungen, die bleiben, weil Gewalt für Kinder übrigens immer bizarr, extravagant, unanständig ist.«29
Eine andere einprägsame Erinnerung ist die vom Bad im Teich. Seit 1941 wird die Gegend rund um Lyon zunehmend gefährlicher, weil die Stadt zum Zentrum der französischen Widerstandsbewegung in der freien Zone geworden ist.30 Immer öfter greifen die Deutschen an, immer öfter fallen Bomben. Françoise, ihre Mutter und ihre Schwester sind gerade dabei, in einem Teich zu schwimmen, als sich deutsche Flieger nähern und mit dem Bombardement beginnen. Die Frauen kehren sofort zum Ufer zurück und trocknen sich hektisch ab — da feuert ein deutsches Militärflugzeug direkt auf sie: »Wir sind wie die Karnickel gerannt; ich sah das Gras, das in alle Richtungen spritzte. Nun, meiner Mutter fiel nichts Besseres zu rufen ein als: ›Suzanne, ich bitte dich, zieh dich an. Ich bitte dich, zieh dich an. Du wirst auf keinen Fall so herumspazieren!‹«31
Drei Jahre später, drei nahezu endlose Jahre später, ist der Krieg zu Ende. Am 6. Juni 1944 landen die alliierten Truppen in der Normandie, am 25. August wird Paris befreit. De Gaulle, der am selben Tag triumphierend dorthin zurückkehrt, wendet sich vor dem Rathaus in einer kurzen, historischen Rede ans französische Volk:
»Paris! Paris verleumdet! Paris zerbrochen! Paris gefoltert! Aber, Paris befreit! Befreit durch sich selbst, befreit durch sein Volk mit der Unterstützung der Armeen Frankreichs, mit dem Zuspruch und der Hilfe von ganz Frankreich, des kämpfenden Frankreich, des einzigen Frankreich, des wahren Frankreich, des ewigen Frankreich.«32
Es ist der Moment, der den Mythos besiegelt — den Mythos der siegreichen Résistance, den Mythos, Frankreich habe sich aus eigener Kraft von Unterdrückung und Besatzung befreit.33 Françoise erinnert sich lebhaft an das Eintreffen der amerikanischen Truppen in Saint-Marcellin nach Kriegsende: »Blonde Gentlemen, alle gebräunt, sind eines schönen Tages in Panzern bei uns aufgekreuzt. Das Wetter war so was von schön.«34 Große Euphorie überall, die jedoch bald von Szenen des Grauens durchzogen werden soll. Unter die Bilder von glücklichen Französ*innen und blonden Amerikanern mischen sich bald auch andere. Für viele Menschen ist jetzt, nach der Befreiung, die Stunde der Abrechnung gekommen — Abrechnung mit denen, die der Besatzungsmacht Deutschland zu nahe gestanden hatten. Zwischen 3000 und 9000 Personen werden im Namen der épuration, der Säuberung, spontan getötet oder standesgerichtlich verurteilt und dann umgebracht. Der kollektive Zorn richtet sich insbesondere gegen solche Frauen, denen man vorwirft, sexuelle Beziehungen mit deutschen Soldaten gehabt zu haben.35 Die Schauspielerin Arletty, die im kurz vor Kriegsende angelaufenen Filmklassiker Kinder des Olymp eine Hauptrolle spielt, hatte eine Beziehung mit dem deutschen Luftwaffenoffizier Hans-Jürgen Soehring und verbringt zwei Monate als vermeintliche Kollaborateurin im Gefängnis. Was solle sie machen, so Arletty unverblümt: Ihr Herz sei zwar französisch, ihr Hintern aber international.36 Mehrere Jahre lang erhält sie keine neuen Rollenangebote mehr — im Vergleich zu anderen vermeintlichen Kollaborateurinnen eine milde Strafe. Auf der Straße begegnen Françoise und ihre Mutter einer Frau mit abrasierten Haaren, die wie ein Hund herumgeführt wird. Marie Quoirez ist empört: »Wie können Sie das tun? Das ist beschämend. Sie verhalten sich wie die Deutschen.«37 Françoise, deren Weltsicht bisher aus der schlichten Einteilung in böses Deutschland, gutes Frankreich bestanden hatte, erkennt nun, dass die Realität um einiges komplexer ist: »Das war das erste Mal, dass das Gute mir mehrdeutiger erschien, als ich mir jemals vorgestellt hatte.«38 Kurz nach dem offiziellen Kriegsende, 1945 oder 1946, schaut sich Françoise zusammen mit Julia Lafon in Saint-Marcellin einen Film im Kino an: In Old Chicago, mit Frauenschwarm Tyrone Power. Vor dem Film werden die Nachrichten gezeigt, und da sind sie — die Bilder aus den Konzentrationslagern. Françoise sieht das ganze Elend, Leichenteile, die zusammengeschoben werden. Ein Schock. Zu Hause fragt sie ihre Mutter ungläubig, ob das, was sie gerade gesehen hat, wahr sei. Ja.39 Françoise hat Albträume, überall sind die Eindrücke aus den Konzentrationslagern: »Es war Dachau, seine Bulldozer, seine Leichen, all das, was mich jetzt jedesmal nötigt, bei der geringsten antisemitischen Äußerung vom Tisch aufzustehen, gewisse Formen der Konversation und selbst gewisse Zynismen nicht ertragen zu können.«40 Es ist der Augenblick, in dem Françoise sich — so zumindest erzählt sie es rückblickend — schwört: Nie wieder.
*
Familie Quoirez ist den schlimmsten Traumata des Krieges entkommen. Nach dem Krieg kehrt sie zurück nach Paris, in ein trauriges, graues Paris: Die Spuren des Krieges, der deutschen Besatzung, sind allgegenwärtig. Insbesondere Françoise fällt es schwer, sich daran zu gewöhnen, nicht mehr von Wiesen und Feldern umgeben zu sein, sondern von Häuserreihen. Die Stadt kommt ihr verletzt und traurig vor.41 Françoise fehlt die Weite, die Natur — daran ändert auch die große Familienwohnung nichts.42 Doch das Leben, so der Plan, soll nun wieder seinen geregelten Gang gehen. Für Françoise bedeutet das, wieder regelmäßig (und nicht unterbrochen von Bombenalarmen) die Schule zu besuchen, ihre Tage und Wochen nach dem Rhythmus des Stundenplans einzuteilen.
Doch die Schule bringt nicht die erhoffte Ruhe in Françoises Leben. Stattdessen zeigt sich schon bald: Françoise und Schule, das sind zwei Dinge, die einfach nicht zusammenpassen: »Ich war […] schüchtern, stammelnd, von allem eingeschüchtert, wie versteinert und in Furcht und Schrecken angesichts eines Lehrers; was sich später dann in einer völligen Unvereinbarkeit mit der weiterführenden Schule äußern sollte.«43 Später wird aus dieser Schockstarre offene und lustvolle Rebellion. Françoises Eltern, Pierre und Marie Quoirez, treibt das zur Verzweiflung, zumal Françoise keine schlechte Schülerin ist, in ihrem Lieblingsfach Französisch sogar sehr gute Noten hat. Doch sie widersetzt sich mit Leidenschaft den strengen und, in ihren Augen, oft willkürlichen Regeln der Schule. Ihre Mitschülerinnen unterhält sie mit frechen Antworten und kleinen Scherzen, die das Lehrpersonal oft so gar nicht zum Lachen findet. Schon früh beginnt Françoise, ihre Unabhängigkeit wie einen Muskel zu trainieren.44
Anekdoten über Mademoiselle Quoirez’ schulische Kapriolen gibt es reichlich. Als Kulisse dafür dienen die katholischen Privatschulen, auf die Pierre und Marie Quoirez ihre jüngste Tochter schicken — nicht, weil sie besonders religiös sind, sondern weil es zu den großbürgerlichen Gepflogenheiten gehört. Die erste Anekdote stammt von 1949, als Françoise die katholische Privatschule Cours Louise-de-Bettignies besucht, nur wenige Meter von der elterlichen Wohnung entfernt. Françoise, der eigenen Einschätzung nach »ziemlich teuflisch«45, fordert mit ihrem Temperament, ihrer spitzbübischen Art, ihrem belustigt-spöttischen Blick Lehrer*innen sowie geltende Konventionen strenger Regeln und Disziplin heraus.46 Hinzu kommt, dass Françoise schon damals schneller denkt, als sie sprechen kann. Ihre schulischen Probleme resultieren auch daraus, aus diesem »zu schnell«, aus dem ewigen Warten auf alle anderen und dem damit einhergehenden Gefühl der Langeweile. Vielleicht auch daraus, dass Françoise es von zu Hause aus gewohnt ist, von Erwachsenen als gleichwertige Gesprächspartnerin akzeptiert zu werden — in der Schule hingegen ist sie nur ein Kind und wird auch so behandelt.
Wenige Monate vor Beginn der Sommerferien wird die aufsässige 13-Jährige schließlich der Schule verwiesen. Der Grund: Françoise hatte eine Molière-Büste mit einer Kordel um den Hals an einer Tür aufgehängt. Einfach deshalb, weil sie sich in einer Unterrichtsstunde über den Dramatiker ganz besonders gelangweilt hatte. Aus lauter Angst, ihren Eltern den Rausschmiss zu gestehen, tut Françoise für den Rest des Schuljahres, ganze drei Monate lang, so, als sei nichts passiert. Sie steht morgens zur gewohnten Zeit »mit geschäftiger Mine«47 auf und schlüpft in ihre Kleider, nach Maß gefertigt und in den elegantesten Boutiquen gekauft, was Françoise jedoch nicht dazu bringt, sorgfältig mit ihnen umzugehen.48 Dann verlässt sie das Haus, um zur Schule zu gehen. Zumindest denken das ihre Eltern. In Wahrheit streift Françoise durch das frühlingshafte Paris. Sie nimmt den Bus bis zur Place de la Concorde, steigt aus, läuft ein Stück und lässt sich dann an der immer gleichen Stelle zum Lesen nieder. Manchmal bummelt sie durch das belebte Marais-Viertel, bewegt sich als Flaneurin durch die proust’sche »Stadtschaft«.49 Zurück geht es wieder mit dem Bus, die Schultasche artig dabei. Pierre und Marie Quoirez sind verwundert, als sie am Anfang der Sommerferien kein Zeugnis für ihre Tochter erhalten. Die gibt sich unschuldig: Sie wisse auch nicht, woran das läge. »Bist du denn für das nächste Schuljahr zugelassen?«, fragt die Mutter, und Françoise antwortet: »Natürlich.« Sie will ihre Ruhe haben, die Ferien genießen, ohne sich ständig Vorwürfe von ihren Eltern anhören zu müssen. Der richtige Zeitpunkt für das Geständnis wird schon noch kommen. Doch als im September die Schule wieder losgeht, hat Françoise es immer noch nicht geschafft, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen. Wie gewohnt, und von Kopf bis Fuß zitternd, macht sie sich auf den Weg zum Cours Louise-de-Bettignies, wo man angesichts ihres Erscheinens überrascht und irritiert ist: »Was machen Sie hier?« Françoise kehrt nach Hause zurück und erklärt ihrem Vater mit gespieltem Erstaunen, »scheinbar« sei sie nicht zum neuen Schuljahr zugelassen, woraufhin Pierre Quoirez in der Schule anruft und eine Szene macht.50 Françoise triumphiert — schon bald ist die ganze Affäre vergessen. Die Eltern sehen in dem unerfreulichen Vorfall nichts Dramatisches, sondern vielmehr einen Ausdruck von Françoises charmant-aufsässiger Persönlichkeit.51 Man begegnet ihr mit Nachsicht, drückt ein Auge zu. Man konnte ihr noch nie böse sein. Françoises ältere Geschwister, Suzanne und Jacques, wären bei einem ähnlichen Vergehen kaum mit solcher Milde behandelt worden.
Schulbesuch, nächster Versuch. Im Oktober 1949 wird Françoise auf die katholische Schule Couvent des Oiseaux geschickt. Auch hier hält sie es nicht lange aus. Nach drei Monaten fliegt sie, der Grund diesmal: Mangel an »gereifter Geistigkeit«52. Was war passiert? Nun, Françoise hatte beschlossen, in der Schule den Dichter Jacques Prévert auswendig zu zitieren:
»Vater unser, der du bist im Himmel
bleib ruhig dort
Wir bleiben auf der Erde
bisweilen ein so schöner Ort.«53
Solch blasphemisches Verhalten wird am Couvent des Oiseaux selbstverständlich nicht toleriert. Françoise macht ihr erneuter Schulverweis wenig aus, die strenge Einrichtung hatte sie schon seit langem angeödet:
»Wenn ich morgens um sieben zur ersten Messe erschien, jeden Mittwoch, traf ich die Nachtschwärmer, all die Feierwütigen der Rue de Berry und der Rue de Ponthieu, mehr oder weniger schön eingerichtet in den Abfalleimern, mit Champagnerflaschen und im Smoking, sehr Scott Fitzgerald, und ich sagte mir: ›Meine Güte! Sie amüsieren sich sehr viel mehr als ich!‹ Sie lachten laut, sprachen davon, was sie im Laufe des Tages machen würden, von Reitstunden, von was auch immer, und ich, ich musste dem Religionsunterricht folgen, der vier Stunden dauerte! Ich sagte mir: ›Das ist ungerecht.‹«54
Hinzu kommt, dass Françoise zu diesem Zeitpunkt längst ihren katholischen Glauben verloren hat, mit dem sie aufgewachsen ist. Grund dafür war ein Besuch der Pilgerstätte Lourdes, der bei Françoise eine »metaphysische Krise«55 auslöste: Angesichts eines gleichaltrigen Mädchens, schluchzend auf seiner »wie es schien, letzten Lagerstatt«56, verspürte Françoise gegenüber dem angeblich allmächtigen Gott, der dies zuließ, nur noch Abneigung: »[I]ch hatte ihn in großer Empörung und ehrlichem Zorn aus meinem Leben gestrichen […].«57 Gott, stellte Françoise fest, mochte für einige eine Lösung sein — aber nicht für sie. Die Lektüre atheistischer Autoren wie Jean-Paul Sartre, Albert Camus und Prévert bestärkte sie in dieser Überzeugung,58 und so tauschte Françoise Gott gegen eine selbst kreierte hedonistische Lebensphilosophie, die ohne strenge Moral oder Vorschriften auskommt.
*
Am Cours Hattemer, auf den die Eltern Quoirez ihre Tochter als nächstes schicken, herrscht zu Françoises Entzücken »Heiterkeit auf Erden«59: wenig Arbeit und ein charmanter Schulweg, der über die Rue de Londres führt, wo sich Gruppen junger Leute treffen. Doch das Beste an der neuen Schule ist für Françoise die Freundschaft mit Florence Malraux — Tochter des berühmten Romanciers André Malraux und seiner ersten Frau Clara Goldschmidt.
Florence’ Eltern heirateten 1921. Das Paar verkehrte in Pariser Bohème-Kreisen, reiste gemeinsam und hatte literarische Ambitionen: Sie arbeitete als Journalistin und übersetzte 1922 Virginia Woolfs Essay Ein eigenes Zimmer ins Französische, er veröffentlichte ab 1926 Essays und Romane. Als 1933 Florence geboren wurde, war Clara in der Ehe schon länger nicht mehr glücklich. André galt als Genie und gefiel sich in der Rolle, bastelte an seinem Mythos. Clara, die fand, ihr Mann habe ihr viel zu verdanken, weigerte sich, neben ihm eine bloße Statistinnenrolle zu übernehmen. Das Paar trennte sich 1937, die Scheidung erfolgte jedoch erst zehn Jahre später — auch deshalb, weil André Clara, die jüdische Wurzeln hatte, schützen wollte. Florence wuchs fortan bei ihrer Mutter auf, ihr politisch engagierter Vater war meistens abwesend. Florence gewöhnte sich an die Gefühlsausbrüche ihrer Mutter und nahm hin, dass ihr Vater ein außergewöhnlicher Mann war, überlebensgroß.60 Ab 1940 lebten Clara und Florence im französischen Südwesten, in der freien Zone. In Toulouse, Montauban und Marseille war Clara in der Résistance aktiv, ein Milieu, in dem Florence sich wohlfühlte: »Diese Komplizenschaft machte mich stolz: Ich war kein Trottel wie die anderen.«61 Heimlich kehrten Mutter und Tochter nach Paris zurück, wo nun auch Florence eine résistante wurde und falsche Papiere zwischen Montauban und Paris schmuggelte. Kurz vor der Befreiung wurde Claras Widerstands-Netzwerk von der Gestapo aufgedeckt, ihr Lebenspartner Jean erst gefoltert, dann erschossen. Florence hatte panische Angst um ihre Mutter, Angst um sich selbst. Und das zu Recht: Bei einer Zugkontrolle konfiszierte die Gestapo 1944 die — schlecht — gefälschten Dokumente von Clara und Florence. Doch dann das: Nach einem kurzen Austausch zwischen den Gestapo-Beamten gaben diese den beiden Frauen ihre Papiere zurück. Clara übersetzte für Florence, was die Beamten auf Deutsch gesagt hatten: »Wir können nicht alle festnehmen. Und das kleine Mädchen ist zu hübsch.«62 Florence und ihre Mutter Clara überlebten den Krieg. So gerade eben. »Die wichtigste Person in meinem Leben«, sagte Florence später, »ist der Krieg gewesen.«63 Als junge Frau ist es für sie entscheidend, dass dieses Leben wirklich ihres ist. Sie will nicht nur »Tochter von« sein. Und so ist aus dem Kind Florence eine ruhige junge Frau mit sanfter Präsenz geworden. Jemand, der sich zurückhält, nicht gerne im Mittelpunkt steht und zufrieden mit einem Platz in der zweiten Reihe ist.64 Trotzdem ist sie ganz das Kind ihrer Eltern: Von Clara lernte sie, dass es sich lohnt, für seine Überzeugungen und Werte zu kämpfen und Geld und Macht mit einer gesunden Portion Skepsis zu begegnen; von André lernte sie, das Leben von einem ästhetischen Standpunkt aus zu betrachten, sich inspirieren zu lassen. Und von beiden hat sie ihren Wissensdurst, ihre Leidenschaft für Kunst und Literatur.65 Eine Leidenschaft, die sie nun mit Françoise teilt.