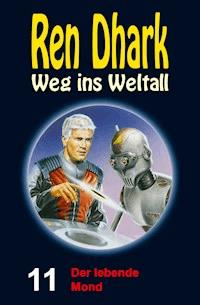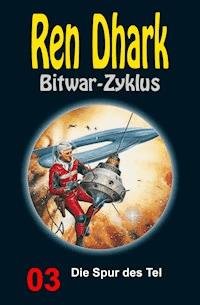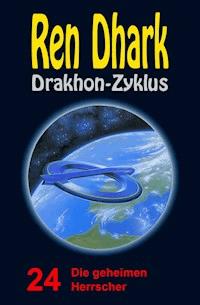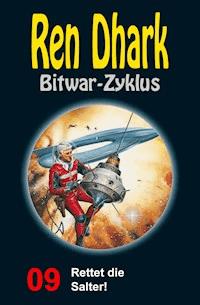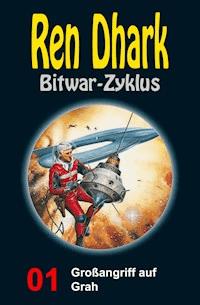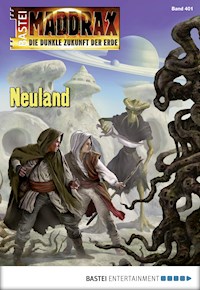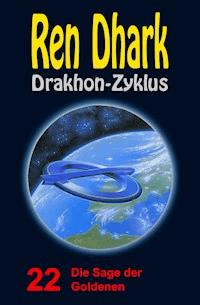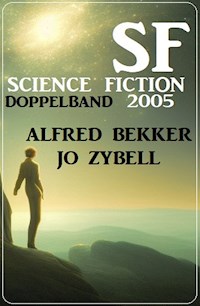
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende SF-Romane: (349XE) Der Tod kommt aus dem All (Jo Zybell) Galaxienwanderer - Die kosmischen Läufer (Alfred Bekker) Das Fernraumschiff CAESAR II/ALGO-DATA steckt fest in einem Fesselfeld von Schwarzen Sonnen. Es gibt keinen Ausweg und auch kein Lebewesen in den zahlreichen Schiffen, die als Wracks hier liegen. Doch dann kommt ein fremdes Volk ohne Schwierigkeiten durch den Schutzschirm des Raumschiffs und erweist sich als äußerst friedfertig. Aber kann man den Rimdenern in trauen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo Zybell, Alfred Bekker
Inhaltsverzeichnis
Science Fiction Doppelband 2005
Copyright
Der Tod kommt aus dem All: Das Zeitalter des Kometen #16
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Galaxienwanderer – Die kosmischen Läufer
Science Fiction Doppelband 2005
Alfred Bekker, Jo Zybell
Dieser Band enthält folgende SF-Romane:
Der Tod kommt aus dem All (Jo Zybell)
Galaxienwanderer - Die kosmischen Läufer (Alfred Bekker)
Das Fernraumschiff CAESAR II/ALGO-DATA steckt fest in einem Fesselfeld von Schwarzen Sonnen. Es gibt keinen Ausweg und auch kein Lebewesen in den zahlreichen Schiffen, die als Wracks hier liegen. Doch dann kommt ein fremdes Volk ohne Schwierigkeiten durch den Schutzschirm des Raumschiffs und erweist sich als äußerst friedfertig. Aber kann man den Rimdenern in trauen?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
Der Tod kommt aus dem All: Das Zeitalter des Kometen #16
Roman von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 395 Taschenbuchseiten.
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Doch wie ist es dazu gekommen? Das beschreibt dieser Roman:
Die Entdeckung des Kometen, der unausweichlich die Erde treffen wird, beeinflusst die Schicksale zahlloser Menschen. Anhand einzelner Persönlichkeiten, die sich auf unterschiedliche Weise auf den Zusammenstoß vorbereiten, zeigt sich die Weltuntergangsstimmung. Tim Lennox verbringt seine letzten Tage in halber Betäubung, bis er abkommandiert wird, Alexander-Jonathan mit Granaten zu beschießen, um den Zusammenprall doch noch zu verhindern.
Prolog
Der Tod – ihr ständiger Begleiter seit Monden. Oder nicht schon seit jenem Tag vor achtzehn Wintern am Strand von Kalskroona? Jetzt stand er ihr gegenüber. In Gestalt zweier Taratzen.
Vier Schritte vor Marrela ragten sie aus dem Schnee, hoch aufgerichtet auf ihren Hinterläufen. Zwei Köpfe größer als sie selbst. Ihre Rückenfelle waren gesträubt, ihre spitzen langen Schnauzen weit aufgerissen, ihre Klauen gierig gespreizt. Sie fauchten böse. Blut klebte an den Krallen der linken Bestie. Radaans Blut. Der Sohn des Häuptlings lag im Eishang, nur eine Speerlänge neben dem Göttervogel.
Mit beiden Händen hielt Marrela ihr Schwert vor den Körper. Die Bestien belauerten jede ihrer Bewegungen. Auch sie ließ sie keinen Atemzug lang aus den Augen. Sie sah die Schnurrhaare zittern.
Aus den Augenwinkeln spähte sie hinüber zu Radaan. Dort steckte der blaue Leib des Göttervogels in der Eisspalte. Ein Göttervogel, der sich nicht bewegte. Genau so wenig wie Radaan. Auch den Kopf des Gottes, der auf dem Vogel geritten war, erkannte sie: eine große glatte Kugel. Sie schimmerte bläulich wie Gletschereis.
Die Taratzen duckten sich wie zum Sprung.
Marrelas Atem flog. Eine Stimme erfüllte ihren Kopf: Fürchte dich nicht! Tausende wird dein Schwert fressen. Wudans Auge hatte es einst prophezeit.
Sie hob die Waffe und brüllte ihren Zorn und ihren Willen zu leben heraus. Die schwarzen Bestien fielen auf ihre Vorderläufe und näherten sich lauernd. Ihre Schwänze peitschten durch den Schnee; weiße Wolken hüllten ihre knotigen Schenkel ein, der Schnee knirschte unter ihren Klauen.
*
Das Ziel.
Wohin sein Lauschen sich auch tastete – es war allgegenwärtig. In all dem Rauschen, Wispern und Raunen, das ihn umgab. In jeder Bilderwoge, die an ihm vorüberglitt. In jeder Gedankenbrandung, die ihn durchperlte. In jedem Empfindungsstrom, den er berührte. Das Ziel. Alle konzentrierten sich darauf.
Auch die kraftlosen Stimmen. Auch die blassen, verschwommenen Bilder. Ja, selbst die zaghaften Empfindungssplitter aus kaum noch wahrnehmbaren Quellen – selbst in ihnen pulsierte noch das Verlangen. Nach dem unbekannten und doch unter allen Umständen zu erreichenden Ziel.
Wie kalter Schwefeldunst streifte ihn das Gedanken-Rinnsal einer fremden Aura. Er glaubte zu frösteln. Geduldig lauschte er. Hoffnungslosigkeit und Angst kümmerten irgendwo zwischen unzähligen Auren vor sich hin.
Er tastete sich durch lautere, kraftvollere Stimmen und Bilder. Bis er die Erschöpfte fühlen konnte: eine schwache, in sich verkrümmte Lebens-Aura. Es war eine Lan aus einer benachbarten symbiotischen Einheit.
(Benenne dich), sendete er.
(Liob‘lan‘taraasis), wisperte es aus der fremden Aura. (Wer berührt mich?)
(Est‘sil‘bowaan. Es ist kalt in deiner Nähe, Liob‘lan‘taraasis.)
(Ich kann nicht mehr – so weit, so viel Zeit …)
(Zeit? Entfernung? Unsinnig. Denk an das Ziel.)
(Wir erreichen es nie!)
(Denk an das Ziel.)
(Dann höre nicht auf, mich zu berühren. Und erzähle mir vom Ziel!)
Erstes Kapitel
Blue Mountain Peak, Jamaika, 25. August 2011
Antares, im Sternbild des Skorpions, leuchtete hoch im Westen. Darunter, fast in der Mitte des südlichen Sternenhimmels, die Riesensterne Alpha und Beta Centauri und darüber das Kreuz des Südens. Im Osten schwebten die Fische am Horizont. Gegenüber im Westen funkelte Spica im Sternbild der Jungfrau. Und hinter Jonathan rief eines der Mädchen: „Wünsch dir was! Schnell, wünsch dir was!“
Archer Jonathans Auge löste sich vom Okular des Teleskops. Über die Schulter blickte er hinter sich: Zwischen den Büschen im hohen Gras standen Marc Alexander und die beiden jungen Frauen. Alle drei blickten sie in den nördlichen Nachthimmel. Die Glutbahnen dreier Meteoriten zogen sich über das Firmament. Sternschnuppen.
Vivian, die Jüngere der beiden Frauen, tänzelte auf und ab wie ein kleines Kind in aufgeregter Erwartung. „Eine Hauptrolle! Eine Hauptrolle in Saxons nächstem Film!“
Jonathan wandte sich von seinem Teleskop ab. Durch das hohe Gras stapfte er zu Alexander und den Frauen hinüber.
„Einen Millionär“, kicherte Sue, „ja, einen Millionär! Am besten Jeremy Saxon!“ Sie boxte dem Mann neben sich ein paar Mal gegen die Schulter. „Schnell! Mach schnell, Marc, sonst gilt es nicht mehr!“
„Schweißfüße!“ In der Linken eine Zigarette, in der Rechten eine Flasche, breitete der kahlköpfige Schotte beide Arme aus und schrie es in den dunklen Wald hinunter: „Ich will endlich meine Schweißfüße loswerden!“
Jonathan trat neben ihn und nahm ihm die Flasche aus der Hand. „Frommer Wunsch“, sagte er trocken. Er setzte die Sektflasche an und nahm einen tiefen Schluck. Am Horizont erloschen die Meteoriten.
Alexander stieß ihm den Ellenbogen in die Rippen. „Wünsch dir auch was, los!“
„Unsterblichkeit.“
„Zu spät!“, krähte Vivian. „Zu spät!“
„Der Wunsch geht nur in Erfüllung, solange man die Sternschnuppe sieht.“ Sue hob die Schultern und mimte Bedauern.
„Schade“, brummte Jonathan mit Grabesstimme. „War wirklich eine einmalige Chance.“ Er leerte die Flasche.
Alexander grinste. „Wird schon noch.“ Er klopfte dem Kleineren auf die Schulter. „Was macht unser beringter Freund?“ Arm in Arm mit der blonden Vivian Reynolds schlenderte er zum Teleskop.
Sue tanzte hinterher. „Wow – ich werd einen Millionär heiraten!“ Sie klatschte in die Hände.
Aufgekratzt waren sie, außer dem stoischen Jonathan – Marc Alexander fast noch mehr als die Frauen. Die Bergtour auf den Zweitausender, der Regenwald, der Sekt, das Picknick unter dem Sternenhimmel. Und natürlich hatte sich Marc Alexander mal wieder verliebt.
Schon vor zwei Tagen, als sie die beiden Amerikanerinnen am Strand von Harbour View kennenlernten, hatte Jonathan gemerkt, wie es zwischen seinem Freund und der quirligen Vivian knisterte. Er kannte Alexander seit dem ersten Physiksemester in Cambridge, seit fast zwanzig Jahren also. Der gnadenlose Amor zielte öfter mal nach Marc Alexanders leicht entflammbarem Herz. Ein bisschen zu oft nach Jonathan Geschmack. Er kniete sich auf die Picknickdecke vor dem Zelt und zog die nächste Sektflasche aus der Kühlbox.
„Im Osten, hoch über den Fischen, kannst du jetzt dein Sternbild bewundern.“ Alexander trat zur Seite und ließ Vivian ans Okular. „Achte auf die fünf eng beieinander stehenden Sterne, die fast ein Trapez bilden …“
„Ich sehe sie“, jubelte Vivian. „Das ist der Wassermann? So klein?“
„Nein. Er ist nur nicht mehr ganz zu sehen. Wenn du von dem linken oberen Eckstern des Trapezes aus noch weiter hinauf gehst, siehst du drei weitere Sterne, die zu ihm gehören – das Wasser, das von Aquarius weg fließt …“
Jonathan schmunzelte in sich hinein, während er den Flaschenhals abdrahtete. Sein alter Freund dozierte mal wieder. Das tat er mit Vorliebe. Alexander wäre gern Hochschulprofessor geworden.
„und wenn du dir nun von dem Trapez aus eine leicht gebogene Linie nach Westen denkst, kommst du über das Sternbild des Schützen zum Skorpion. Mein Sternbild. Siehst du den hellen Stern? Das ist Antares; an ihm hängt der Schwanz des Skorpions …“
„Da ist er!“, unterbrach ihn Vivian. „Ich kann seine Ringe sehen!“
Der Korken knallte aus der Flasche, flog in die Dunkelheit hinter dem Zelt und schlug dort irgendwo raschelnd im Gebüsch ein. „Schon?“ Jonathan schnitt eine skeptische Miene und hielt seine Armbanduhr in den Schein der Petroleumleuchte. „Kurz nach acht. Tatsächlich.“ Gegen halb sieben war nach einem zwölfstündigen Tag in Jamaika die Sonne untergegangen. Kurz nach acht sollte der Ringplanet aufgehen und bis nach halb neun zu beobachten sein. Jonathan stand auf und ging zu den anderen. „Dann habe ich die Flasche ja keinen Augenblick zu früh aufgemacht.“
Vivian ließ ihn ans Teleskop.
Da stand er im Sternbild der Jungfrau, ganz in der Nähe von Spica: Saturn in seiner ganzen Schönheit. Um einmal im Leben die Ringe des Planeten zu betrachten, hatten die beiden Schauspielerinnen ihre zweitägige Drehpause genutzt und sich ihnen angeschlossen.
„Ich will ihn auch sehen!“, flötete Sue. „Lass mich auch mal! Lass mich ans Fernrohr!“ Sie drängte Jonathan vom Teleskop weg und spähte durchs Okular. „Wow!“, krähte sie mit ihrer hohen Piepsstimme. „Zum ersten Mal sehe ich die Ringe des Saturns!“
Jonathan grinste müde. Er fand die Gesellschaft des ständig kichernden Mädchens mit den schwarzen Afrolocken nicht besonders entspannend. Die beiden Frauen waren ganz aus dem Häuschen. Alle paar Sekunden wechselten sie sich am Okular ab, und jede erzählte der anderen, was die doch kurz zuvor mit eigenen Augen selbst gesehen hatte.
Alexander nahm Jonathan die Flasche ab. „Auf unsere beiden Entdeckerinnen!“ Er grinste und zwinkerte dem Freund zu. Dann trank er und reichte Jonathan die Flasche.
„Auf die letzte Stunde deiner Schweißfüße“, sagte Jonathan trocken. Geduldig warteten sie, bis die beiden Frauen ihre Neugier gestillt haben würden. Das dauerte.
Natürlich hatten die beiden Schotten den Ringplaneten schon unzählige Male beobachtet. Abgesehen von der großen Magellanschen Wolke, dem Andromedanebel und dem Kugelsternhaufen M 13 vielleicht noch gab es für Jonathan kaum ein schöneres Himmelsobjekt als den Saturn. Nie würde er den Tag vergessen, an dem er als Dreizehnjähriger in der Abenddämmerung eines Augusttages im schottischen Hochland einen Schäfer traf, der gerade sein Drei-Zoll-Teleskop aufbaute.
Jonathan war mit seinem Vater unterwegs gewesen damals, vor ziemlich genau fünfundzwanzig Jahren. Der Schäfer gestattete ihnen, ihr Zelt auf der Weide aufzuschlagen, und als es dunkel wurde und das Sternenglitzern über ihnen zunahm, teilte Jonathans Vater seinen Whisky mit dem Eremiten. Und der Mann begann von dem zu sprechen, was er neben seinen Schafen und seiner Einsamkeit wohl am meisten schätzte und ebenso gut kannte wie diese: von den Sternen.
Er wusste über jedes Sternbild Bescheid, kannte jeden Planetenmond, nannte unzählige Fixsterne beim Namen. Er sprach von Astronomischen Einheiten, von Helligkeitswerten, von Ekliptik, von Spektralbereichen und Galaxientypen wie andere von Biersorten oder ihren Krankheiten.
Nie würde Archer Jonathan die verblüffte Miene seines Vaters – Mathematik- und Physiklehrer wie er selbst heute – vergessen, während er dem einfachen Mann zuhörte. In dieser Nacht hatte Jonathan nicht nur seinen ersten Whisky getrunken, sondern auch zum ersten Mal den Planeten gesehen, von dem er bis zu diesem Zeitpunkt nur in Büchern gelesen hatte, den Saturn. Nicht ganz ein Jahr später, zu seinem vierzehnten Geburtstag, schenkte sein Vater ihm ein Teleskop.
Als er dann in Cambridge dem zwei Jahre älteren Marc Alexander begegnete, waren es keineswegs die gemeinsamen Studienfächer – Mathematik und Physik – die sie verbanden. Es war die Leidenschaft für die Astronomie. Keine schlechte Basis für eine inzwischen fast zwanzig Jahre alte Freundschaft.
Selbstverständlich gab es noch ein paar andere Dinge, die sie verbanden. Anders als Jonathan, der kopflastige Stoiker, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen konnte, war Alexander ein schnell zu begeisternder Romantiker gewesen. Er glaubte an von intelligenten Wesen bevölkerte Planeten da draußen in den Tiefen des Kosmos. Als Junge träumte er davon, dass eines schönen Tages Vertreter solcher Intelligenzen in seinem Vorgarten landen würden, um ihn zu einem Trip durch das Weltall einzuladen. Weg von dieser langweiligen Welt.
Die Zeit bis zur Erfüllung dieses Kindheitstraums vertrieb er sich mit Pferdewetten, der Gesundheit abträglichen Sauftouren und heftigen Romanzen. Durchschnittlich einmal im Monat verliebte er sich in eine andere Kommilitonin. Mit fast allen denkbaren Folgen. Ohne Jonathan hätte er seine Examina vermutlich nie auf die Reihe bekommen. Gewissermaßen im Gegenzug unterstützte er seinen Freund bei der Entdeckung, dass die Welt neben Zahlen und Naturgesetzen noch ein paar andere Gewissheiten zu bieten hatte.
Dinge wie Sue Bertrams Hintern etwa. Den streckte sie ihm entgegen und schwenkte ihn hin und her, während sie sich an seinem neuem Meade-Teleskop festhielt und ihrer Freundin mit atemloser Stimme den Anblick des Saturns schilderte. Ein kleiner straffer Hintern, wie ein umgedrehtes Herz. Ein göttlicher Hintern.
„Er hat einen Pickel“, sagte seine Besitzerin.
„Du spinnst ja!“ Vivian drängte die Andere vom Teleskop weg und drückte ihr Auge ans Okular. „Tatsächlich – eine Ausbeulung. Sieht aus wie ein Nebel … Vielleicht ein Vulkanausbruch?“
„Gibt‘s nicht.“ Marc Alexander zog Vivian vom Teleskop weg. „Nicht auf dem Saturn. Lass mich mal.“ Er drückte einen Knopf auf der linken Schaltkonsole des Zwölf-Zoll-Teleskops. Langsam schob sich das Gerät nach oben, bis das Okular sich auf Alexanders Augenhöhe befand. Er spähte hindurch.
Merkwürdig still wurde es. Nur von unten, aus dem Bergwald, hörte man einen Vogel rufen. Und der Nachführungsmotor des Teleskops summte leise vor sich hin. „Das gehört nicht zum Saturn“, brach Alexander das Schweigen. „Der Reflex eines hellen Sterns, den er verdeckt, schätze ich.“ Er wandte sich zu Jonathan um. „Oder ein Sternennebel – schau‘s dir mal an, Archie.“
Archer Jonathan senkte das Stativ ab und stellte sich an seinen neuen Starfinder LXD 900. Es war, als würde er einen anderen Raum betreten. Einen Raum, in dem ihn Stille, Leichtigkeit und millionenfaches Sternenfunkeln empfingen. Ein Raum, der ihm vertrauter – und vertrauenswürdiger – war, als die Welt, in der er lebte. Ein Raum, aus dem ihn die Bedeutungslosigkeit menschlicher Existenz anwehte.
Im Zentrum dieses Raumes hing der Ringplanet – zum Greifen nah und doch unerreichbar in seinem kalten unwirklichen Licht, mit seinen über jeden Zweifel erhabenen Konturen und seinen tausendfachen Ringen, von denen nur die beiden größten Massefelder sichtbar waren: Saturn. Ein warmer Schauer perlte über Jonathan Nacken und Schultern, breitete sich in seiner Brust aus, und sank hinunter bis in seine Eingeweide. Einer der seltenen Augenblicke, in denen er so etwas wie Freude erlebte.
Was Sue als „Pickel“ und Vivian als „Ausbeulung“ bezeichnet hatten, war ein verwaschener, annähernd halbkugelförmiger Schimmer auf der rechten Seite Saturns, ein Stück oberhalb des Äquators, nicht einmal einen Finger breit. Die Basis dieses undeutlichen Schimmers verschwamm mit der viel helleren Planetenscheibe, sein Außenbereich aber hob sich relativ gut sichtbar von dem schwarzen Weltraumausschnitt zwischen den Planeten und seinen breiten Ringflächen ab.
Jonathan routiniertes Astronomenauge sah sofort, dass der Lichtschimmer von einem anderen Himmelsobjekt stammen musste. „Ein heller Fixstern?“, murmelte er, ohne das Auge vom Okular zu nehmen. „Ein Komet? Oder ein galaktischer Nebel? Frag den MAGELLAN, ob irgendetwas in der Art die Saturnbahn heute Nacht kreuzen soll.“
Marc Alexander trat neben Jonathan ans Teleskop, knipste die kleine LED-Leuchte neben einem schwarzen Kästchen auf dem Teleskoprohr an und tippte ein paar Zahlen in dessen Tastatur ein. Das kleine an der Außenhülle befestigte Kästchen war ein Astro-Computer, ein MAGELLAN V. Über ein Spiralkabel stand er in Verbindung mit der Elektronik des Teleskops.
Alexander beobachtete die Kolonnen aus Zahlen, Buchstaben und Namen, die langsam durch das Leuchtdisplay des Astro-Computers glitten – Chiffren für Fixsterne, Galaxien und Sternbilder. „Nichts“, sagte er dann, „kein heller Stern, keine Galaxie und kein aktueller Komet.“
„Auch nicht Wirtanen?“ Der 1948 entdeckte Komet Wirtanen würde in der kommenden Woche nach knapp sechs Jahren wieder einmal seinen sonnennächsten Punkt erreichen.
„Ist erst in acht oder neun Stunden im nördlichen Sternenhimmel zu beobachten“, sagte Alexander. „Aber nicht in diesen Breitengraden.“
„Ist es nun ein Vulkanausbruch oder nicht?“ Vivian lehnte sich gegen den kahlköpfigen Schotten und umfasste seine Hüfte.
„So was gibt‘s auf der Venus, auf dem Merkur, auf der Erde und auf einigen Monden – aber nicht auf dem Saturn …“ Alexander setzte zu einem weiteren Vortrag an.
Etwa eine Viertelstunde lang beobachtete Jonathan derweil den verwaschenen Lichtfleck zwischen Saturn und seiner inneren Ringscheibe, schweigend und ohne nennenswerte Bewegung. Dann erst löste sich sein Gesicht vom Okular. Er nahm Sue die nur noch halbvolle Sektflasche ab.
„Sieh durch, Marc“, wandte er sich an den Kahlkopf in Vivians Arm, „und sag mir, ob du siehst, was ich sehe.“ Seine Stimme klang heiser; er setzte die Flasche an die Lippen.
Alexander nahm seinen Platz vor dem Teleskop ein. „Unglaublich!“, rief er augenblicklich. „Das Ding hat sich bewegt!“ Alexander umfasste das Teleskoprohr mit beiden Händen und presste sein Auge regelrecht gegen das Okular. „Es war viel kleiner vorhin! Ich schwör‘s euch – es hat sich bewegt!“
„Du meinst“, Jonathan setzte eine skeptische Miene auf, „doch ein Komet?“
Im Minutentakt wechselten sie sich vor dem Teleskop ab. Auch die Amerikanerinnen wurden von ihrem Jagdfieber angesteckt. Der verschwommene Lichtfleck löste sich von der Außenkante der Saturnscheibe und stand nun im Raum zwischen Planetenkugel und Innenring.
„Die Koma!“ Alexander war vollkommen aus dem Häuschen. „Sogar Konturen des Schweifs kann man erkennen! Sieh‘s dir an, sieh‘s dir an!“
Jonathan wurde immer schweigsamer. Wie in Trance schaltete er die integrierte Astro-Kamera seines Starfinder ein. Die Elektronik des Teleskops lichtete das Hunderte von Millionen Kilometer entfernte kosmische Ereignis ab. Gegen halb neun verschmolz der Lichtfleck mit der Innenscheibe des Saturns.
„Ein neuer Komet!“ Marc Alexander packte Jonathan roten Lockenkopf küsste das stoppelbärtige Gesicht seines Freundes. „Wir haben einen neuen Kometen entdeckt!“
„Ich glaub‘s nicht“, flüsterte Jonathan.
„Dann lass es bleiben! Wir müssen die IAU benachrichtigen!“ Alexander lief zum Zelt. Die beiden Frauen schienen für ihn nicht mehr zu existieren. Nicht einmal die blonde Vivian.
„Wir kommen zu spät.“ Archer Jonathan blickte durch das Teleskop. Saturn und das Sternbild der Jungfrau neigten sich gegen den westlichen Horizont. Keine Spur mehr von dem seltsamen Lichtfleck. „Ich komm doch immer zu spät.“
„Blödsinn!“, schrie Alexander aus dem Inneren des Zeltes. „Du wirst unsterblich, Junge! Unsterblich wirst du!“
Die International Astronomical Union – IAU – saß in Cambridge. Nicht Cambridge, Großbritannien, sondern Cambridge, Massachusetts, USA. Ihr Central Bureau for Astronomical Telegrams am Smithsonian war die offizielle Registrierungsstelle für neu entdeckte Himmelskörper.
Alexander schob sich aus dem Zelt, in der Hand sein Mobiltelefon. Er warf sich auf die Picknickdecke und hielt das Gerät in den Schein der Petroleumlampe. „Die Werte, du verdammter Pessimist! Los, die Werte!“ Hektisch stach er auf die Tastatur seines Telefons ein und wählte seinen Laptop im Hotelzimmer in Harbour View an. „Wir haben einen neuen Kometen entdeckt, wir dämlichen Glückspilze, wir …“
Mit monotoner Stimme, als würde er der Polizei, die ihn bei einer Geschwindigkeitsübertretung erwischt hatte, Name und Adresse gestehen, spulte Jonathan die Werte herunter: Datum, Uhrzeit, Entdeckungsort, astronomische Koordinaten, Bewegungsrichtung des Himmelskörpers, geschätzte Helligkeit und so weiter – alles eben, was eine Standardmeldung an das Central Bureau for Astronomical Telegrams enthalten musste.
„Raus mit dir! Raus!“ Alexander schickte die Email ab. Danach knallte er das Handy neben die Lampe auf die Decke und sprang auf. Nacheinander umarmte er Vivian, Sue und Jonathan. „Wir haben einen neuen Kometen entdeckt!“, rief er dabei ständig. „Ab sofort sind unsere Namen unsterblich.“
„Ich glaub‘s erst, wenn wir morgen einen Anruf aus Cambridge bekommen“, murmelte Jonathan.
*
Kopenhagen – Malmö, 26. August 2000
Zuerst fiel ihm nur der Wagen auf. Ein Volvo C 70 Coupé von mattem Metallic-rot. Er hielt auf der anderen Seite der Zapfsäule, an der Timothy Lennox seinen schwarzen Chrysler betankte. Dann stieg die Frau aus.
Tim konnte sie zunächst nicht sehen, weil die Zapfsäule die Fahrertür ihres Volvos verdeckte. Aber er sah die Köpfe der vier oder fünf Männer herumfliegen, die vor geöffneten Tankklappen an den Hecks ihrer Limousinen standen und die Zapfhähne festhielten.
Eine Wagentür fiel zu, ein langbeiniges blondes Wesen erschien zwischen den Zapfsäulen – braungebranntes, sommersprossiges Gesicht, die Augenpartie von einer Sonnenbrille verdeckt, schulterfreies weißes Kleid, eng geschnitten und kurz. Ein dicker blonder Zopf pendelte zwischen ihren Schulterblättern hin und her, während sie mit routiniertem Hüftschwung den Tankstelleneingang ansteuerte.
Es war nicht das Spiel ihrer Schulterblätter, das Tim faszinierte, nicht einmal der Tanz ihrer Gesäßmuskeln unter dem straffen weißen Stoff. Es war die Selbstverständlichkeit, mit der sie den Schönling ignorierte, der ihr die Tür zur Tankstelle weit aufhielt. Wie eine Königin, dachte Tim.
Ein Klicken – die Arretierung des Zapfhahns löste sich, das Gesumme aus der Zapfsäule verstummte. Tim sah eine andere Frau, während er den Zapfhahn einhängte und seinen Tank zuschraubte. Keine der Frauen, die hier an der letzten dänischen Tankstelle vor dem Øresund aus einem Fahrzeug stiegen oder den Tankstellenshop verließen. Eine Frau vor seinem inneren Auge. Fast stündlich tauchte sie dort auf, seit Wochen. Eine zierliche Frau mit kurzen schwarzen Haaren, einem auffallend großen Mund und braunen Rehaugen. Liz. Seine Frau.
Seit Wochen spielte sie die Hauptrolle in zahllosen Szenen, die ihm durch den Kopf zogen wie ein Film. Ein ständig sich wiederholender Film. Szenen aus ihrer fast zwölfjährigen Ehe … Keineswegs nur schöne Szenen. Vergeblich versuchte Timothy Lennox diese Szenen zu löschen.
Ein heranrollender Toyota hupte und musste bremsen, als Tim die Tankbucht durchquerte. Der große blonde Mann schreckte aus seinen Gedanken hoch; Liz‘ Bild verschwand von seinem inneren Auge. Der Mann hinter dem Steuer des Toyotas zog ein vorwurfsvolles Gesicht. Wie ein Blinder war Tim ihm vor den Kühlergrill getappt. „Sorry“, murmelte er und hob die Rechte zu einer Geste der Entschuldigung.
Ähnliches passierte ihm öfter in letzter Zeit: Er verlegte Schlüssel oder Brieftasche, stand vor dem Küchenschrank und wusste nicht mehr, was er herausholen wollte, sah rote Ampeln erst im letzten Moment. Die Bilder in seinem Kopf zapften seine Kraftreserven an, schoben sich zwischen ihn und die Wirklichkeit, lenkten seinen Blick von der Gegenwart weg in die Vergangenheit. Ein einziger großer Schmerz waren sie, die Bilder von Liz in seinem Kopf.
Nur in der Luft konnte er vergessen. Sobald er in der Maschine saß und die Cockpit-Kuppel sich auf ihn herabsenkte, war sein Kopf frei. Aber kein Luftwaffenoffizier konnte den ganzen Tag fliegen.
Sie stand vor dem Zeitschriftenregal und blätterte in einem Magazin, als Tim den Tankshop betrat. Die Sonnenbrille hatte sie sich nach oben über die Stirn ins Haar geschoben. Er sah ihr Profil. Ein großer Mund mit vollen Lippen – wie Liz, dachte Tim – eine leicht vorgewölbte Stirn und eine kleine Stupsnase. Liz‘ Nase ist gerader, dachte Tim, und größer ist sie auch. Vielleicht ist es die scharf geschnittene Nase, die ihr Gesicht manchmal so streng erscheinen lässt. Er zog eine New York Times aus dem Regal, angelte sich zwei Dosen Jever aus dem Getränkeschrank, und stellte sich ans Ende der Warteschlange vor der rechten Kasse.
Aus dem pyramidenartigen Aufbau des Süßigkeitenregals ragte eine Spiegelsäule. Ein kantiges Männergesicht blickte Tim entgegen – rechteckig, schmale blaugrüne Augen, ausgeprägte Wangenknochen, energischer, schmallippiger Mund. Sein eigenes Gesicht. Zwei Urlaubswochen hatten es bräunen, aber nicht den bitteren Zug um Mund und Augen vertreiben können. Er zog die Brieftasche aus der Lederweste und kramte eine Kreditkarte heraus.
Natürlich hatten sie auf dem Luftwaffenstützpunkt schnell gemerkt, was mit ihm los war. Jedenfalls die, die ihn gut genug kannten. Hank Daniels zum Beispiel, einer der Navigatoren seines Geschwaders. Jenny Petersen wusste sogar, dass es seit Langem in seiner Ehe kriselte. Die kleine Kanadierin im Rang eines Lieutenants hatte einen scharfen Blick für alles Menschliche.
Der Captain seiner Staffel war es schließlich gewesen, der sich ein Herz fasste und ihn ansprach: Irvin Righter, ein hünenhafter Afroamerikaner, den alle nur „Big Boy“ riefen.
„Wo drückt der Schuh, Commander?“, hatte er Tim eines Tages in den Umkleideräumen gefragt. „Will ja nicht indiskret sein, aber wir vermissen dich im Zwiebelfisch, und dein Lachen vermissen wir auch.“ „Zwiebelfisch“ – so hieß ihre Stammkneipe in Berlin-Köpenick.
„Liz denkt daran, sich scheiden zu lassen.“ Tim neigte noch nie dazu, viele Worte zu machen.
„Shit!“ Big Boy zog eine betretene Miene. „Jenny erzählte so was – tut verdammt weh, was?“
„Davon geht die Welt nicht unter.“ Genau das hatte Tim seinem Kameraden geantwortet. Hin und wieder hörte er seine eigene Stimme im Traum diesen Satz wiederholen: Davon geht die Welt nicht unter …
„Manchmal schon“, sagte Big Boy.
Drei Tage später fand er Post von Liz im Briefkasten, zwölf eng beschriebene Seiten, aber Tims Augen mussten immer zu dem einen kleinen Satz zurückkehren: „Ich will die Scheidung.“ Und noch einmal drei Tage später hatte der Geschwaderkommandant ihn in sein Büro bestellt und ihm vier Wochen Urlaub verordnet. „Fliegen Sie nach Kalifornien und blasen Sie Ihrer Frau den Marsch, Lennox. Und in vier Wochen will ich die Falte zwischen Ihren Brauen nicht mehr sehen.“ Major Bellmann gehörte zu den Leuten, die eine Gebrauchsanweisung kannten, nach der man sein Leben managen konnte.
Timothy Lennox zahlte, klemmte Zeitung und Bierdosen unter den Arm und wandte sich zum Gehen. An der anderen Kasse stand die Frau. Ihre Blicke begegneten sich kurz. Sie hatte hellblaue Augen, und Tim sah, dass sie schön war. Doch ihre Schönheit berührte ihn kaum. Nicht einmal als sie ihn anlächelte, regte sich etwas in seinem Bauch.
Zurück am Wagen warf er Zeitung und Dosen auf den Beifahrersitz. Dorthin, wo eigentlich Liz sitzen sollte. Seit Jahresbeginn hatten sie den gemeinsamen Europatrip geplant. Für den Herbst. Ein letzter Versuch, ihre Ehe zu retten.
Tim hatte den Chrysler PT Cruiser im Frühjahr angeschafft, extra für die geplante Reise. Einen Diesel, Baujahr 2002. Von vorn sah er mit seiner stumpfen Schnauze und seinem nostalgischen Kühlergrill wie ein Auto aus den Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts aus. Von hinten mit seiner steilen Heckklappe wie ein Van.
Nun steuerte Tim den Wagen allein durch die nordeuropäischen Metropolen. Nicht direkt ziellos, aber doch wie einer, der auf der Flucht war. Oder einer, der etwas suchte, das zu finden er längst nicht mehr hoffte.
Den Flug nach Kalifornien hatte er storniert. Liz war untergetaucht. „Fotosafari irgendwo in Mittelamerika“, hatte ihre Mutter ihn wissen lassen. Liz arbeitete für das California Museum of Photography. Wo genau sie sich aufhielt, wollte ihre Mutter um keinen Preis verraten.
Als er den Gurt ins Schloss drückte, streifte Tims Blick die Titelseite der New York Times. Schlagzeilen sprangen ihm ins Auge: „Rote Armee fliegt neue Luftangriffe gegen usbekische Rebellen“, „Koalitionskrise in Israel“, „Schottische Hobbyastronomen entdecken bislang unbekannten Kometen“ Nichts davon blieb in Tims Hirn haften.
Später, auf der Autobahn zwischen Stadtrand und Flughafen, blendete ein Wagen hinter ihm auf. Im Rückspiegel war das metallic-rote Volvo-Coupé. Der Wagen zog an ihm vorbei und hupte. Für Augenblicke sah Tim den Blondschopf und das Stupsnasenprofil der Frau. Höflichkeitshalber blendete Tim ebenfalls auf.
Kurz darauf erreichte er die Tunneleinfahrt der Sundpassage. Fünfunddreißig Euro zahlte man seit Neuestem für die Benutzung von Øresund-Tunnel und -Brücke. Durch das offene Wagenfenster schob er die Karte, die er am Vortag in Kopenhagen gekauft hatte, in den Automaten. Die Schranke öffnete sich, und Tim fuhr in die Tunnelröhre hinein.
Beklemmung überfiel ihn auf dem Gefälle zur Tunnelsohle – die Enge, das künstliche Licht – er wünschte sich, die vier Kilometer lägen schon hinter ihm. Anders als sonst bei Tunneldurchquerungen, und obwohl er ganz andere Belastungen gewöhnt war. Wie ein Abbild des eigenen Lebens wollte ihm die Fahrt durch den Tunnel erscheinen. Hoffnungslosigkeit legte sich bleiern auf sein Gemüt. Alles erinnert mich an dich, Liz, dachte er. Die Welt ist voller Zeichen, und sie sagen: Du hast keine Chance mehr.
Die trübe Stimmung fiel auch dann nicht von ihm ab, als er den Tunnel auf der schwedischen Seite verließ und die Vormittagssonne gegen die Windschutzscheibe prallte. Weitere vier Kilometer lang führte die Autobahn über eine künstliche Insel. Danach ging es über eine Steigung hinauf auf die Øresund-Brücke.
Fast acht Kilometer weit fuhr Tim zwischen Stahlbetonträgern hindurch und an Stahlseilen vorbei über den Øresund. Blauer Sommerhimmel wölbte sich über der Meerenge, Fischkutter, Frachter und Segelboote pflügten links und rechts der Brücke durch die See, und das Sonnenlicht lag glitzernd auf den Wogen. Tim nahm es kaum wahr. Das Gesicht seiner Frau füllte sein Hirn.
Dann Malmö, das Tor nach Südschweden. Auf dem Weg in die Innenstadt fuhr Tim durch den neuen Stadtteil „Scanstad“, den die Schweden in den letzten zehn Jahren aus dem Boden gestampft hatten. Die Euphorie über die damals noch als architektonisches Wunderwerk geltende Brücke hatte dabei Pate gestanden. Gewaltige Gebäudekomplexe und Wolkenkratzer zogen an Tim vorbei, eine Skyline, die es mit der amerikanischer Großstädte aufnehmen konnte. Und dazwischen ein Heer von Baukränen. Wie Skelette von Dinosauriern ragten sie aus dem Steingebirge.
Die Stadtautobahn tangierte eine Großbaustelle. Hubschrauber kreisten über ihr. Unzählige Kräne ragten auf einer Fläche von gut zehn Fußballstadien in den Himmel. Der Verkehr kam ins Stocken; Tim ging vom Gas.
Der Anblick des gigantischen Neubaukomplexes, der dort links der Autobahn entstand, wischte die trübsinnigen Bilder und Gedanken aus seinem Hirn. Der Neubau bestand aus sieben ringförmigen Gebäuden, die wie konzentrische Kreise ineinander lagen. Einem Schutzwall gleich erhob sich das äußere Ringgebäude über die inneren sechs, und zur Mitte des Kreises hin nahm die Höhe jedes Gebäudes ab, sodass der ganze Komplex den Eindruck einer antiken Arena machte. Glas- und Rundbögen dominierten, auch bei dem Turm, der sich im Mittelpunkt des Kreises erhob. Kräne flankierten ihn. Er war schon gut achtzig Meter hoch und noch immer nicht fertig, wie es aussah.
Ein Messezentrum, mit dem die Schweden Wirtschaftskraft demonstrieren und in dem sie die Weltausstellung im Jahr 2013 ausrichten wollten. Das architektonische Konzept war eine moderne Mega-Variation des Hallenkomplexes der Pariser Weltausstellung vor 144 Jahren. All das wusste Tim aus seinem Skandinavien-Reiseführer.
Das Hotel, das er am Tag zuvor von Kopenhagen aus gebucht hatte, lag in der City von Malmö, hinter dem Stortorget, dem zentralen Rathausplatz in der Innenstadt. Ein bitteres Grinsen flog über die Miene des blonden Amerikaners, als er über dem Eingang an der mittelalterlichen Fassade des Hauses den Hotelnamen las: „Tunneln“. Passt zu deinem Gemütszustand, dachte er und betrat das alte Gebäude.
Schon im Foyer hatte er den Eindruck, sich in ein Museum verirrt zu haben: schwere barocke Schränke, Kommoden und Sitzgruppen, finsterstes Eichenholz, an den Wänden Schwerter, Ritterrüstungen und Hellebarden zwischen fast lebensgroßen Portraits von Königen, Feldherren und Prinzessinnen.
Der gleiche Eindruck dann oben im Zimmer selbst: gedrechselte Bettpfosten, Sessel- und Tischbeine, ein wuchtiger Eichenschrank, ein hoher Sekretär mit zigtausend Schubkästchen, zwei Portraits und einige Kupferstiche jahrhundertealter Stadtansichten auf der Stofftapete.
„Als hätte man sich in eine andere Zeit verirrt.“ Tim warf seine Ledertasche auf die dunkelblaue, gelb bestickte Tagesdecke des Bettes, knallte Bierdosen und Zeitung auf ein rundes Barocktischchen und ließ sich in den schweren Sessel fallen. „Das wär‘s doch: Ich bin in der Vergangenheit gelandet, siebzehntes Jahrhundert, und die Gegenwart gilt nicht mehr.“
Er legte die Beine auf das Tischchen und knackte die erste Bierdose. Während er trank, betrachtete er eines der beiden Portraits an der Wand auf der anderen Seite des Zimmers. Ein Ölgemälde mit dem Konterfei Gustav Adolfs, des Schwedenkönigs.
„Sie müssen schon entschuldigen, Sir.“ Timothy Lennox grinste das Aristokratengesicht im goldfarbenen Barockrahmen an. „Ich bin Jahrgang neunzehn-achtzig, mach‘s mir gern bequem und trinke das Bier aus Blechdosen. Hätten Sie eventuell einen Job für mich?“ Er prostete dem Portrait zu und nahm einen tiefen Schluck. „Ich bin bei der Army, falls Ihnen das was sagt.“
Tim sprach so laut, als würde ihm ein Gesprächspartner gegenüber sitzen. Der Gedanke, es könnte ihn jemand belauschen und für verrückt halten, machte ihm nichts aus. „West-Point-Absolvent zweitausend-vier – sagt Ihnen vermutlich auch nichts, ist aber eine Menge wert bei uns drüben in der Neuen Welt. Neue Welt sagt Ihnen doch sicher was, Sir?“ Wieder goss er sich einen Schluck Jever in die Kehle. Das Bier hätte kühler sein dürfen. „Ist auch nicht mehr die Jüngste inzwischen, die Neue Welt.“
Das Gesicht im Barockrahmen schien ihn verwundert zu mustern.
„Flugzeuge gibt‘s ja nicht bei Ihnen, wenn ich meinen Geschichtslehrer richtig verstanden habe. Aber Sie kommandieren eine stolze Flotte, wie man hört. Ich verstehe was von Navigation – glauben Sie‘s mir. Könnte Ihnen eventuell den einen oder anderen Trick zeigen. Wie wär‘s mit einem Kommando für mich? Kann ruhig ein Kriegsschiff sein. Strategie war mein Lieblingsfach auf der Militärakademie. Habe sogar Kampferfahrung. Wir hatten vor ein paar Jahren auch mal so eine Art Religionskrieg. Ihr schlagt euch zurzeit doch mit den deutschen Katholiken herum, oder? Bei uns waren es radikale Moslems. Ist erst ein paar Jahre her … Also Sir, überlegen Sie es sich.“
Tim nahm einen weiteren Schluck, wischte sich mit dem Handrücken den Schaum von der Oberlippe und rülpste ungeniert. „Sie haben Bedenken wegen des Alkohols, Sir?“ Er streckte dem Portrait die Bierdose entgegen. „Halb so schlimm, Sir. Zugegeben, momentan trinke ich öfter mal einen über den Durst. Hab Probleme mit einer Frau, aber davon geht ja die Welt nicht unter.“ Er hob die Achseln und lächelte wehmütig. „Ist ja sowieso vorbei, jetzt wo ich mich zu Ihnen ins Siebzehnte Jahrhundert verlaufen habe. Die Frau ist nun gewissermaßen unerreichbar für mich.“
Tim leerte die Dose. Sein Blick fiel auf das Bild neben dem Königsportrait – die Büste einer jungen Frau, ebenfalls in Öl. „Ist das Ihre Tochter, Sir? Nettes Mädchen, wirklich. Könnten Sie uns gelegentlich miteinander bekannt machen?“ Tim blickte in das blasse schmale Frauengesicht, während er die zweite Dose öffnete. Die Frau hatte große braune Augen, Rehaugen. Und plötzlich sahen Liz‘ Augen auf ihn herab.
„Verdammt!“, flüsterte er. Er legte den Kopf in den Nacken und kniff die Lider zusammen. Etwas stieg heiß und drückend aus seinem Bauch durch den Brustkorb bis in seine Kehle hinauf. Viel weiter ließ Tim seine Tränen selten gelangen.
Als er Minuten später die Augen wieder öffnete, fiel sein Blick auf den Nachttisch neben dem Bett – ein Telefon stand darauf. Tim stemmte sich aus dem Sessel hoch und schleppte sich zum Bett. Er ließ sich auf die Bettkante fallen, nahm den Hörer ab und tippte eine New Yorker Nummer in die Tastatur, die Nummer von Burt Cassidy, seinem besten Freund. Sie waren zusammen in Riverside, Kalifornien aufgewachsen. Burt war Beamter; er hatte einen gut bezahlten Job in der New Yorker Stadtregierung.
Lange tönte das Freizeichen, bis endlich jemand abnahm. „Tim hier. Wie geht‘s so, Burt?“
Sekundenlanges Schweigen am anderen Ende. Dann: „Darüber wollte ich frühestens in zwei, drei Stunden nachdenken, nach dem Duschen, oder nach dem Frühstück.“ Burts Stimme klang verschlafen.
„Oh, Mist!“ Tim blickte auf seine Armbanduhr – halb elf. In New York City war es jetzt halb fünf Uhr morgens. „Sorry, Burt … habe ich glatt vergessen.“
„Demnach geht es dir nicht besonders gut, schätze ich.“
„Es geht mir verteufelt gut! Endlich allein Urlaub – besser könnt es mir gar nicht gehen …“
„Hör auf, Tim!“, sagte Burt streng.
„Okay, okay, es geht mir beschissen. Hast du etwas von Liz gehört inzwischen?“
„Sie war hier in Manhattan, auf der Durchreise, hat eine Freundin besucht. Wir haben uns unten am East River Hafen im North Star Pub getroffen.“
„Und?“ Tims Gestalt straffte sich, als würde er einen Angriff erwarten, gegen den er sich wappnen musste. „Was sagt sie?“ Seine Stimme klang plötzlich heiser.
Deutlich konnte er Burts tiefe Atemzüge hören. „Ich bin dein Freund, Tim. Deswegen sag ich dir die Wahrheit: Sie will nie wieder zurück nach Europa. Sie will nicht länger mit einem Soldaten verheiratet sein, um keinen Preis der Welt. Vergiss sie, Tim, es ist vorbei!“ Burt sprach weiter und erzählte noch ein paar Einzelheiten, aber Tim hörte nicht mehr zu. Irgendwann legte er auf. Er leerte sein Bier und streckte sich auf dem Bett aus. Stundenlang lag er so, starrte die Stuckdecke an und gab sich nutzlosen Grübeleien hin.
Am späten Nachmittag zwang er sich aufzustehen. Er fühlte sich müde und seine Knie und Knöchel schienen mit Blei gefüllt zu sein. Eine kalte Dusche vertrieb die schwarzen Löcher aus seinem Schädel und weckte seine Lebensgeister, zumindest vorübergehend. Er versuchte die New York Times zu lesen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Lustlos schweiften seine Augen über die Titelseite und blieben an einer Schlagzeile hängen, die ihm bekannt vorkam: „Schottische Hobbyastronomen entdecken bislang unbekannten Kometen“.
Ein Thema, das ihm ähnlich realitätsfern erscheinen wollte wie das museumsreife Inventar seines Hotelzimmers oder das Portrait des Schwedenkönigs an der Wand. Vielleicht überflog er den Artikel deswegen.
Die beiden Schotten hatten den neuen Himmelskörper von einem Berg in Jamaika aus entdeckt, rein zufällig. Sie wollten eigentlich den Saturn beobachten. Am Schluss des Artikels hieß es: „Das Astrophysical Observatory am Smithsonian in Cambridge, Mass. befasst sich seit den Morgenstunden mit der Berechnung der Kometenbahn. Dem wissenschaftlichen Leiter des Observatoriums zufolge, Professor Doktor Jacob Blythe, wird Alexander-Jonathan, wie der Komet nach seinen Entdeckern benannt wurde, in nicht einmal fünfzehn Millionen Kilometern Entfernung an der Erde vorbeiziehen. Über den genauen Zeitpunkt, an dem der Komet sein Perihel – seinen sonnennächsten Punkt – schneiden wird, wollte der Astrophysiker sich nicht äußern.“
„Dann ist ja für Unterhaltung gesorgt in den nächsten Monaten“, murmelte Tim. „Unterhaltung aus dem All.“ Er warf die Zeitung auf den Tisch und verließ das Hotel.
Ohne Plan schlenderte er über den Stortorget, vorbei am Reiterdenkmal des Schwedenkönigs, vorbei an dem alten historischen Rathaus. Ziellos lief er durch die Innenstadt – ziellos, wie er seit zwei Wochen durch Deutschland, die Beneluxstaaten, Dänemark und Norwegen gefahren war. Gegen Abend merkte er, dass er im Kreis lief – rot und prachtvoll ragte wieder die Fassade des Rathauses vor ihm auf. Im Kreis laufen – auch das schien ihm bezeichnend für seinen Zustand zu sein. Er erreichte einen großen Platz, der an den Rathausplatz angrenzte. Die Abenddämmerung sog bereits das Licht aus dem Himmel. Tim sah sich um – Cafés, Restaurants, Bars. Ein Lokal reihte sich ans Nächste. Das Bermudadreieck der Stadt. „Dich hab ich gesucht“, knurrte Tim.
Er landete in einer Jazzkneipe. Es war nicht so, dass Timothy auf Jazz stand – er bevorzugte eher den Rock der Neunziger und den schwarzen Reggae Hip-Hop aus der gleichen Zeit. Doch manchmal genoss er es, sich von heiseren Saxophon- und träge dahinplätschernden Pianoklängen einlullen zu lassen. Vor allem dann, wenn die Gedanken in seinem Schädel Karussell fuhren.
Nicht viele Gäste saßen in dem schlauchartigen Lokal. Die meisten scharten sich um zwei Billardtische. Ein Ventilator kreiste unter der Decke. Ein Hauch der Sechziger des vergangenen Jahrhunderts lag über dem Raum: Stahlrohrtische und -stühle mit pastellfarbenem Dekor, neben dem Garderobenständer eine Musikbox aus Elvis-Zeiten, an der Wand über der Theke Kühlergrill, Scheinwerfer und der vordere Teil eines roten Volvo, Baujahr 1966. Auch Theke und Barhocker bestanden aus Stahlrohr und Plastik. Tim rutschte auf einen Hocker an der Schmalseite der nur dünn bevölkerten Theke und bestellte ein Bier.
Anderthalb Stunden etwa vergingen – das Karussell in Tims Kopf hatte dem Klacken der Billardkugeln und den Saxophonklängen Platz gemacht. Er hörte nicht, wie die Frau die Kneipe betrat. Sie setzte sich auf den Barhocker neben ihm: braungebranntes, sommersprossiges Gesicht, Stupsnase, blonder Zopf, weißes ärmelloses Kleid …
Tim wusste nicht, was er sagen, wie er reagieren sollte. Aber sie wusste es. „Schwarzer Chrysler, PT Cruiser“, sagte sie, ohne ihn anzuschauen. „Berliner Kennzeichen, blaugrüne Augen, zwei Dosen Jever, die New York Times, wahrscheinlich Amerikaner.“ Sie zog eine Schachtel Nil aus ihrem schwarzen Lederbag und bot ihm eine Zigarette an. Zum zweiten Mal an diesem Tag trafen sich ihre Blicke.
„Sie haben ein gutes Gedächtnis.“ Tim nahm eine Zigarette und ließ sich von ihr Feuer geben.
„Ein sehr gutes sogar.“ Ihre blauen Augen schienen jeden Quadratzentimeter seines Gesichts zu studieren. „Darauf bin ich mächtig stolz. Als Journalistin brauche ich ein gutes Gedächtnis.“ Sie sprach tadelloses Englisch. „Und was machen Sie hier?“
„Ich versuche mein gutes Gedächtnis loszuwerden.“ Tim grinste müde.
Sie lächelte ihn an. Etwas Rätselhaftes lag in diesem Lächeln. „Beryl“, sagte sie. „Beryl Nordström.“
„Timothy Lennox – nennen Sie mich Tim.“ Tim wusste plötzlich, wie der Abend verlaufen und wie er enden würde. Und er behielt Recht.
Sie plauderten, tranken Bier, irgendwann berührten sich wie zufällig ihre Knie und kurz darauf ihre Hände. Gegen Mitternacht dann, in einer Diskothek, berührten sich ihre Körper. Sie tanzten.
Beryl nahm ihn mit in ihr Hotelzimmer. Tim erinnerte sich später kaum, ob es gut gewesen war. Er erinnerte sich dafür sehr deutlich an das, was er dachte, während sie auf ihm lag und ihr nackter Körper in seinen Armen tanzte. Er dachte an Liz.
*
Cambridge, Massachusetts, 27. August 2011
Der achteckige Raum wirkte wie die Kommandozentrale eines jener Raumschiffe, wie man sie aus Sciencefiction-Filmen kannte. Mannshohe und nach oben hin leicht abgeschrägte anthrazitfarbene Kunststoffkonsolen umgaben ihn. In ihnen flimmerten Monitore, leuchteten Kontrolllämpchen, huschten Zahlenkolonnen oder Diagramme über schmale Displays. Auf den Tischflächen davor ruhten Tastaturen, Drucker, Telefone und kleine Tischlampen. Zusammen mit der Leinwand an der Stirnseite des Raumes sorgten sie für spärliches Licht.
Sieben der vierzehn Sessel vor den Konsolen waren besetzt in dieser Nacht. Vier Männer und drei Frauen bestritten den Nachtdienst am Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge, Massachusetts. Seit zwei Tagen arbeitete man hier rund um die Uhr. Seit der neue Komet auf der Bildfläche erschienen war.
Ein achter Mann stand mitten im Raum – nicht besonders groß, auffällig hager, fast dürr und mit einem blonden Haarzopf. Ein Mann, der sich ununterbrochen bewegte.
Ein wenig erinnerte er darin an einen Eiskunstläufer, der seine Pirouetten und Sprünge auf dem Trockenen übt, bevor er sich aufs Eis wagt. Oder wie ein Pelzjäger aus der Frühzeit des Wilden Westens, der sich im undurchdringlichen Wald der Rocky Mountains von feindlichen Indianern umgeben sieht und nach allen Seiten sichern zu müssen glaubt. Ständig wirbelte der Mann um seine eigene Achse, wobei sein Haarzopf von Schulter zu Schulter flog und sein weites Hemd um seinen sehnigen Körper flatterte. Ständig ruderte er mit den Armen, ständig sprang er hin und her und stieß halbe Sätze oder gar nur einzelne Worte aus, und zwar mit hoher, für einen außenstehenden Beobachter leicht hysterisch klingenden Stimme.
Seine Mitarbeiter hatten gelernt, die unvollständigen Sätze oder herausgebellten Worte als Fragen, Anweisungen oder zufällig laut geäußerte Gedankenfetzen zu deuten. Das mussten sie lernen. Keinem, der am Astrophysical Observatory Karriere machen wollte, blieb etwas anderes übrig, als sich ganz und gar auf die Absonderlichkeiten von Professor Dr. Jacob Blythe einzustellen. Er war der Chef. Bei Gott – das war er. Und es gab eine Menge Absonderlichkeiten, an die seine Mitarbeiter sich gewöhnen mussten, vorausgesetzt, sie wollten ihren Job behalten. Genaugenommen war der Mann eine einzige fleischgewordene Absonderlichkeit.
„Den Neigungswinkel, ich will den exakten Neigungswinkel hören! Haben die Spanier sich gemeldet?“ Blythe zog einen Schokoriegel aus der Brusttasche seines Hemdes. „Natürlich bremst der Saturn ihn ab, was denn sonst … Den Neigungswinkel, verdammt noch mal! Haben Sie auf Hawaii das Perihel neu berechnet?“ Hektisch riss er das Papier von seinem Schokoriegel und biss hinein. „Eine Helligkeit von zwei Komma zwei“, mit vollem Mund sprach er weiter, „zwei Komma zwei – bei dieser Entfernung, ich glaub‘s nicht, ich glaub‘s einfach nicht! Wir hätten den Brocken schon vor Tagen entdecken müssen … Was zum Teufel mailen die Spanier?“
Er deutete nach links und nach rechts, mal auf diesen Mann, mal auf jene Frau vor den Bildschirmen und Armaturen. Zwischendurch legte er die freie Hand auf die Stirn, hörte auf zu kauen und schloss seine weit aus den Höhlen tretenden Augen. Wie ein Dichter, der an einem Vers schmiedet, sah er dann aus, oder wie ein Regisseur, der versucht sich eine schwierige Szene vorzustellen. Ein absonderlicher Mann, wie gesagt. Wenn er die Augen dann wieder aufriss, warf er jedes Mal einen flüchtigen Blick auf die Leinwand, bevor er zum nächsten Redeschwall ansetzte.
Auf der Leinwand funkelte ein Ausschnitt des südlichen Sternenhimmels. Deutlich war er zu sehen, der kleine spindelförmige Lichtfleck knapp über dem westlichen Horizont – „Alexander-Jonathan“, der neu entdeckte Komet. In knapp zwanzig Minuten würde er das Objektivfeld des Smithsonian Observatoriums verlassen.
„Der Bahnneigungswinkel beträgt exakt zwölf Grad, neunzehn Minuten und siebenunddreißig Sekunden, Sir.“ Spencer Levington drehte sich von seinem Sessel aus zu Blythe um. Der junge Astronom saß an der Konsole direkt unter der Projektionsfläche.
„Humbug!“ Blythe lief zu ihm, beugte sich über dessen Schulter und beäugte die Tabelle auf dem Monitor in der Konsole. „Es stimmt … Verdammt, es stimmt tatsächlich! Gestern waren es noch mehr als dreizehn Grad!“
„Das Gravitationsfeld des Saturn, Sir“, gab Levington zu bedenken. „Immerhin hat er sich dem Planeten auf zwei Komma drei Astronomische Einheiten genähert.“
„Eine Grafik!“, zischte Blythe. „Weg mit der Tabelle – ich will eine Grafik!“ Während Levingtons Finger über die Tastatur flogen, richtete Blythe sich auf und blickte auf die große Projektionsfläche. „Das Bild aus Hawaii! Wo bleibt es? Ich will den Himmel über Hawaii sehen!“
„Wir sind gleich so weit, Sir!“, rief eine Frauenstimme von der rechten Seite der Observatoriums-Zentrale. Christine Perlman – die Mathematikerin und Astrologin gehörte erst seit drei Monaten zu Blythes Mitarbeiterstab.
„Und die NASA, zum Teufel!“ Der Zeigefinger seines ausgestreckten Armes stach nach links. „Warum habe ich noch immer nicht mit der NASA gesprochen?“
„Rufen zurück, Sir“, sagte eine gelassene Männerstimme zwei Tische neben Levingtons Arbeitsplatz. Louis Garfield, ein beleibter Afroamerikaner, war nach dem Professor der dienstälteste Mitarbeiter am Smithsonian. Ein Astrophysiker wie Blythe.
„Unmöglich kann der Neigungswinkel sich verändern.“ Blythe drehte eine Runde durch den Raum. „Völlig ausgeschlossen …“ Mit beiden Händen hielt er sein knochiges Gesicht fest, als wollte er das Chaos unter seiner Schädeldecke bändigen. „Was sagt Hawaii? Ich will endlich ihr Bild … Und das Perihel, das Perihel – warum weiß ich immer noch nicht, welchen sonnennächsten Punkt die Schnarchnasen ausgerechnet haben?“
„Eins Komma null zwei Astronomische Einheiten, Sir!“, rief Christine Perlman. „Deckt sich mit unseren Berechnungen!“
„So nahe kommst du der Sonne?“ Blythe fuhr herum; die Absätze seiner Turnschuhe quietschten auf den Fliesen. Er starrte die Leinwand an. Der Komet verließ eben den von Cambridge aus sichtbaren Sternenhimmel. „Fast so nah wie die Erde … Willst du uns einen Besuch abstatten?“
Die Leinwand verblasste. Für Augenblicke blieb sie dunkel. „Das Bild vom CFHT, Sir!“, sagte Garfield. Und wieder funkelte der Sternenhimmel auf der Projektionsfläche. Der Sternenhimmel, wie man ihn in Hawaii vom Mauna Kea aus sah. Durch das dort stationierte Kanada-France-Hawaii-Telescope – abgekürzt CFHT – mit einem Spiegeldurchmesser von 3,6 Metern.
Blythe trat hinter Levingtons Sessel und umfasste dessen Lehne. Seine unnatürlich großen Augen glitten über das Bild aus Hawaii. Er fand den Lichtfleck nur wenig oberhalb des unteren Projektionsrandes zwischen Centaurus und der Mittelachse der Wasserschlange. „Da bist du ja, du merkwürdiger Vagabund …“
Seit der Entdeckung des Kometen vor zwei Tagen stand Blythes Observatorium praktisch ununterbrochen mit dem Laser-Teleskop auf dem Calar Alto in Spanien in Verbindung, und mit dem CFHT auf dem Mauna Kea in Hawaii. Die Berechnungen der Kometen waren schwierig. Ihr Neigungswinkel zur Ekliptik – zur Erdbahn also – bereitete Blythe Kopfzerbrechen. Und die widersprüchlichen Daten über den voraussichtlich erdnächsten Punkt sowieso. „Die NASA!“, brüllte er plötzlich los. „In Hawaii wird man ihn auch nicht mehr lange sehen! Ich will endlich Bilder von Hubble zwei!“
Viermal hatte Blythe in den vergangenen vierundzwanzig Stunden mit der NASA telefoniert. Man hatte versprochen, ihm Aufnahmen des neuen Weltraumteleskops Hubble II zur Verfügung zu stellen. Nichts war passiert. „Wollten zurückrufen, Sir!“, kam es von einem der Arbeitsplätze.
„Rufen Sie an“, verlangte Blythe, „sonst warten wir noch das ganze Wochenende! Verdammte Bürokraten! Zu blöd, um über den eigenen Tellerrand zu blicken! Es fliegen noch ein paar andere Sachen im Weltall herum als ihre bescheuerten Sonden! Der Komet müsste doch ein gefundenes Fressen für ihr Discovery-Programm sein!“
„Die Grafik, Sir!“, unterbrach Levington seinen Wutanfall. Blythe sprang zu Levingtons Computerkonsole. Seine Augen saugten sich förmlich an der grafischen Darstellung von Erd- und Kometenbahn fest.
Die Ekliptik war als blau getönte, fast kreisförmige Scheibe um die Sonne dargestellt, die wahrscheinliche Kometenbahn als langgezogene rote Ellipse. „Eine Hyperbel, Sir. Ihre Scheitelpunkte sind extrem schwer zu berechnen.“ Die rote Ellipse durchstieß die blaue Scheibe in einem sehr spitzen Winkel; fast deckten sich die Flächen.
„Ist das wahr?“, flüsterte Blythe. „Zwölf Grad, neunzehn Minuten … Ist das wirklich wahr?“
Ein gelber Punkt blinkte am Perihel, am sonnennächsten Punkt also, den der Komet durchqueren würde. Der gelbe Punkt lag erschreckend nah an der Erdbahn, daneben ein Datum: 12. Februar 2012 – der voraussichtliche Termin der größten Sonnennähe des Kometen. „Entfernung!“, bellte Blythe. „Wie weit ist die Erde am zwölften Februar von seinem Perihel entfernt?“
Levingtons Finger tanzten über die Tastatur. Ein Fenster öffnete sich in der Grafik. Darin eine Zahl: 13.640.320 Kilometer.
„Gestern waren es noch fast fünfzehn Millionen Kilometer!“, schrie Blythe. Er stieß sich von Levingtons Sessellehne ab und wirbelte herum. „Die Daten aus Spanien!“ Und wieder tänzelte er durch den rechteckigen Raum. „Wo kommst du her? Aus der Oort‘schen Wolke? Aus einem anderen Sonnensystem?“ Er blieb stehen, legte beide Hände auf den Kopf und starrte die Leinwand an. „Wieso haben wir dich nicht früher entdeckt? Und dann deine Bahn!“ Er drehte sich einmal um sich selbst und riss die Arme hoch. „Eine Hyperbel! Eine Hyperbel, die sich fast mit der Ekliptik deckt – der Bursche kommt aus dem Nichts und wird auf Nimmerwiedersehen aus dem Sonnensystem verschwinden!“
In der Nähe der Tür blieb er wieder stehen, griff in die Tasche seiner weiten Leinenhose und zog einen Stanniolstreifen heraus, ein Tablettenbriefchen. „Haben Sie jemanden bei der NASA erreicht? Was erzählen die Penner?“ Blythe drückte ein Dragee aus dem Stanniolstreifen. Ein Medikament, das die Produktion seiner Schilddrüsenhormone drosselte.
„Sie holen gerade den Chef vom Dienst aus dem Bett, Sir“, rief Christine Perlman ihm zu. Sie drückte das Telefon ans Ohr.
„Wird auch Zeit.“ Blythe schob sich das Dragee zwischen die Lippen und schluckte es. Die übliche Dosis wäre dreimal ein Dragee pro Tag gewesen. Blythe, selbst Mediziner, verordnete sich meist nur zwei oder eins. Eine Schilddrüsenüberfunktion war nicht die allerschlechteste Krankheit – man lief fast ununterbrochen auf Hochtouren und brauchte wenig Schlaf. Blythe kam mit drei Stunden aus. Wenn nur der chronische Hunger nicht wäre. Er zog einen neuen Schokoriegel aus der Hemdtasche und riss das Papier ab.
„Die Spanier haben eine Datei geschickt, Sir!“, rief einer der Astronomen. „Die neuesten Berechnungen vom Calar Alto!“
„Auf die Leinwand damit!“ Sekunden später projizierte der Beamer eine Tabelle auf die Leinwand. „Alexander-Jonathan, 16:20 Uhr, MEZ“ lautete die Titelzeile. Darunter die aktuellen Werte: Albedo, Helligkeit, Sublimation, Schweiflänge, aktive Fläche, Geschwindigkeit, und so weiter.
„Die NASA, Sir!“ Christine Perlman drehte ihren Sessel herum und strecke ihm das Telefon entgegen. Blythe schoss auf sie zu und riss ihr das Gerät aus der Hand. „Professor Doktor Blythe!“ Er sprach laut und betonte jede einzelne Silbe. „Schön, so außerordentlich rasch von Ihnen zu hören! Ich brauche Daten von Hubble zwei!“
Eine Männerstimme nuschelte einen Namen aus dem Hörer. Blythe verstand ihn nicht und er interessierte ihn auch nicht. „Das dauert noch, Sir“, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung. „Unser Hubble-Team hat in den nächsten Stunden noch eine Menge Messungen vor der Brust. Sie wissen ja – die Rosetta-Sonde …“
Die ROSETTA-Mission war ein Projekt der ESA. Im Januar 2003 hatte eine Ariane-Rakete die Sonde von Kourou, Französisch-Guayana aus ins All geschossen. Acht Jahre später, im Juni 2011, hatte die Sonde den Kometen Wirtanen erreicht. Die Landung auf Wirtanen sollte in neunzehn Tagen stattfinden.
„Und ganz nebenbei müssen wir noch Contour im Auge behalten. Die Sonde …“
„Nichts gegen Ihr Spielzeug da oben, Mister“, unterbrach Blythe den Mann, „aber im Augenblick haben wir dringendere Sorgen, schätze ich!“ Das schnurlose Telefongerät mit der Rechten ans Ohr gepresst, tippelte er durch die Observatoriums-Zentrale. Während er sprach, schlug sein linker Arm Schneisen in einen imaginären Dschungel. „Der neue Komet, Alexander-Jonathan – vor zwei Tagen hat er den Saturn passiert, in nur dreihundertfünfzig Millionen Kilometer Entfernung! Jetzt ist er nicht einmal mehr acht Komma fünf zwei Astronomische Einheiten von uns entfernt, etwa eins Komma zwei Milliarden Kilometer! Er muss also mit unglaublicher Geschwindigkeit ins Sonnensystem hineingerauscht sein, denn Saturn stand vorgestern über zehn Astronomische Einheiten weit entfernt.“
Blythe blieb stehen und warf einen Blick auf die Leinwand. „Geschwindigkeit wahrscheinlich fünfzig Kilometer pro Sekunde. Saturn hat ihn abgebremst. Aber der Neigungswinkel seiner Bahn hat sich in den letzten zweiunddreißig Stunden um fast ein Grad verringert. Das kann man nicht allein mit Saturns Gravitationsfeld erklären. In voraussichtlich hundertneunundsechzig Tagen, am zwölften Februar zweitausend-zwölf wird er sein Perihel erreichen – und zwar in einer verflucht geringen Distanz zu unserem hübschen Planeten …“
„Schicken Sie uns Ihre Daten rüber“, versuchte der Anrufer Blythes Wortschwall zu stoppen.
„Das werde ich tun“, bellte der Professor ins Telefon. „Und Sie werden Ihre Leute zusammentrommeln und ihnen klar machen, dass ich morgen die Hubble-Daten auf dem Tisch liegen haben muss. Und ich brauche eins Ihrer Spielzeuge. Ich will so viel wie möglich über den Kometen erfahren …“
„Das geht nicht!“ Der NASA-Mann wurde schroff. „Unsere Discovery-Sonden sind ausgelastet, und zwar bis zum Anschlag. Das New-Millenium-Programm tritt gerade in seine heiße Phase …“
„Dann wende ich mich ans Weiße Haus! Viel Spaß noch!“ Blythe unterbrach die Verbindung, stach zurück zu Perlmans Platz und knallte ihr das Telefon auf den Tisch. „Verbinden Sie mich mit Washington!“ Er drehte sich um und deutete auf die Leinwand. „Nachrichtensperre! Kein Wort darüber dringt an die Öffentlichkeit!“
*
Dortmund, 29. August 2011
Die S-Bahn hielt, Türen öffneten sich zischend, Menschen schoben sich durch den Mittelgang, und eine Stimme verkündete, dass der Zug hier endete. Also stemmte sich auch Herbert Fuchs aus dem Sitz, griff nach seiner bunten Plastikreisetasche im Gepäcknetz und drängte sich in die Menge zwischen den Sitzreihen.
Auf dem Bahnsteig ließ er seine Tasche auf eine Bank fallen. Er war lange nicht in der Stadt gewesen, musste sich erst an den Gedanken gewöhnen, wieder hier zu sein. Nur nichts überstürzen. Er drehte sich eine Zigarette.
Die Menge strömte zu den Treppenabgängen in die Bahnhofshalle, und noch bevor er sich seine Zigarette anzündete, fand sich Herbert allein auf dem Bahnsteig. Es war kurz vor zweiundzwanzig Uhr. Normalerweise lag Herbert um diese Zeit in seiner Zelle und bog im Traum starke Drähte zu Kleiderbügeln für Reinigungen oder schraubte Plastikhülsen, Minen, Federn und Druckknöpfe zu Kugelschreibern zusammen. Damit hatte er in den letzten zehn Jahren seine Tage zugebracht. Heute war er entlassen worden.
Er rauchte, und die Treppe zur Bahnhofshalle spuckte wieder Menschen aus. Der Bahnsteig füllte sich. Herbert kam sich plötzlich etwas verloren vor, und in seinem Bauch schien sich ein großes Loch zu öffnen – das Gefühl, etwas würde ihm fehlen, beschlich ihn. Mach dir nicht ins Hemd, Herbert, dachte er, es ist leichter als du denkst.
In Malmö verließ Timothy Lennox zu diesem Zeitpunkt gerade Beryls Hotel. Drei Tage waren sie nicht aus dem Bett gekommen, aber am Abend hatten sie sich gestritten – Beryl forderte, dass er mit ihr nach Stockholm fuhr, aber Tim wollte nicht.
In Cambridge, Massachusetts, war es später Nachmittag. Das Telefon in der Hand lief Professor Dr. Jacob Blythe in seinem Büro hin und her. Das ganze Wochenende über hatte er vergeblich versucht, einen Regierungsvertreter aus der engsten Umgebung Schwarzeneggers an die Strippe zu bekommen. Jetzt meldete sich ein Berater des Präsidenten. Blythe versenkte einen angebissenen Schokoriegel in seiner Hemdtasche.
In Harbour View lagen Archer Jonathan und Marc Alexander im weißen Sand. Durch Feldstecher beobachteten sie einen flachen Viermaster, etwa vierhundert Meter auf dem Meer vor der abendlichen Küste. Ein Drachenkopf zierte als Galionsfigur den Bug des Schiffes, und ein Ruderboot voller Wikinger steuerte den Strand an, wo ein Dutzend nackter Frauen hastig ihre Kleider zusammenrafften. Eine Filmszene, in der Vivian und Sue Nebenrollen spielten.
Jonathan und Alexander hatten Kopfschmerzen und tranken Wasser. Seit ein gewisser Dr. Blythe sie am vergangenen Freitag in ihrem Hotelzimmer angerufen hatte, um ihnen zur Entdeckung eines neuen Kometen zu gratulieren, hatten sie praktisch ununterbrochen gefeiert. Man wird ja nicht jeden Tag unsterblich.
Alexander-Jonathan war zu diesem Zeitpunkt noch 1.163.747.520 Kilometer von der Erde entfernt.
Und Herbert Fuchs verließ den Dortmunder Hauptbahnhof. Er sah sich um. Der Bahnhofsvorplatz hatte nichts Vertrautes mehr. Vor fast elf Jahren, als er hier die S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen bestiegen hatte, war der Hauptbahnhof noch eine Großbaustelle gewesen. Jetzt thronte ein überdimensionaler Hut auf ihm, ein Ufo-förmiger Leichtmetallbau. Er erstreckte sich über den Ostwall fast bis zur Treppe Richtung Petri-Kirche. Die Welt hat sich weitergedreht, Herbert, so ist das nun mal.
Er entschied sich, zu Fuß in die Nordstadt zu gehen. Gemach, Junge, langsam ankommen, ganz langsam. Sein trockener Mund signalisierte ihm seine Angst. Angst vor der Begegnung mit Julia. Es war über ein Jahr her, dass sie ihn zuletzt im Gefängnis besucht hatte. Und ihr letzter Brief kam vor zehn Monaten. Nichtssagende Worthülsen, keine Erklärung, kein Abschied, nichts. Herbert ahnte, was ihn erwartete.
Am Harenberg-Center ging er an der Bahntrasse entlang und dann rechts durch die Unterführung hindurch Richtung Nordstadt. Er überquerte die Straße, die links zum Arbeitsamt führte und vor allem zum Nordausgang des Hauptbahnhofs, wo er als Siebzehnjähriger seine Laufbahn als Drogendealer begonnen hatte. Achtundzwanzig Jahre her. Rechts auf der anderen Seite der Schützenstraße wohnte der Bestatter, der seine Eltern beerdigt hatte. Sein Hosenschlitz hatte offen gestanden, als er nach der Trauerfeier an den Sarg seines Vaters trat, um die Träger einzuweisen. Herbert musste grinsen, als er daran dachte.
Zwei Häuserblocks weiter war eine der vielen Kneipen, in denen er Musik gemacht hatte, und dann die Kirche, die er als vierzehnjähriger Konfirmand zum letzten Mal betreten hatte. Je weiter er in die abendliche Nordstadt vordrang, desto mehr Bilder aus seiner Jugend stiegen aus einer Erinnerung hoch. Und desto fremder fühlte er sich. Wie einer, der kein Zuhause mehr hatte. Die Welt hat sich weitergedreht, Junge – du gehörst nicht mehr dazu.
Er bog in die Mallinckrodt ein, die Hauptverkehrsstraße der Nordstadt, und schlenderte wie ziellos Richtung Borsigplatz. Dabei lag dort das einzige Ziel, das es in seinem Leben noch gab.
Hier hatte sich nicht viel verändert: türkische Imbiss-Stuben, türkische Schuhmacher, türkische Lebensmittelläden und an jeder Straßenecke ein Kiosk. Ein paar Schritte vor ihm schob eine Frau einen Kinderwagen aus einer Kneipe. Blaue Strähnen durchzogen ihr Kurzblondhaar, sie war kräftig gebaut. Sie trug eine Art ärmellose Weste auf nackter Haut, und auf dem Rückteil der Weste las Herbert in weißen Buchstaben das Wort Destiny. Schon wieder musste er grinsen. Besser aber noch als das Schicksalsetikett gefiel ihm der füllige Hintern der Frau. Er steckte in knappen weißen Shorts und pendelte auf eine Weise hin und her, die Herbert sich in seiner Gefängniszelle oft vorgestellt hatte. In unzähligen sehnsüchtigen Stunden hatte er geradezu eine Meisterschaft darin entwickelt, sich Frauenhintern vorzustellen, die sich auf erbauliche Weise bewegten. Ihm wurde heiß, und er beschleunigte seinen Schritt. Es kam ihm selbst albern vor, die Frau nur deswegen überholen zu wollen, um einen Blick auf ihre Frontseite werfen zu können.
Er hatte sie fast eingeholt, als etwas Buntes aus dem Wagen rutschte und auf den Asphalt fiel. Herbert blieb stehen und sah nach unten – eine Plüschfigur lag vor den Spitzen seiner alten Mokassins. Er bückte sich und hob sie auf. Das kleine Kerlchen im Kinderwagen fing an zu krähen. Im Licht der Straßenbeleuchtung betrachtete Herbert die Figur. Sie trug ein schwarzes Kostüm. Ihre Füße steckten in gelben Gummistiefeln. Sie war mit einem sandfarbenen Trenchcoat bekleidet, hatte einen unglaublich breiten Mund und lustige Augen. Auf der breiten Heldenbrust stand in gelben Großbuchstaben „JIM TRASH“.
Das Kerlchen streckte seine kurzen Ärmchen aus und schrie herzzerreißend. Herbert reichte ihm die Figur in den Kinderwagen. Augenblicklich verstummte das Geplärre. Der Junge, höchstens anderthalb Jahre alt, drückte Jim Trash an seine Brust, gluckste und blinzelte Herbert aus verheulten Augen an. Das feiste Kerlchen sah ein bisschen aus wie ein Ferkel, das man in blaue Hosen und in ein grünes Hemdchen gezwängt hatte.
„Danke“, sagte die Frau. Sie mustere ihn von oben bis unten und wirkte deutlich reserviert. Eine Hitzewelle schoss Herbert ins Gesicht – schlagartig wurde ihm klar, dass er aussah wie ein Penner in seinen dutzendfach geflickten alten Jeans, seinem abgetragenen grauen Jackett, der speckigen Lederweste und seinem ehemals weißen Hemd darunter. Die Frau packte den Griffbügel des Kinderwagens und stach davon. Vor lauter Peinlichkeit hatte Herbert vergessen auf ihre Brüste zu schauen.
Ein paar Schritte weiter, vor einem Schaufenster, in dem sich seine Gestalt spiegelte, blieb er stehen. Er hatte Fett angesetzt. Von der Seite wölbte sich sein Bauch aus den Knopfleisten seines Jacketts. Das graue Haar hing ihm strähnig über die Schultern und ein stellenweise schon weißer Vollbart wucherte in seiner unteren Gesichtshälfte.
„Original Herbert Fuchs – so ist er, und so bleibt er.“ Er sprach mit sich selbst, und so etwas wie Trotz schwang in seiner Stimme. Die Eigenwilligkeit seiner äußeren Erscheinung hatte er sich durch die ganze lange Gefängniszeit bewahrt. Abgesehen von ein paar Büchern, einem silbernen Gasfeuerzeug mit seinen eingravierten Initialen, seiner Elfenbeinzigarettenspitze und einem schwarzen Siegelring war sie das Einzige, was ihm geblieben war aus seinem ersten Leben. Das Einzige, das wirklich ihm gehörte.
Sein Blick fiel auf die Auslagen des Schaufensters: Musikinstrumente. Darunter eine teure akustische Gitarre, Marke Fender. Er dachte an die achthundertzwanzig Euro, die sie ihm heute Morgen bei der Entlassung ausgezahlt hatten. Der klägliche Rest seines Arbeitslohns. Tausende von Kleiderbügeln hatte er dafür zurecht gebogen und Tausende von Kugelschreibern zusammengeschraubt. Diese Gitarre kostete zweihundertfünfundzwanzig Euro. Den Rest des Sommers könntest du mit Straßenmusik überstehen …
Er klemmte sich die schäbige Kunststofftasche unter den Arm und ging weiter. Die Fender-Gitarre nahm er mit. In seinem Kopf. Zweihundertfünfundzwanzig Euro, fast ein Drittel deines Gesamtvermögens!
Wehmütig dachte er an die Zeiten, in denen er vierhundert, fünfhundert Mark wie nichts ausgegeben hatte. An einem Tag, einfach so – für Kleider, CDs, Restaurantrechnungen, Haschisch und so weiter. Fette Jahre waren das gewesen, Jahre, in denen er im Schnitt alle vier Monate mal für zwei oder drei Wochen gearbeitet hatte. Arbeiten hieß damals, als Drogenkurier nach Kolumbien fliegen, oder nach Marokko, oder in die Türkei. Und jedes Mal vierzig- bis fünfzigtausend Mark mit nach Hause nehmen. Zwei Monate im Jahr arbeiten, zehn Monate das Leben genießen und Musik machen. Acht Jahre lang ging das so, bis sie ihn eines schönen Tages auf dem Düsseldorfer Flughafen mit zwei Kilogramm Heroin erwischten. Vorbei, dachte er, vergiss es. Du musst noch einmal anfangen. Ganz unten.
Er hoffte, ein paar Wochen lang bei Julia unterschlüpfen zu können. Soweit er wusste, gab es noch zwei oder drei alte Freunde in der Stadt. Sie würden sich an ihn erinnern. Männer, die Discotheken und Kneipen besaßen, in denen er früher verkehrte oder Musik gemacht hatte. Nachts kellnern, tagsüber Straßenmusik …
Mit solchen bescheidenen Zukunftsplänen im Kopf näherte er sich dem Borsigplatz. Der plötzliche Anblick der vertrauten Häuserfront riss ihn aus den Gedanken. Sie war noch grauer und schmutziger als er sie in Erinnerung hatte. „Julias Grillstube“ stand auf einem der beiden Schaufenster. Der Abendverkehr rasselte an ihm vorbei – Straßenbahnen, Busse, Pkws, Fahrräder. Hinter ihm, auf dem Bürgersteig, gingen Passanten vorüber. Er nahm es kaum wahr. „Julias Grillstube“ Julia!
Die Trockenheit in seinem Mund wurde ihm bewusst, der Druck hinter seinem Brustbein und der Herzschlag in seinen Schläfen. Er überquerte die Straße. Die Hand schon an dem schwarzen Kunststoff des Türgriffs, atmete er noch einmal tief durch. Dann zog er die Tür auf. Es war kurz vor halb elf.
Zu dieser Stunde etwa hatte Timothy Lennox in Malmö seine Hotelrechnung bezahlt und sein Museumshotel verlassen. Er lief über den großen Rathausplatz zu den Parkplätzen und blickte nicht ein einziges Mal zurück auf die mittelalterliche Fassade.
Und in Cambridge, Massachusetts legte Professor Dr. Jacob Blythe nach einem langen Telefonat mit dem Präsidentenberater den Telefonhörer auf und zog seinen angebissenen Schokoriegel aus der Hemdtasche.
In Harbour View, Jamaika, telefonierte Archer Jonathan mit seiner Frau und beglückwünschte sie, bei ihrer Hochzeit seinen Namen angenommen zu haben. Und sein Freund Marc Alexander und dessen neue Flamme Vivian trösteten Sue Bertram. Die hatte Arme und Kopf auf einen der Tische des Strandcafés gelegt, von dem aus Jonathan telefonierte. Ihre Tränen verwandelten ihr Make-up und ihren Lidschatten in lauter schmierige Farbflecken. Saxon, ihr Regisseur, hatte sie nach der letzten Szene des Drehtages zur Schnecke gemacht.
In New York City, in einem der gelben Cabbys am Grand Central Terminal, saß ein Taxifahrer, ein Schwarzer. Die abendliche Rushhour rasselte an ihm vorbei, und er rechnete die Kosten durch, die ein drittes Kind verursachen würde. Etwas weiter nördlich, in der Radio City Music Hall, betrat der bekannte Fernsehmoderator Timothy LaHaye den Maskenbildnerraum. In dreieinhalb Stunden würde seine beliebte Talk-Show beginnen.
Etwas weiter südlich, in Downtown, in einem Büro des Municipal Buildings, packte ein Regierungsbeamter Terminplaner, Handy und die New York Times in seinen Aktenkoffer und lächelte, weil er an den Abend mit seiner Familie dachte. Er hieß Burt Cassidy und war zufrieden. Sehr zufrieden sogar.
Und der neue Komet hatte sich inzwischen um weitere 2392 Kilometer auf die Erde zu bewegt. Und auf Julias Grillstube.
Herbert begriff, noch bevor die Tür hinter ihm zufiel. Ein Mann stand an den Fritteusen, mit dem Rücken zum Tresen. Er hatte dichte, blauschwarze Locken und trug ein weißes Muscleshirt, sodass Herbert die braune Haut seinen muskulösen Schultern und Oberarmen sehen konnte. Ein Südländer, vermutete er.
Julia machte sich hinter dem Tresen ganz links an der Spüle zu schaffen. Silbrige Fäden durchzogen ihr brünettes Haar. Wie früher hatte sie es zu einem Dutt im Nacken zusammengesteckt. Wasser strömte ins Spülbecken, und Julia fummelte ihre Armbanduhr vom Handgelenk. Als sie die Uhr auf den Tresen legte, sah sie auf. Herbert stand noch immer am Eingang. Ihre Blicke begegneten sich. Julias schmales, noch immer schönes Gesicht nahm die Farbe schmutzigen Kerzenwachses an. „Du … Herbert?“
„Curry-Wurst mit Pommes und ein Pils“, sagte Herbert. Er schritt zum Tresen und ließ dort seine Tasche fallen. Der Südländer an den Fritteusen hatte sich umgedreht. Aus dunklen, misstrauischen Augen musterte er Herbert. Er konnte nicht älter sein als Mitte dreißig. Herbert spürte die Blicke der sieben oder acht Männer und Frauen an den Stehtischen. Die angespannte Atmosphäre war mit Händen zu greifen.
„Ist das …“ Die Blicke des Mannes an den Fritteusen flogen zwischen Julia und Herbert hin und her. Julia nickte. Die Augen des Südländers wurden noch schmaler. Er hob zwei Siebe voller Pommes Frites aus dem siedenden Fett und stellte sie zwischen den Fettpfannen ab. Merkwürdig langsam tat er das, und genau so langsam drehte er sich um und baute sich vor Herbert hinter dem Tresen auf. Er war nicht unbedingt größer als Herbert, aber wesentlich drahtiger.
„Pommes und Curry-Wurst“, die Kontrolle über ihre Stimme drohte Julia zu entgleiten, „mit Ketchup oder mit Majo?“ Sie hätte Herbert genau so gut nach seinem Namen fragen können.
„Rot-Weiß“, sagte er heiser. Und wesentlich lauter und an den Südländer hinter dem Tresen gewandt: „Rot-Weiß – was ‘ne Frage, Mann! Hat sie mir tausendmal gemacht.“
Der Italiener, oder was auch immer, fixierte Herbert schweigend, nichts als Feindseligkeit in seinen Augen.
Herbert wusste genau, dass er besser den Mund halten, seine Tasche greifen und „Julias Grillstube“ verlassen sollte. Aber ähnlich wie er eine halbe Stunde zuvor gegen das Urteil seines Verstandes die Frau mit dem Kinderwagen überholen wollte, nur um einen Blick auf ihren Busen werfen zu können, so handelte er auch jetzt gegen das, was die Vernunft ihm gebot. Kein Damm war hoch genug, um seine jahrelang eingesperrten Bedürfnisse und Gefühle aufzuhalten. Wie eine Springflut überspülten sie jetzt Herberts Verstand.
Er legte sich also über den Tresen und fixierte Julias neuen Lover – denn das war er ohne Zweifel. „Sie hat mich mal geliebt.“
Julia stand jetzt an den Fritteusen und schien eifrig beschäftigt zu sein, als würde sie das alles nichts angehen. Aber Herbert sah, wie ihre Schultern nach oben zuckten. „Sie wollte mich sogar heiraten.“ Aus den Augenwinkeln nahm er wahr, dass sämtliche Gäste in „Julias Grillstube“ ihn und den Südländer beobachteten. Absichtlich sprach er so laut, dass jeder ihn hören konnte. „Sie wollte ein Kind von mir, stell dir das vor, Mann!“
Julia drehte sich um und stellte einen Plastikteller mit Pommes und Curry-Wurst vor Herbert auf den Tresen. „Herbert, bitte …“
„Wir haben gevögelt wie die Weltmeister!“ Herbert sprach jetzt noch lauter. „Das kannst du mir glauben, Mann!“