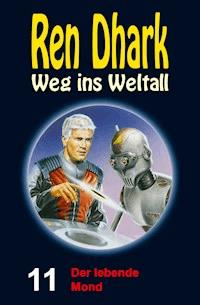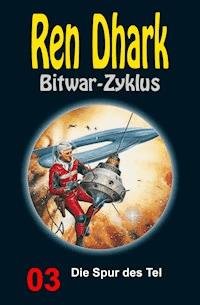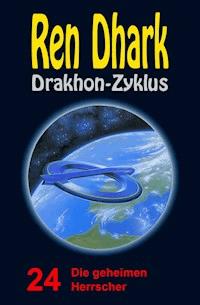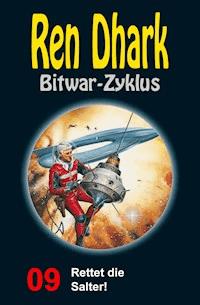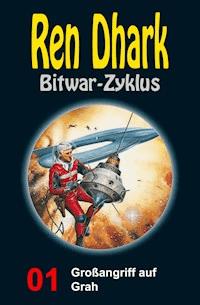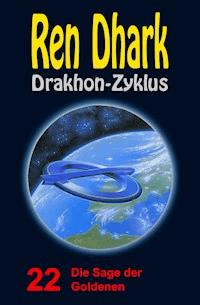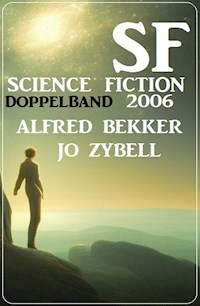
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Romane: (349XE) Lennox und der Blick in die Vergangenheit (Jo Zybell) Keduan - Planet der Drachen (Alfred Bekker) KEDUAN: Trivialname für den vierten Planeten der Sonne Morimbeau, 12456 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Die ersten menschlichen Siedler auf Keduan hingen dem Parombor-Kult an, was den Planeten kulturell nachhaltig prägte und zu manchen Besonderheiten führte. So ist jegliche Fortbewegung mit Hilfe von Maschinen aus rituellen Gründen untersagt. Lediglich für den Raumhafen PORT KEDUAN gilt eine Ausnahme. Keduans Atmosphäre ist erdähnlich. Der Planet ist wasserarm. Der Großteil seiner Landfläche wird durch Wüsten bedeckt. MARAGUI: Bezeichnung für die humanoiden, blauhäutigen Ureinwohner Keduans. Es wird allgemein vermutet, dass sie keineswegs vom Planeten Keduan stammen, sondern Abkömmlinge einer bisher historisch nicht erwiesenen menschlichen Einwanderung sind, die nach ihrer Landung auf ein archaisches Kulturniveau herabsanken. Gen-Tests, die die Herkunft der Maragui einwandfrei erweisen könnten, werden von diesen mit Hinweis auf die informationelle Selbstbestimmung verweigert. Aus religiösen Gründen lassen sie niemals DNA-haltige Körpersubstanzen zurück. Nach Gefechten setzen sie alles daran, ihre Toten zu bergen und vollständig zu zerlasern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo Zybell, Alfred Bekker
Inhaltsverzeichnis
Science Fiction Doppelband 2006
Copyright
Lennox und der Blick in die Vergangenheit Das Zeitalter des Kometen #5
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KEDUAN - PLANET DER DRACHEN
Science Fiction Doppelband 2006
Jo Zybell, Alfred Bekker
Dieser Band enthält folgende Romane:
Lennox und der Blick in die Vergangenheit (Jo Zybell)
Keduan - Planet der Drachen (Alfred Bekker)
KEDUAN: Trivialname für den vierten Planeten der Sonne Morimbeau, 12456 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt. Die ersten menschlichen Siedler auf Keduan hingen dem Parombor-Kult an, was den Planeten kulturell nachhaltig prägte und zu manchen Besonderheiten führte. So ist jegliche Fortbewegung mit Hilfe von Maschinen aus rituellen Gründen untersagt. Lediglich für den Raumhafen PORT KEDUAN gilt eine Ausnahme. Keduans Atmosphäre ist erdähnlich. Der Planet ist wasserarm. Der Großteil seiner Landfläche wird durch Wüsten bedeckt.
MARAGUI: Bezeichnung für die humanoiden, blauhäutigen Ureinwohner Keduans. Es wird allgemein vermutet, dass sie keineswegs vom Planeten Keduan stammen, sondern Abkömmlinge einer bisher historisch nicht erwiesenen menschlichen Einwanderung sind, die nach ihrer Landung auf ein archaisches Kulturniveau herabsanken. Gen-Tests, die die Herkunft der Maragui einwandfrei erweisen könnten, werden von diesen mit Hinweis auf die informationelle Selbstbestimmung verweigert. Aus religiösen Gründen lassen sie niemals DNA-haltige Körpersubstanzen zurück. Nach Gefechten setzen sie alles daran, ihre Toten zu bergen und vollständig zu zerlasern.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Lennox und der Blick in die Vergangenheit Das Zeitalter des Kometen #5
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 146 Taschenbuchseiten.
Auf der Erde hat ein Kometeneinschlag die Zivilisation vernichtet. Tim Lennox und seine Gefährten müssen um ihr Überleben kämpfen.
Tim Lennox und Marrela wollen nach London, um dort möglicherweise Überlebende der großen Katastrophe zu finden, die unterirdisch leben. Auf dem Weg dorthin treffen sie auf andere Überlebende.
In der Vergangenheit, unmittelbar vor dem Einschlag des Kometen, hatte es sich ein Historiker zur Aufgabe gemacht, all das aufzuzeichnen, was er für würdig hielt, der Nachwelt überliefert zu werden.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https//twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https//cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
London, 18. November, 2011
Scheinwerferlicht tauchte das Bild in grelles Licht. Richard Jagger trat näher an die Kopie des Wandgemäldes heran. Auf der obersten Stufe Figuren in Umhängen, Jaguarfellen und mit exotischen Kopfbedeckungen – Federn, Tierköpfe und unheimliche, fast dämonisch wirkende Masken. Auf den beiden Stufen darunter etwa ein Dutzend halbnackte Menschen, sitzend oder kniend. Viel mehr als einen Lendenschurz trugen die meisten nicht. Einer, ganz links, warf zwei Bälle in die Luft. Ein uraltes Bild. Weit über tausend Jahre alt.
Richard Jagger führte das Diktiergerät zum Mund: „Sehen Sie den Ballspieler ganz links auf der untersten Stufe, Ladies und Gentlemen? Schauen Sie, wie leichthändig er die Bälle wirft. Wirkt er nicht gelöst, fast heiter? Dabei war er eben noch ein Todeskandidat. Ja – Sie hören richtig, Ladies und Gentlemen: Ein Todeskandidat!“
Leise Musik erfüllte den Ausstellungsraum. Alte Musik. Nicht ganz so alt wie das maßstabsgetreu kopierte Wandgemälde aus dem neunten nachchristlichen Jahrhundert mit dem knienden Maya-Ballspieler. Aber alt genug, um nur noch von Liebhabern wie Jagger gehört zu werden. „She’s a rainbow“ von den Rolling Stones. zu den Musikern gehörter ein entfernter Verwandter Richard Jaggers.
„Einer von sechs bis acht Spielern, die in zwei Mannschaften gegeneinander angetreten waren. Eine Mannschaft hat das Spiel verloren und die Niederlage mit dem Leben bezahlt. Der Mann, den Sie hier auf dem Bild sehen, Ladies und Gentleman – er gehörte zu den Siegern. Man sieht es ihm an, oder?“
Ein Bild aus einer Reihe von Exponaten, die Jagger aus zahlreichen Museen der Welt zusammengetragen hatte. Oder noch zusammentragen würde. Siebenhundert-fünfundachtzig ganz genau. Skulpturen, Tücher, Wandteppiche, Keramiken, Fotografien, Modelle von Pyramiden und Festungsanlagen, Dokumente der spanischen Eroberer, und so weiter und so weiter.
Jagger sprach den Text in sein Diktiergerät, den die Besucher der Ausstellung später aus den Lautsprechern hören würden, wenn sie vor dem Bild standen. Oder über Kopfhörer in ihrer eigenen Sprache, falls sie Ausländer waren. Später. Am elften Februar des kommenden Jahres. An diesem Samstag sollte die Ausstellung eröffnet werden. Genug Zeit, die noch fehlenden Ausstellungsstücke aus den verschiedenen Metropolen herbeizuschaffen. Genug Zeit, dem Ausstellungskonzept den letzten Schliff zu verpassen. Genug Zeit für Texte, Übersetzungen und Öffentlichkeitsarbeit. Und vor allem für das Buch, an dem Richard Jagger seit dem Sommer arbeitete. Fast drei Monate Zeit noch.
„Vielleicht wissen Sie, Ladies und Gentleman, dass der Sport bei den Griechen und Etruskern seine Wurzeln in religiösen Kulthandlungen hatte. Genauso verhält es sich bei den mesoamerikanischen Hochkulturen …“
„Spuren im Sand“ hieß die Ausstellung. Ein etwas reißerischer Titel, wie Jagger fand. Es ging um untergegangene Zivilisationen. Um die Mayas, Tolteken und Azteken, um genau zu sein. Untergegangene Kulturen waren im Trend. Seit dem Sommer. Seit dieser Komet nicht mehr aus den Schlagzeilen weichen wollte.
Das Britische Museum hatte Richard Jagger einen Zweijahresvertrag für dieses Projekt gegeben. Der promovierte Historiker und Kunstgeschichtler betrachtete den Job als Sprungbrett. Ein Buch hatte er bereits veröffentlicht. Seine Arbeit über die nordamerikanischen Indianer hatte international Beachtung gefunden. Im Sommer nächsten Jahres wollte er seine Forschungsergebnisse über die Mayas veröffentlichen. Jagger zweifelte nicht daran, dass ihn dieser zweite Wurf an das vorläufige Ziel seiner vorläufigen Träume bringen würde: Auf einen Lehrstuhl in Cambridge.
„… besonders die Mayas pflegten das Ballspiel.“ Jagger drückte die Pausentaste. Er drehte sich zu dem Klapptisch hinter sich um, auf dem er seine Unterlagen ausgebreitet hatte. Eine kleine, tragbare Stereoanlage stand dort inmitten von Papieren, Kaffeebecher, Stiften und Disc-Hüllen und einem über die Tischecke gehängten Mantel. Jagger wechselte die Mini-Disc. Wilde Rhythmen aus Zeiten vor seiner Geburt ertönten: „Jumping Jack Flash“.
Er richtete sich auf, löste den Pausenknopf seines Diktiergerätes und konzentrierte sich wieder auf das Bild. „Eine Mannschaft bestand aus drei bis fünf Spielern. Der vier Kilo schwere Ball war aus Naturkautschuk. Er durfte weder mit Händen noch mit Füßen berührt werden …“ Seine Hüften wiegten sich im Rhythmus der Musik. Jagger arbeitete am besten mit Musik. Schon als Schüler hatte er sich während der Hausaufgaben immer die Kopfhörer übergestülpt. „… allein durch ihre Körperarbeit versuchten die Spieler den Ball im Flug zu halten. Durch den fliegenden Ball sollte der Lauf der Sonne symbolisiert werden.“
Ursprünglich wollte die Museumsdirektion die Ausstellung auf die Mexican Gallery beschränken, eine relativ kleine Abteilung im Zentrum des Britischen Museums. Jagger hatte eine nicht unerhebliche Erweiterung der Ausstellung durchgesetzt. Tatsächlich wurden ihm Räume der angrenzenden Münzsammlung und der British Library zur Verfügung gestellt. Sogar das zentrale Kuppelgebäude des Lesesaals der British Library hatte ihm die Museumsleitung schließlich bewilligt. Dort wollte Jagger die zahlreichen Dokument der spanischen Eroberer ausstellen.
„Fiel der Ball zu Boden, so hieß das: Der Lauf der Sonne ist unterbrochen. Er konnte nach Vorstellung der Mayas nur dadurch wieder in Gang gesetzt werden, dass die Mannschaft, die den Ball hatte fallen lassen, ihn treffsicher durch einen Steinring schleuderte.“
„Sympathy for the devil“, der Historiker drehte sich im Kreis, legte ein paar Tanzschritte hin und schnippte rhythmisch mit den Fingern, bevor er weiter diktierte. Die Musik ging ihm ins Blut. Richard Jagger war alles andere als ein leidenschaftsloser Erbsenzähler. Auch seine Wissenschaft betrieb er mit Haut und Haaren.
„Wenn der Werfer den Steinring verfehlte, hatte seine Mannschaft verloren. Und wurde dem Sonnengott geopfert, um ihn durch ihr Blut wieder zu stärken.“ Jagger schüttelte sich. Für Sekunden glaubte er zu fühlen, was diese Ballspieler vor über elfhundert Jahren gefühlt hatten – ihre fast schmerzhafte Anspannung, den stillen Ernst, mit dem sie das Spielfeld betraten, die äußerste Konzentration, mit der sie den schweren Ball im Auge behielten, und den eisigen Schauer, wenn sie den Ball verfehlten, wenn die Kautschuk-Kugel auf den Boden prallte.
Kein Ball mehr in diesem Augenblick – sondern ein Himmelskörper, die abgestürzte Sonne. Eine Sonne war auf die Erde gestürzt – und sie hatten die Schuld!
„Uuh“, seufzte Jagger. Wieder schüttelte er sich. „Stellen Sie sich ein Champions League Finale vor, Ladies und Gentleman, stellen Sie sich vor, es kommt zum Elfmeterschießen, und stellen Sie sich vor, Archer Lionel verschießt den Elfer und Arsenal London verliert das Finale!“
Lionel war zu jener Zeit der absolute Fußballstar in Großbritannien. „Und stellen Sie sich vor, man würde ihn nach dem Spiel in die Westminster Abbey bringen, ihn dort an den Altar führen und ihm das Herz aus der Brust …“ Eine Vibration über seinem Herzen kühlte seine überschäumende Phantasie ab. Er zog sein Telefon aus der Brusttasche des Hemdes. „Jagger?“
„Wann kommst du, Richie?“ Die Stimme seiner Frau. Dünn und ein wenig heiser. Die Sache mit dem Kometen nahm Liz mehr mit, als es nach Jaggers Meinung gesund war. Alle paar Jahrzehnte zog so ein Dreckklumpen an der guten alten Erde vorbei. Und alle paar Jahrzehnte schrien die Boulevardpresse und ein paar Fernsehsender: „Apocalypse now!“ Und rieben sich heimlich die Hände wenn Auflagen und Einschaltquoten stiegen.
„Bin unterwegs!“ Jagger sah auf die Uhr. „Hey, Baby – schon nach halb zehn! Jemand muss die Stunden verkürzt haben! Wahrscheinlich dieser ulkige Komet.“
„Mach dich nicht lustig, Richie.“ Liz’ Stimme klang jetzt trotzig und vorwurfsvoll. „In den Abendnachrichten hieß es, er wird mit der Erde kollidieren. Mit einer Wahrscheinlichkeit von einundachtzig Prozent …“
„Was für einen Sender hast denn gesehen, Baby?“ Er tat heiterer, als ihm plötzlich zumute war.
Liz ging nicht drauf ein. „Wann kommst du?“
„Ich mach Schluss für heute. In einer halben Stunde bin ich zu Hause.“
„Viel zu spät“, nörgelte sie. „Die Kinder schlafen schon.“
„John auch?“, fragte Jagger verwundert. Der neunjährige John war das älteste seiner drei Kinder. „Morgen ist doch Samstag!“
„Er hat sich nach den Abendnachrichten ins Bett verzogen.“ Unsicher klang Liz jetzt. „Was hätte ich ihm sagen sollen?“
Jagger schluckte. „Bin schon unterwegs.“ Er klemmte das Telefon in seiner Hemdtasche fest, bückte sich und drückte die Stopptaste des Minidisc-Players. Hastig räumte er seine Unterlagen zusammen, legte sie in seinen Aluminiumkoffer und schlüpfte in seinen schwarzen Trenchcoat. Seine gute Stimmung war plötzlich dahin. Die Worte seiner Frau hallten in seinem Hirn nach. Mit einer Wahrscheinlichkeit von einundachtzig Prozent … Er versuchte nicht daran zu denken.
Durch den Mittelraum der British Library lief er zur Treppe. Ein kniehohes Podest nahm einen Großteil des Raumes ein – weiß, leer, und fast zwanzig Quadratmeter groß. Auf ihm wollte Jagger mit seinen Studenten im Laufe des Monats ein Bauwerk der Mayas errichten. Die Pyramide von Chichén Itzá. Im Maßstab eins zu fünf.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von einundachtzig Prozent …
Sein Schritt stockte, als er an großen Wandtafeln am Ende des Raumes vorbeikam. Teilweise fertige Abbildungen des Maya-Jahreslaufes. Die achtzehn Monatszeichen des Sonnenjahres konnte man schon bewundern. Auch der Maya-Kalender kannte ein Jahr mit dreihundertfünfundsechzig Tagen. Und war genauer als der Gregorianische Kalender. Sogar die Umlaufzeit der Venus hatten sie berechnet. Mit einer Fehlerquote von nur 14 Sekunden! Genauer als einst Galilei. Kein Forscher konnte erklären, wie sie das angestellt hatten.
Jagger riss seinen Blick von den Abbildungen los und lief zur Haupttreppe. Das Museum war menschenleer. Auf dem Weg hinunter ins Erdgeschoss fiel ihm ein Aufsatz ein, den er vor ein paar Tagen in einem kulturhistorischen Standardwerk gelesen hatte. Nach ihm hatten die Mayas ihren Kalender auf viele hundert Jahre im Voraus berechnet. Bis zum Jahre 2012 ganz genau.
Hab ich das Buch wieder in die Bibliothek gebracht? Vorbei an Glasvitrinen mit Münzen und Medaillen strebte er dem Ausgang zu. Egal, nur eine Theorie, nur Zufall!
Er schloss den Haupteingang auf, trat hinaus unter das mächtige Säulenportal und schloss hinter sich ab. Es war dunkel und kalt. Regen klatschte auf die Vortreppe. Wenig Verkehr auf der Great Russel Street. Den Koffer schützend über dem Kopf rannte er über die Straße und eilte im Laufschritt die Museum Street hinunter. Am Ende der kurzen Straße lag links St. Georgs Bloomsbury, und gegenüber der Kirche ein Parkhaus.
Sirenen näherten sich, als Jagger das Parkhaus betrat. Und kurz darauf, als er in seinen Toyota Van stieg, donnerte ein Helikopter über das Parkhaus hinweg.
Er steuerte den Wagen über das Deck die Rampe hinunter und dann auf die Straße hinaus. Über die Theobalds Road fuhr er Richtung Westen. Der Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe. Eine merkwürdige Stimmung schien über der Stadt zu liegen.
Wieder näherten sich Sirenen, er ging vom Gas, Blaulichtgefunkel im Rückspiegel, er fuhr an den Straßenrand. Ein Löschzug der Feuerwehr überholte ihn. Vier Fahrzeuge. Zwei Rettungswagen folgten. Wahrscheinlich ein Unfall irgendwo. Vielleicht auch ein Brand. Hoffentlich nicht auf seiner Strecke.
Jagger fuhr weiter. Die Grays Inn Gardens zogen rechts an ihm vorbei. Eigenartig viele Menschen auf dem abendlichen Bürgersteig. Sie bewegten sich hektisch, als wären sie auf dem Weg ins Büro.
Dann die Kreuzung Grays Inn Road, die Ampel sprang gerade auf Grün. Hinein in die Clerkenwell Road. Der Verkehr wurde dichter. Ungewöhnlich dicht für die Tageszeit. Ein Blick auf die Borduhr: Zweiundzwanzig Uhr. Jagger schaltete das Autoradio ein: „Die neuesten Erkenntnisse über die Flugbahn des Kometen Alexander-Jonathan haben in vielen europäischen Großstädten Massenpaniken ausgelöst. Angeblich soll der Komet mit hoher Wahrscheinlichkeit nun doch mit der Erde kollidieren …“
Jagger ging vom Gas und drehte lauter.
„Aus Paris, Hamburg und Warschau melden die großen Kliniken einen springflutartigen Anstieg der Selbstmordrate. In Rom und Wien kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen meist jugendlichen Randalierern und Sicherheitskräften. Vor dem Reichstag in Berlin haben sich Hunderttausende versammelt und verlangen den Kanzler und den Innenminister zu sprechen. In London …“
Plötzlich Rücklichter direkt vor ihm. Jagger trat auf die Bremse. Menschen rannten links und rechts an ihm vorbei. Verwirrt blickte er nach beiden Seiten. Ihm fiel auf, dass es keinen Gegenverkehr mehr gab. Er stieg aus. Wieder das Gehämmer von Rotoren im Nachthimmel. Er schaute nach oben – drei, vier Positionslichter von Helikoptern schwebten heran. Grelle Scheinwerferkegel strichen über Dächer und Straßen. Und dann hörte Jagger den Lärm!
Er kam aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung – Geschrei, viele Schritte, Glas klirrte, Schüsse peitschten über die Clerkenwell Road. Die Wagentüren in den Fahrzeugen vor seinem Van sprangen auf. Männer und Frauen stiegen aus, hielten sich an der oberen Türkante fest und starrten an der Autoschlange entlang dem Geschrei entgegen.
Es näherte sich rasch. Jagger erkannte Menschen. Viele Menschen, hunderte, tausende. Ihre Schuhsohlen klangen wie Trommelschläge auf dem Asphalt. Gebrüll wie im Fußballstadion. Dazwischen dröhnende Stimmen, blechern und leicht verzerrt, wie aus Polizeilautsprechern. Wieder Schüsse, wieder Glasbruch.
Auf die Kühlerhaube des Mercedes drei Wagen vor Jaggers Van knallte ein Stein. Schlagartig zogen sich die Autofahrer in ihre Fahrzeuge zurück. Ohne nachzudenken hechtete auch Jagger wieder hinters Steuer. Motoren heulten auf, Reifen quietschten. Fast gleichzeitig versuchten Dutzende von Fahrzeugen aus der Blechschlange auszuscheren und zu wenden. Die Wagen behinderten sich gegenseitig. Vor und hinter Jagger kollidierten Autos. Drei heranrasende Mannschaftswagen der Polizei versperrten zusätzlich den Weg. Sie hielten mit schreienden Reifen und spuckten Sicherheitskräfte in Kampfanzügen, mit Helmen, Schutzschildern und Gummiknüppeln aus. Jagger erkannte Gewehre in den Händen einiger.
Er hielt den Atem an, sein Hirn war wie leergefegt, er merkte kaum, wie er um sich griff, um den Wagen zu verriegeln. Plötzlich sah er, wie eine Menschentraube sich um die Fahrzeuge vor seinem Van bildeten. Vorschlaghämmer und Baseballschläger erschienen über teilweise verhüllten Gesichtern. Windschutzscheiben splitterten. Fahrer und Beifahrer wurden herausgezerrt, verprügelt und auf den Gehsteig gestoßen. Die Menge schaukelte den Mercedes hin und her, bis er umstürzte.
Jagger griff nach seinem Koffer und sprang aus dem Wagen. Schüsse fielen, Polizisten schrien: „Seien Sie vernünftig! Gehen Sie nach Hause! Geben Sie auf! Wir schießen scharf!“
Jagger sah Gummiknüppel durch die Luft sausen, hörte Aufschläge, hörte Schmerzensschreie, hörte Schüsse. Nur weg hier, weg! Ein einziger Gedanke jagte durch seine Hirnwindungen, durch seine Glieder. Weg, weg, weg!
Vor ihm stürzte sich die Menschenmenge auf die Männer in Kampfanzügen. Arme legten sich von hinten unter Jaggers Kinn und rissen ihn auf den Asphalt herunter. Jemand wollte ihm seinen Koffer entreißen. Er hielt ihn fest, als würde er sein Leben bedeuten. Ein zweiter Mann kniete plötzlich auf seiner Brust. Ein junger Bursche mit kahlem Schädel. Beiläufig registrierte Jagger das Tattoo auf seiner Glatze – ein Ziegenbock-Gesicht – und seinen schmierigen Overall. Beiläufig registrierte er den Benzingeruch, der von dem Mann ausging.
„Was bist du für einer?“, schrie der Kerl. Er fletschte die Zähne wie ein Hund. Hass stand in seinen Augen. Hass und Angst. Jagger riss seinen Koffer zu sich heran. Eine Schuhspitze traf ihn an der Schulter. Er spürte es kaum.
„Was bist du für einer?“ Der Kerl auf seiner Brust packte die Kragenaufschläge seines Trenchcoats und schüttelte ihn. Überall Gebrüll, überall knallten Schlagstöcke auf Körper. „Hast du einen Bunkerplatz? He? He? Hast du einen? Sag es! Gib es zu!“
Eine Hitzewelle fauchte Jagger von links hinten über das Gesicht. Es stank plötzlich nach Öl und Ruß. Der Zug an seinem Koffer ließ von einer Sekunde zur anderen nach. „Von was redest du?“, schrie Jagger. „Was quatscht du da, du verdammter Idiot?“ Er rammte dem Burschen den Koffer ins Gesicht. Einmal, zweimal, immer wieder. Der Mann rollte sich von ihm herunter.
Jagger sprang auf. Sein Atem flog keuchend. Das Herz schien ihm in der Kehle zu flattern. Er suchte seinen Wagen und blickte auf einen Unterboden. Flammen schlugen aus dem umgestürzten Van. Auch der Mercedes brannte, andere Wagen ebenfalls. Schüsse peitschten. Steine flogen. Jagger duckte sich, presste den Koffer gegen die Brust und rannte los. Die Clerkenwell Road zurück bis zum Grays Inn Garden, hinein in den Park, durch den südlichen Ausgang hinaus bis zum High Holborn.
Drei Stunden irrte er durch die City. Vermied große Straßen und Plätze, vermied das Themseufer und die Nähe öffentlicher Gebäude. Aus allen Richtungen hörte er Geschrei, Sirenen und Schüsse. Und immer wieder Helikopter.
Es war, als wäre ein Damm gebrochen. Auch in ihm selbst. Natürlich hatte Jagger die Nachrichten über den nahenden Kometen verfolgt. Seit dem Sommer, seit dem 25. August. Aber sich keine übermäßigen Sorgen gemacht. Die Hoffnung hatte sein Urteil getrübt. Der Wunsch, dass alles beim Alten bleiben möge. Jetzt sah er klar. Schmerzhaft klar. Und die böse Wahrheit hatte die Stadt getroffen wie der Faustschlag eines Gottes. Wie der Vorschatten des Kometen.
Kurz nach eins erreichte er endlich Spitalfield und die Artillery Row. Die kleine Straße an der Liverpool Street Station, in der sein Einfamilienhaus stand. Der flache Klinkerbau erschien ihm wie das Haus eines Fremden.
Er wankte über den kurzen Weg durch den Vorgarten und schloss die Haustür auf. Alles so fremd, alles so anders. Licht brannte im Wohnzimmer und im Flur. Er drehte sich um, bevor er die Haustür schloss. Auch in den Häusern auf der anderen Straßenseite Licht hinter den Fenstern. In jedem Haus. Schlief denn noch niemand in dieser Nacht?
Dann die Stimme seiner Frau: „Ja – Gott weiß es … ja, Gott kennt die Zukunft …“ Sie telefonierte.
Jagger sah sie an wie eine Fremde. War das seine Frau? Blass sah Liz aus. Ringe lagen unter ihren Augen. Schweißverklebte, blonde Haarsträhnen klebten auf ihrer Stirn. Jagger hatte sie nur selten das Wort Gott in den Mund nehmen hören.
Den Aluminiumkoffer in der Hand blieb er an der Haustür stehen und sah sie an. Ihre Blicke trafen sich für einen Moment. Sie wandte sich ab. „Dich auch, Francis, Gott segne dich auch.“ Sie legte auf und wandte sich zu ihm um. „Wo warst du?“
„Mit wem hast du telefoniert?“ Jagger stellte den Koffer ab. Er spürte, wie seine Knie zitterten.
„Mit Freunden.“
„Mit was für Freunden?“
„Mit guten.“
„Ich kenn’ sie also nicht.“ Liz antwortete nicht. Sie kam auf ihn zu und umarmte ihn. „Ich kenne sie also nicht“, wiederholte er.
„O Gott, Richie“, flüsterte sie. „Es ist vorbei. Ich glaub, es ist vorbei.“ Sie löste sich von ihm und hob den Kopf. „In drei Monaten, sagen sie, ist es vorbei.“ Ihre Augen waren die Augen einer Fieberkranken. Und einer Fremden.
„Unsinn, Liz!“ Seine Stimme vibrierte, und das erschreckte ihn. „In drei Monaten kann noch viel passieren.“ Er küsste sie flüchtig auf die Stirn und ging zur Tür des Kinderzimmers seiner beiden Jüngsten.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von einundachtzig Prozent …
Leise drückte er die Klinke hinunter. Linda schlief in ihrem Gitterbett. Wie ein kleiner Engel lag sie da, die Vierjährige. Wusste von nichts, ahnte nichts, schlief selig und tief. Jaggers Herz krampfte sich zusammen, während er ihr stupsnasiges Profil in den Kissen betrachtete.
Er wandte sich dem Hochbett an der gegenüberliegenden Wand zu. Das Bett seines Zweitgeborenen. Percy. Der Siebenjährige stöhnte im Schlaf auf. Er träumte. In letzter Zeit träumte er oft. Jagger nahm an, dass er die Anspannung mitbekam, unter der seine Mutter stand.
Percy sah Liz ähnlich – mit seinen blonden, glatten Haaren, mit seinem schmalen, feinem Gesicht. Er hatte sich freigestrampelt. Jagger deckte ihn zu. „Mein Söhnchen“, flüsterte er. „Mein kleines Söhnchen.“ Eine Träne lief ihm über das Gesicht. Er spürte sie und erschrak. Was ist los mit dir? Glaubst du jetzt auch schon an das Ende?
Auf Zehenspitzen verließ er das Zimmer. Leise schloss er die Tür. Liz lehnte neben dem Telefontisch an der Wand. Die Augen geschlossen, den Kopf in den Nacken gelegt. Wie ein Gespenst sah sie aus.
Jagger lauschte an der Tür zum Zimmer seines Ältesten. Nichts zu hören. Vorsichtig drückte er die Klinke hinunter und spähte hinein. Ein regloser Schatten ragte aus dem Bett. Jagger knipste das Licht an. John saß auf seinem Kissen und starrte vor sich hin. Er hatte schwarze Locken und ein rundes, weiches Gesicht. Genau wie sein Vater.
„Johnny?“, flüsterte Jagger. Der Junge rührte sich nicht. Jagger ging zu ihm und setzte sich neben ihn aufs Bett. „Kannst du nicht schlafen, Johnny?“
Der Neunjährige wandte ihm sein Gesicht zu. Große Augen sahen ihn an. Braune Augen. Auch die hatte der Junge von ihm. Liz, Linda und Percy hatten blaue Augen. Die Trauer in den Augen seines Sohnes schnürte Jagger die Kehle zu.
„Kommst du jetzt erst von der Arbeit?“, flüsterte John.
„Wie kommst du denn darauf?“ Jagger versuchte zu lächeln. Er war sich unsicher, ob sein Sohn tatsächlich wach war oder nur in einer Art Wachtraum mit ihm sprach.
„Warum schwindelst du – du hast deinen Mantel noch an … und du riechst nach Benzin und Ruß.“
„Komm, leg dich hin und schlaf.“ Jagger wollte ihn sanft in das Kissen hinunterdrücken.
Der Junge wehrte seinen Arm ab. „Ich kann mir schon vorstellen, nicht mehr zur Schule zu müssen – aber werden wir noch Fußball spielen können? Wird es noch Straßen geben, auf denen wir hinauf nach Schottland in den Urlaub fahren können?“
Ein stachliger Kloß schwoll in Jagger Hals. Er schluckte und schluckte wieder. Der Kloß wurde nur noch größer. „Was redest du da? Du träumst ja, komm – leg dich hin.“
„Ich überleg’ mir die ganze Zeit, was ich mit drei Monaten anfange“, sagte der Junge nachdenklich.
„Wie? Ich verstehe nicht …“ Jagger verstand genau.
Johnny sah ihn überrascht an. „Wir haben nur noch drei Monate Zeit, Dad. Nicht mal – weißt du das nicht? Da muss man gut überlegen, wie man sie verbringt. In den Nachrichten haben sie gesagt, dass fast alle Menschen sterben werden, wenn er kommt.“
„So ein Unsinn!“ Jagger versuchte zu lachen. Es klang wie das krächzende Stöhnen eines Kranken. Die Worte des Neunjährigen hatten sich tief in sein Herz gebohrt. „Komm, leg dich hin und schlaf.“ Er wollte seinen Sohn an sich drücken, um ihm einen Gute-Nacht-Kuss zu geben. Doch Johns Körper widerstand ihm. Starr wie Stein fühlte er sich an.
Später lag Jagger in seinem Bett und starrte in die Dunkelheit. Seine Frau neben ihm warf sich unruhig hin und her. Gedanken, Bilder und Gefühle jagten einander durch seine Hirnwindungen. Nicht mal drei Monate Zeit … Mit einer Wahrscheinlichkeit von einundachtzig Prozent … Was fang ich mit drei Monaten an? Eine Ausstellung über untergegangene Kulturen auf die Beine stellen?
Der Titel der Ausstellung kam ihm plötzlich zynisch vor – Spuren im Sand!
2
Südost-England, Mitte September 2516
Die feuchte Hitze trieb Tim den Schweiß aus den Poren. Dichter Dunst hing über dem Unterholz zwischen den Baumstämmen. Der Regen hatte aufgehört. Fast vermisste Tim das monotone Trommeln der Tropfen auf dem Blätterdach des Laubwaldes. In den zurückliegenden drei Tagen hatte die Geräuschkulisse etwas Beruhigendes gehabt. Eine wohltuende Geräuschkulisse. Wohltuend für Tims und Marrelas aufgepeitschte Nerven.
Die halsbrecherische Tunneldurchquerung hatte gewaltig an ihren Kraftreserven gezehrt – weiß Gott! Tim konnte sich kaum erklären, wie seine bleischweren Beine ihn zwei Tage lang durch den verregneten, sumpfigen Wald getragen hatten. Von den unbewohnten Ruinen Folkestones bis hierher in die sanften Hügelhänge seitlich der zugewucherten Autobahntrasse. Marrela war es nicht anders gegangen. Halb betäubt war sie zum Schluss hinter ihm her gewankt.
Anders als Tim schien sie sich nicht recht erholt zu haben, während der zurückliegenden drei Rasttage. Sie schlief unruhig, redete wenig, und wirkte vollkommen erschöpft. Tim machte sich Sorgen um seine Partnerin.
Er hatte die Geographie der Grafschaft Kent – der ehemaligen Grafschaft Kent! – nur undeutlich im Kopf. Tim schätzte, dass es die M 20 war, deren Überresten sie gefolgt waren. Vielleicht auch die M 2. Und er schätzte, dass sie knapp die Hälfte der Strecke Folkestone – London zurückgelegt hatten. Es mussten also noch etwa vierzig oder fünfzig Kilometer zur Hauptstadt des Empires sein. Zur ehemaligen Hauptstadt des ehemaligen Empires.
Er richtete sich auf und schälte sich aus seinem Pilotenanzug. Seine Haut war feucht. Vom Schweiß, nicht vom Regen der vergangenen Tage. Sie hatten sich einen Unterschlupf gebaut, zwei lange Astgabeln, etwa anderthalb Meter lang – tief in den feuchten Boden gerammt, verbunden mit einem geraden Querstock, und viele lange Äste jeder Stärke und gut vier Meter lang vom Querstock aus in den Waldboden gesteckt. Das Dach abgedichtet mit zig Lagen der riesigen Ahornblätter und mit Moos beschwert – ein halbes Zelt war fertig. Kein Problem für einen Kampfflieger der US-Airforce. Für einen ehemaligen Kampfflieger der ehemaligen Airforce. Und für eine Nomadin erst recht nicht.
Tim stand auf und hängte den klammen Anzug an das Dach des Unterschlupfs. Er brummte missmutig, als er den ehemals olivgrünen Stoff betrachtete – schmierig und verdreckt von oben bis unten. Wurde höchste Zeit, dass sie einen See oder einen Fluss erreichten. Wie lange war es eigentlich her, dass er praktizierender Anhänger zivilisierter Hygienevorstellungen gewesen war? Tatsächlich erst sieben Monate? Oder doch schon 504 Jahre?
Tim grinste in sich hinein und streckte seinen halbnackten Körper unter dem Naturzeltdach aus. „Und dann, liebe Kinder, gingen wir nach London“, murmelte er feixend. „Ich musste nämlich dringend meine Klamotten waschen, und in London gibt es doch diesen Fluss, wie heißt er gleich?“
Seine Miene verfinsterte sich. „Vielleicht gibt es ihn auch nicht mehr“, knurrte er. Die Phantasie, er würde eines Tages seinen Nachkommen von seinen Abenteuern erzählen, löste sich in Nichts auf. „Kinder in diese Wahnsinnswelt setzen“, er seufzte tief, „so was Verrücktes, Commander Lennox. Hast du das Inventar deiner bürgerlichen Träume noch immer nicht ausgemistet?“
Es raschelte im Unterholz. Tim richtete sich auf. Weiter als fünf Schritte konnte er nicht sehen. Wie feiner Schleier hing der Dunst im fast mannshohen Gebüsch zwischen den Baumstämmen und in den weiten Kronen der Mammut-Ahornbäume. Tim konnte sich nicht erinnern, je in seinem Leben – in seinem früheren Leben – derart ausgedehnte Ahornwälder gesehen zu haben.
Ein Busch spaltete sich, Marrela erschien neben einem Baumstamm. Wieder fielen ihm ihre hängenden Schultern und ihre leicht gebeugte Haltung auf. Himmel! Wie müde sie aussah!
In ihrer Rechten ein großes Ahornblatt, auf dem sich schwarzblaue Beeren häuften. „Ich habe Brabeelen-Hecken gefunden.“
Fast zwei Stunden war Marrela unterwegs gewesen. Sie hatte die Überreste eines Kamaulers entsorgt. Am Abend nach ihrer Flucht von der Küste weg ins Landesinnere hatten sie das Tier erlegt und seitdem davon gelebt. Von seinem rohen, nur mit ein paar Kräutern gewürzten Fleisch. An Feuer war nicht zu denken gewesen bei dem Regen und nassen Holz. In der vergangenen Nacht hatte der Kadaver des restlichen Kamaulers zu stinken begonnen.
„Brabeelen?“ Tim kroch aus dem Unterschlupf und stand auf. Das, was Marrela ihm entgegenstreckte, erinnerte ihn an Brombeeren. Pflaumengroße Brombeeren allerdings.
Sie ließen sich vor dem Unterschlupf nieder und aßen. Saftig waren sie, die Brabeelen, und sie schmeckten säuerlich. Und machten Lust auf mehr.
„Wir sollten uns noch ein paar Hände voll davon holen“, sagte Tim. „Wer weiß, wann wir wieder auf essbares Wild stoßen.“ Er blickte nach oben in die Baumkronen. Das Blätterdach war so dicht und hing so voller Dunst, dass kaum ein Stück Himmel zu sehen war. Tim hörte keine Regentropfen ins Laub klatschen. „Es regnet schon seit dem Morgen nicht mehr. Wir brechen auf.“
Marrela seufzte und lehnte sich an ihn. „Ich will nicht.“
„Du willst nicht?“ Tim nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und sah sie an. Ihre Augen wirkten matt. Ein wenig traurig fast. Das energische Lodern, das er so liebte an diesen Augen, hatte sich aus ihnen zurückgezogen. „Hey, mein Mädchen! Deine Lebensgeister machen wohl ein Nickerchen! Was schlägst du denn vor?“
Sie schlang ihre Arme um seinen nackten Oberkörper. „Meine Seele ist müde, mein Freund. Sehr müde. All das Kämpfen, all die Gefahren – was habe ich nicht erlebt, seit ich an deiner Seite gehe?“
Ein typisches Stresssyndrom, dachte Tim. Sie ist fix und fertig. Er küsste sie auf die Augen. „Was schlägst du vor, mein müdes Mädchen?“
„Lass uns hierbleiben, Tinnox. Wir roden ein Stück Wald, wir bauen uns eine Hütte, wir jagen und fischen.“ Ihr großer Mund saugte sich an seinem Hals fest.
„Urlaub also“, brummte Tim. Er versuchte zu verstehen, was seine Gefährtin bewegte. „Und wie lange?“
„Was ist Urlaub?“ Neugierig sah Marrela auf.
Wenigstens war sie noch neugierig. Eine ihrer hervorstechendsten Charaktermerkmale. Neben ihrer Hartnäckigkeit. „So hat man in meiner Welt eine Zeit genannt, in der man sich ausruht, statt zu arbeiten.“
„Nicht arbeiten?“ Marrela lächelte müde. „Nicht jagen, nicht fischen, nicht wandern, nicht kämpfen? Wenn man tot ist, kann man aufhören damit. Wenn man in Wudans Armen ruht. Vorher ist das viel zu gefährlich – man verhungert doch.“
„Nicht, wenn man ein gut gefülltes Bankkonto hat.“
„Ein was?“
„Eine Art Vorratshöhle.“ Tim drückte ihren Kopf an seine Brust und streichelte ihr dichtes Haar. Es fühlte sich drahtig und feucht an. „Also – wie lange?“
„Lange, ganz lange“, sagte sie leise. Er blickte auf ihre Stirn hinunter. Sie hob den Kopf ein wenig, so dass ihre Blicke sich trafen. War das Verlegenheit, was er in ihren Augen sah? Tim ahnte plötzlich, was nun kommen würde. Und es kam.
„Wir könnten Kinder haben.“ Sie sprach es fast flüsternd aus. Und lächelte dabei wie ein beim Träumen ertappter Teenie. „Wir könnten ihnen alles beibringen, was du weißt, wir könnten …“
„O Gott“, stöhnte Tim. „Meine herrliche, kleine Barbarin will ein Nest bauen.“ Er zog sie an sich und lachte in sich hinein. Und biss sich sofort auf die Zunge, bevor noch mehr Spott über seine Lippen springen konnte.
Vorsicht, Commander!, legte er sich selbst die Zügel an. Sei kein Idiot! Es ist ihr schwer genug gefallen, so etwas auszusprechen. Sie ist eine Frau, eine junge, gesunde Frau. Eine schöne Frau, das weißt du doch, oder? Eine Barbarin dazu. Und sie liebt dich – was liegt näher, als dass sie Kinder von dir will?
Tim fasste ihr Kinn und versuchte ihren Kopf zu heben. Aber sie wollte nicht. Als fürchtete sie, ihn anzuschauen. Als schämte sie sich. Er fasste ihre Hüften und Schultern und zog sie unter das Dach des Unterschlupfs. Weich war der Teppich aus Blättern und Moos. Ganz fest hielt Tim seine Gefährtin, und sie drängte sich an ihn. Eine Zeitlang lagen sie so und sprachen kein Wort.
„Hör mir zu, Marrela“, brach Tim schließlich das Schweigen. „Du weißt, dass du mehr für mich bist als nur eine Weggefährtin. Du weißt, was ich für dich fühle, und du sollst wissen, dass ich deinen Wunsch verstehe. Sehr gut sogar. Aber du musst auch mich verstehen …“
Sie drückte sich ein Stück von Tim weg, um ihm ins Gesicht blicken zu können. „Ich bin von einer Sekunde auf die andere in diese fremde Welt hineingeworfen worden“, fuhr er fort. „Begreifst du, was das heißt? Ich war fünfunddreißig Jahre in einer Welt zu Hause, die mit dieser hier nicht mehr gemein hatte als ein paar geographische Ähnlichkeiten. Mein Leben wurde von einem Augenblick auf den anderen zertrümmert, so wie Alxanatan unsere Erde einst von einem Augenblick auf den anderen zertrümmert hat.“
Sie nickte langsam. Mitgefühl stand auf einmal in ihrer Miene. Zärtlich streichelte sie Tims Wangen. „Stellt dir vor, du fällst in ein Loch – und plötzlich bist du in einer anderen Welt, in einem anderen Leben – stell dir das vor, Marrela. Es gibt keinen Weg zurück mehr, deine Freunde sind weg, deine Familie, die Städte, Straßen, Wälder, Wiesen, die zu kennst – alles weg, nichts ist mehr, wie es war … Kannst du dir das vorstellen?“
„Es ist gut, Tinnox.“ Sie schlang die Arme um seinen Hals und drängte sich wieder an ihn. „Es ist gut, ich verstehe dich.“
„Deswegen musste ich meine Kameraden finden. Sie schienen mir das einzig Vertraute, was mir in dieser Welt geblieben war. Ich musste herausfinden, was aus ihnen geworden war. Und deswegen muss ich diese rätselhaften Bunker-Menschen finden – sie sind für mich wie ein Stück der untergegangenen Welt, aus der ich stamme. Wie ein Stück zu Hause – ich muss …“
Ihre Lippen verschlossen ihm den Mund. Sie küsste ihn lange und leidenschaftlich. „Es ist gut, Tim“, sagte sie dann. „Ich verstehe.“ Sie verstummte. Ihre Augen wanderten aufmerksam über sein Gesicht. Ihre schönen, braunen Augen, ihre müden Augen. Tim versank in ihnen. Ihm wurde warm hinter dem Brustbein, und er begriff, dass diese Frau ihm in der kurzen Zeit, die er durch diese Albtraumwelt stolperte, dass Marrela ihm in diesen sieben Monaten auch so etwas wie ein Zuhause geworden war.
„Werden wir dann nie …“ Wieder unterbrach sie sich. Die unausgesprochene Frage stand deutlich genug in ihren Augen.
„Doch.“ Tim nickte. „Irgendwann. Lass uns darüber reden, wenn wir die Bunker dieser Menschen gefunden haben. Vielleicht kommen wir dann ein wenig zur Ruhe.“
Zur Ruhe! Tim konnte sich nicht vorstellen, in dieser fremden Welt jemals zur Ruhe zu kommen. Er sprach es nicht aus.
Marrela drückte ihn auf den Rücken und rutschte auf ihn. Ihre Haut auf seinem Bauch und seiner Brust fühlte sich an wie heißer, feuchter Samt. „Du musst mich jetzt trösten“, flüsterte sie.
Das tat Tim. Er tröstete sie. Und sich. Und es war sehr gut. Etwas Besseres hätten sie nicht tun können.
Später schlief Marrela tief und fest. Tim stand leise auf und schlüpfte in seinen dreckigen Pilotenanzug. Dabei betrachtete er die schlafende Frau. Gib ihr noch drei oder vier Tage Ruhe, dachte er, danach wird sie sich besser fühlen. Er versenkte Messer, Taschenlampe und Pistole in die Taschen und hängte sich seinen Feldstecher um den Hals. Dann drang er in den dunstigen Wald ein. Sein Magen knurrte, etwas Essbares musste her.
Knapp vierhundert Schritte vom Unterschlupf entfernt, auf der anderen Seite der otowajii, stieß er auf lange Wälle von Dornengestrüpp – Brabeelen-Hecken. Sie hingen voller schwarz-roter Früchte.
Tim schlug sich den Bauch voll. Danach improvisierte er eine Schale aus Blättern, um Beeren für seine Gefährtin zu sammeln. Er stellte sich auf die Zehenspitzen, griff in das Gestrüpp und zog einen dornigen Ast voller Beeren zu sich herunter …
… er pflückte keine einzige.
Der Schreck lähmte ihn für Bruchteile von Sekunden: Wo eben noch der dichte Ast den Blick auf die andere Seite der Hecke verdeckt hatte, sah Tim ein Gesicht: Schmale, hellblaue Augen, gelbliche, zerfurchte Haut, grauer, struppiger Bart, der die ganze untere Gesichtshälfte bedeckte. Dicke, graue Zöpfe, die unter einer wildledernen, braunen Kappe hervorquollen.
Der Mann musterte ihn. Ohne sichtbare Regung. Tim fragte sich, ob es womöglich eine Wachspuppe war, die dort auf der anderen Seite der Hecke im Unterholz stand.
Seine Nackenhaare richteten sich auf. Blicke schienen sich von hinten in sein Hirn zu bohren. Er fuhr herum. Sieben Männer standen hinter ihm. Auch sie vollkommen reglos, auch sie von gelblicher Hautfarbe, mit struppigen Bärten, langen Haaren, in Wildlederkappen und -mänteln. Einige trugen Äxte, andere Speere, zwei waren mit Pfeilen und Bogen bewaffnet. Tim stockte der Atem. Hatte der Waldboden sie ausgespuckt?
3
Coellen, Anfang September 2516