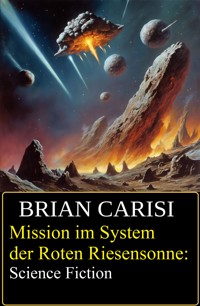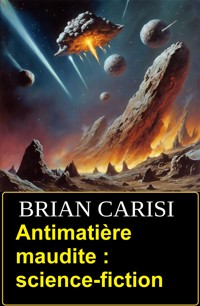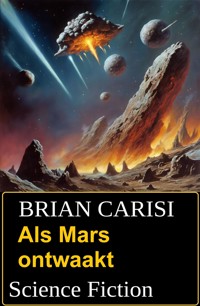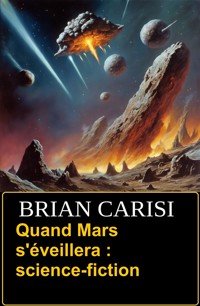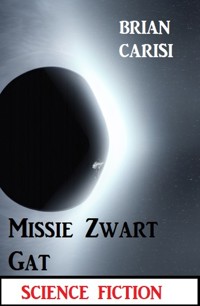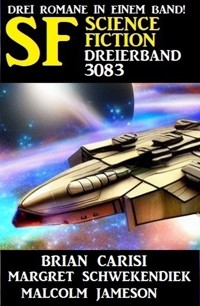
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende SF-Romane: Margret Schwekendiek: Raumschiff Ferrum auf der Flucht Malcolm Jameson: Das Land des brennenden Meeres Brian Carisi: Der Cyborg-Söldner und die Planetenprinzessin Das Licht der fernen Sterne wurde durch die plätschernden Salzseen des Planeten Zontalon gebrochen. Helle Reflexionen tanzten wie Geister auf der Wasseroberfläche, während der zarte Geruch von Gewürzen und Salztang die Luft erfüllte. Über diesem malerischen Anblick schwebte das Raumschiff von Jamban, dem gefürchteten Cyborg-Söldner. Sein Schiff, die "Sternenfalke", war eine klaffende Wunde im Himmel, ganz in tiefem Schwarz und schimmerndem Metall gehalten – ein Überbleibsel aus Kriegen, die die Galaxis verwüstet hatten. Panzerglieder schützten den Cockpitbereich, während verborgen darunter ausgetüftelte Technik summte und blinkte, bereit, den einmaligen Scharfschützen und Meistermechaniker zum nächsten Auftrag zu befördern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Science Fiction Dreierband 3083
Inhaltsverzeichnis
Science Fiction Dreierband 3083
Copyright
Raumschiff FERRUM auf der Flucht
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Das Land des brennenden Meeres
Der Cyborg-Söldner und die Planetenprinzessin
Science Fiction Dreierband 3083
Brian Carisi, Margret Schwekendiek, Malcolm Jameson
Dieser Band enthält folgende SF-Romane:
Margret Schwekendiek: Raumschiff Ferrum auf der Flucht
Malcolm Jameson: Das Land des brennenden Meeres
Brian Carisi: Der Cyborg-Söldner und die Planetenprinzessin
Das Licht der fernen Sterne wurde durch die plätschernden Salzseen des Planeten Zontalon gebrochen. Helle Reflexionen tanzten wie Geister auf der Wasseroberfläche, während der zarte Geruch von Gewürzen und Salztang die Luft erfüllte. Über diesem malerischen Anblick schwebte das Raumschiff von Jamban, dem gefürchteten Cyborg-Söldner. Sein Schiff, die "Sternenfalke", war eine klaffende Wunde im Himmel, ganz in tiefem Schwarz und schimmerndem Metall gehalten – ein Überbleibsel aus Kriegen, die die Galaxis verwüstet hatten. Panzerglieder schützten den Cockpitbereich, während verborgen darunter ausgetüftelte Technik summte und blinkte, bereit, den einmaligen Scharfschützen und Meistermechaniker zum nächsten Auftrag zu befördern.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Raumschiff FERRUM auf der Flucht
Science Fiction-Roman von Margret Schwekendiek
Der Umfang dieses Buchs entspricht 232 Taschenbuchseiten.
Die G’oerron müssen nach der erfolgreichen Flucht des irdischen Raumschiffs FERRUM durch den Einsatz der Failtronic feststellen, dass alle Rechenanlagen ausgefallen sind. Es gibt kein Backup, und wenn die Terraner nicht zurückkehren, ist das ganze Volk zum Sterben verurteilt. Angesichts der feindseligen Haltung dieser Wesen, scheint eine Rückkehr jedoch ausgeschlossen.
1.
22.06.2109, 5 Uhr 30, Standard-Erdzeit
Ich weiß, dass auch Lynsha Nash ein privates Logbuch führt, und mittlerweile komme ich zu dem Schluss, dass es für mich ebenfalls von Vorteil sein kann. Es mag seltsam klingen, doch es macht Sinn, wenn man im Nachhinein seine eigenen Gedankengänge nachvollziehen kann. Vor allem dann, wenn man ein wenig ratlos ist, so wie ich jetzt in dieser Situation. Ich frage mich, wie andere entscheiden würden, ob es überhaupt etwas zu entscheiden gibt, wenn man darauf bedacht sein muss, die Besatzung und das Schiff zu schützen – notfalls auch vor sich selbst. Ich habe diese Idee aufgegriffen, wie es vor mir vermutlich schon viele tausend Menschen getan haben, und ich will auf diese Weise Erinnerungen schaffen, die mich sogar überdauern. Makaber, wenn einem solche Gedanken durch den Kopf schießen, schließlich bin ich noch jung. Aber in diesem Beruf muss man mit allem rechnen.
Endlich hört das nervenzerfetzende Jaulen auf. Wie in den vergangenen Tagen ist es sicher wieder nur falscher Alarm. Ich habe die ganze Besatzung angewiesen, noch aufmerksamer als sonst schon zu sein. Zuerst haben mir meine Leute das sehr übel genommen, besonders Caren van Boer, sie fühlten sich offenbar persönlich angegriffen, als ob ich ihnen unterstellen würde, nicht ordentlich zu arbeiten. Mittlerweile haben jedoch alle eingesehen, dass meine Anweisungen wohl begründet waren. Immerhin treibt da draußen im All das Raumschiff einer uns unbekannten Rasse mit eindeutig feindseligen Absichten. Wenn wir doch nur der FERRUM mit Lynsha Nash und der übrigen Besatzung helfen könnten. Aber die Fremden haben dafür gesorgt, dass dem Raumschiff kein anderer Ausweg mehr blieb, als in diesen seltsamen Schlund einzufliegen. Seitdem haben wir keinen Kontakt mehr, und wir befinden uns in großer Sorge. Auch deswegen, weil wir selbst verfolgt wurden und zunächst Schutz im Schatten eines roten Überriesen suchen mussten. Auf Dauer wären wir dort auch nicht sicher gewesen, denn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen war es einem der fremden Schiffe gelungen, uns aufzuspüren.
Der Kontakt, wenn man ihn so nennen will, gestaltete sich zunächst schwierig, doch schließlich stellten wir fest, dass man uns aufforderte, einen Sicherheitsabstand zum Schlund einzuhalten. Wie aber sollten wir dann der Besatzung der FERRUM helfen? Natürlich hielten wir uns letzten Endes nicht daran, von einem einzelnen Schiff wollten wir uns nicht einschüchtern lassen. Aufgrund der eindeutig drohenden Haltung der anderen sah ich mich gezwungen, den Einsatz einer Sonde zu befehlen, wodurch das andere Schiff bewegungsunfähig gemacht wurde. Anschließend baute sich ein Schutzschirm rund um den Schlund auf, der jedoch auch für die Fremden selbst ein Problem darstellte, denn unser Verfolger wurde durch diesen Schutzschirm endgültig zerstört. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was wir hätten tun können, und die Meinungen der Leute an Bord gehen weit auseinander.
Im Grunde weiß ich im Augenblick nicht einmal, warum ich dieses persönliche Tagebuch schreibe. Ich kann darin auch nichts anderes niederlegen als das, was auch im normalen Logbuch steht. Dort ist jedoch kein Platz für private Gedanken, obwohl ich bisher noch nie das Bedürfnis verspürt habe, mich lang und breit über meine Empfindungen auszulassen. Vielleicht ist es auch nur ein unbestimmtes Gefühl, das mich treibt, aus dem heraus ich will, dass auch einige persönliche Aufzeichnungen von mir existieren.
Gerade kommt die Meldung herein, dass es sich tatsächlich wieder um einen falschen Alarm gehandelt hat. Natürlich, was auch sonst. Ein Gefühl sagt mir, dass die Schiffe der mysteriösen Fremden alle selbst nicht unbeschadet in diesen Bereich einfliegen können. Warum eigentlich nicht, wo doch der Schutzschirm von ihnen errichtet wurde? Eine Menge offener Fragen, die ich liebend gern beantworten würde.
Es summt an der Tür. Kann man auf diesem Raumschiff denn keine Ruhe finden? Ich werde bei Gelegenheit diese Aufzeichnungen weiterführen – oder löschen.
*
Caren van Boer, die Pilotin der DONNA, stand in der offenen Tür zur Kabine von Lory Wong. Mochte es in den letzten Tagen auch Spannungen zwischen den beiden Frauen gegeben haben, so waren diese doch längst wieder bereinigt.
„Was gibt’s?“, erkundigte sich die Kommandantin und schaltete das Aufzeichnungsgerät ab.
„Kannst du dir das mal ansehen?“, fragte Caren, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Lory folgte ihr in die Zentrale und musterte den vergrößerten Ausschnitt in der Ortung. Dort war auch weiterhin das Raumschiff der Fremden zu sehen. Es erinnerte entfernt an einen Anker. Ein Zylinder von rund 185 m Länge und 37 m Breite bildete den zentralen Mittelpunkt, und an einem Ende befand sich ein halbmondförmiger Zusatz, der die gleichen Dimensionen aufwies. Eigentlich war das auch schon alles, was man über diese Schiffe wusste. Zu bemerken wäre höchstens noch, dass sie über einen außerordentlich starken Schutzschirm verfügten, der den terranischen Waffenspezialisten schon eine Menge Kopfzerbrechen bereitet hatte.
Zum Greifen nah lag das Raumschiff vor ihnen, und offenbar war der Drang in der Pilotin ziemlich stark, mehr über die Fremden zu erfahren, denn sie blickte Lory auffordernd an.
„Hast du etwas Neues herausgefunden?“
Caren schüttelte den Kopf. „Leider nicht. Calvin hat eine weitere Sonde ausgeschickt, aber sie kam nicht einmal bis in die Nähe des Schiffs. Aber schau dir das Ding nur einmal genauer an. Es macht ganz den Eindruck, als sei es ein vollkommenes Wrack.“
„Du hältst es also für eine Einladung?“, erkundigte sich Lory W ironisch. „Es kann sich aber auch um eine Falle handeln, das ist dir doch hoffentlich klar. Wie sieht es mit einer Funkverbindung zur Erde oder Katta aus?“
Die Pilotin schüttelte erneut den Kopf. „Sollte tatsächlich jemand einen Spruch von uns auffangen, so wird er in jedem Fall verstümmelt sein. Die Sendungen können aus diesem instabilen Bereich nicht klar empfangen werden.“
„Und wir können nichts tun, um der FERRUM zu folgen“, stellte Lory bedrückt fest.
„Das dürfen wir auch gar nicht“, widersprach Caren heftig. „Diese Schiffe mit den Fremden darin sind eine Bedrohung für die Erde, und wir müssen versuchen, eine Warnung zu funken.“
„Oh, bitte, niemand hindert dich daran“, erwiderte die bildhübsche Kommandantin mit den langen pechschwarzen Haaren bissig.
„Du hast ja recht. Entschuldige, ich glaube, es liegt an dieser ganzen vertrackten Situation, dass ich so heftig bin.“
„Schon gut, mir geht es ähnlich, aber es bringt uns allen nichts, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Im Augenblick warten wir auch weiterhin ab. Wir dürfen nicht riskieren, wieder wie die Hasen gejagt zu werden, sobald wir den Ortungsschutz verlassen.“
Die missmutigen Gesichter der Besatzung zeigten der Kommandantin, dass niemand so recht mit ihrer Anweisung einverstanden war. Aber sie bestimmte, was getan wurde. Und sie allein trug die Verantwortung für dieses Schiff und seine Besatzung. Sie würde kein Leben riskieren, wenn es sich vermeiden ließ.
„Versucht weiter, Funkkontakt herzustellen, mit wem auch immer“, befahl Lory kurz und verließ die Zentrale. In ihrem Rücken spürte sie die Blicke der anderen.
*
War das alles tatsächlich Wirklichkeit gewesen?
Lynsha Nash saß in der Zentrale der FERRUM und dachte über die phantastischen Ereignisse nach, die sie und die Mannschaft hinter sich gebracht hatten. Die G’oerron, ein unglaubliches Volk, das sich im Para-Kontinuum regelrecht versteckte, hatte die FERRUM wie auch die DONNA im Normalraum gejagt, bis dem großen Raumschiff der Menschheit nichts anderes mehr übrig geblieben war, als durch den Schlund, von dem man nun wusste, dass es sich um einen Verteiler handelte, in die Para-Kontinuum-Blase zu fliehen. Erst hier war man endlich auf die mysteriösen Angreifer in den Ankerschiffen getroffen, die jedoch keinen Hehl daraus machten, dass sie keinen gesteigerten Wert auf Kontakt zu den Terranern oder wem auch immer legten.
Die G’oerron hatten sich schon vor mehreren tausend Jahren hier verborgen, nachdem sie als Hilfsvolk einer anderen Rasse mit einer ansteckenden Krankheit infiziert worden waren. Ursprünglich war das Leben in der Para-Kontinuum-Blase aufgebaut worden, um selbst niemand anderen zu infizieren. Die stellaren Impulse, die die Menschen erst hergelockt hatten, galten als eine Art Heilmittel, auch wenn bis jetzt noch niemand so recht verstanden hatte, wie das eigentlich vor sich ging. Tatsache war jedoch, dass die G’oerron ohne diese Impulse nicht leben konnten.
Im Laufe der langen Zeit hatte sich eine seltsame Kultur mit merkwürdigen Hierarchien entwickelt. Um zu überleben und nicht von der noch immer unheilbaren Krankheit vernichtet zu werden, waren die stellaren Impulse wichtig. Das alles wäre weiter kein Problem gewesen, wenn sich auf G’oerr nicht eine ungewöhnliche gesellschaftliche Struktur gebildet hätte. Die meisten Mitglieder dieses Volkes lebten in den Tag hinein, unterhalten von einer Art Brot und Spiele, sprich, blutigen Kämpfen zwischen Gladiatoren in einer Arena, während wenige, die zur Regierung gehörten, die Geschicke des Volkes lenkten. Offenbar funktionierte das alles ohne größere Probleme, und die G’oerron verspürten kein Verlangen nach Kontakt zu anderen Völkern. Das hinderte sie jedoch nicht daran, mit ihren Schiffen Lebewesen von fremden Planeten zu entführen, um sie dann ebenfalls als Nervenkitzel in die Arena zu schicken. So unglaublich und abstoßend dieses Verhalten auf Menschen wirken mochte, so verständlich wurde das, wenn man betrachtete, dass diese Kultur keine Anregungen von außen zuließ und sich noch immer benahm, wie es die ersten Kolonisten in ihren Anweisungen niedergelegt hatten. Es schien unglaublich, aber seit mehr als zwölftausend Jahren hatte sich nichts geändert.
Lynsha und ihre Leute waren über die Geschichte der G’oerron aufgeklärt worden, und eigentlich wäre es für die Menschen interessant gewesen, Kontakt zu diesem Volk aufzunehmen. Dem stand jedoch ein gewichtiges Hindernis gegenüber. Nachdem Menschen und Rasuuner in einem ersten Kontakt etwas mehr über die gegenseitigen Hintergründe erfahren hatten, wollten die G’oerron nicht mehr zulassen, dass die FERRUM mit ihrer Besatzung wieder startete. Nur durch einen unglaublichen Handstreich war es gelungen, wieder von diesem Planeten zu fliehen. Angesichts der Übermacht der Ankerschiffe hatte Lynsha Nash jedoch zum allerletzten Mittel greifen müssen, um den Planeten und die Para-Kontinuum-Blase wieder verlassen zu können. Die Failtronic hatte eingesetzt werden müssen, was zur Folge hatte, dass auf G’oerr kein einziger Rechner mehr funktionierte.
Erst durch diesen konsequenten Einsatz war es der FERRUM gelungen zu fliehen, und sofort hatten die Ankerschiffe in großer Zahl die Verfolgung aufgenommen. Die Fremden meinten es ernst, wie die Besatzung rasch hatte feststellen müssen. Ein unbekanntes technisches Gerät war eingesetzt worden, damit war es möglich, eine Transition der FERRUM zu verhindern. Das riesige Raumschiff war im Para-Kontinuum eingefroren worden, so jedenfalls drückte es Seamus O’Connell aus. Seltsame Phänomene waren um die Mannschaft herum aufgetaucht, und Menschen, wie auch Rasuuner, hatten eine Reise ins Ich unternommen, die keinem so recht gefallen hatte. Memory-Spots, Erinnerungsblasen, so hatte die Besatzung die seltsamen Phänomene genannt, die von irgendwoher aufgetaucht waren und die Seelen mit quälenden Erinnerungen aufgewühlt hatten.
Jetzt hing das riesige Raumschiff bewegungslos im Nichts, wie Lord Hobble, der Shatore, es nicht ganz zutreffend ausgedrückt hatte. Dies war kein Zustand, in dem jemand lange bleiben mochte, und alle sehnten sich danach, endlich wieder im Normalraum zu sein und diese Abenteuer nur noch als Erinnerung im Hinterkopf zu haben. Aber so einfach gestaltete sich die Sache längst nicht.
Es stellte sich für Lynsha Nash die Frage, wie sie weiter vorgehen sollte. Was würde geschehen, wenn eine weitere Transition eingeleitet wurde? Waren die Geräte in der FERRUM auf Dauer verändert, so dass eine Transition in Zukunft immer im Nichts enden würde? Die Kommandantin zögerte, den Befehl für einen erneuten Sprung zu geben. Niemand trug das verstärkte Verlangen in sich, wiederum eingefroren zu werden und sich mit unliebsamen Erinnerungen abgeben zu müssen, gegen die es kein Hilfsmittel gab. Welche Nebenwirkungen darin zusätzlich lagen, war eine weitere Frage, die niemand beantworten konnte. Andererseits machte es nicht viel Sinn, weiter hier an diesem Ort zu bleiben, früher oder später musste sich die FERRUM bewegen und versuchen, den normalen Raum wieder zu erreichen. Lynsha dachte darüber nach, ob sie etwas tun konnte, um die gefürchteten Phänomene zu verhindern, eine Antwort auf diese Frage gab es jedoch nicht.
„Lass es uns gleich noch einmal versuchen“, forderte Qui, der unbedingt aus diesem Zustand herauswollte. Er hatte Angst davor, noch einmal mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert zu werden, die er längst verdrängt und abgelegt geglaubt hatte.
„Was denkst du dir dabei?“, begehrte Manuel Dorfmann auf. „Die Maschinen funktionieren nicht, solange die da drüben Geräte haben, die unsere eigenen Anlagen überlagern. Wir müssen abwarten.“
„Ach ja, und wie lange? Wenn du ein bisschen mehr Verstand in deinem Kopf besitzen würdest, hättest du längst einige deiner Maschinen auf die Reise geschickt, damit da drüben nichts mehr funktioniert und wir endlich verschwinden können.“ Wütend blitzte Qui den Professor an. Die Stimmung an Bord war bis zum Äußersten gereizt, wie auch die nachfolgende Antwort bewies.
„Ich soll meine Babys hinausschicken?“, fragte Manuel und deutete anklagend ins Para-Kontinuum, wo man über den Hauptbildschirm mühelos die rund zwanzig ankerförmigen Schiffe sehen konnte, die im Augenblick abwartend rund um die FERRUM standen. „Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich meine Kinder auf diese verrückten G’oerron loslasse und sie womöglich nicht zurückbekomme?“
„Was ist dir eigentlich wichtiger? Deine mechanischen Lebewesen – ein paar Maschinen, die man ersetzen kann – oder die FERRUM mit ihrer Besatzung? Ist dir dein eigenes Leben vielleicht nicht einmal wichtig?“ Auch Quiberon Four, der sonst als ruhig und ausgeglichen galt, hatte sich jetzt in Zorn hineingesteigert. Worin dieser Zorn tatsächlich begründet war, würde er natürlich niemandem verraten, und vermutlich würde auch niemand je eine Frage danach stellen, denn jeder hatte während der gefrorenen Zeit unliebsame und unerwünschte Bekanntschaft mit seiner eigenen Vergangenheit gemacht.
Doch Lynsha Nash, die Kommandantin, hatte genug von diesem sinnlosen Geplänkel. Auch sie wollte weg von hier, aber mit einer endlosen Debatte würde das wohl niemandem gelingen.
„Wir brauchen hier keinen Streit“, ging sie dazwischen. Die beiden Männer schauten sie mit großen Augen etwas verlegen an.
„Hast du vielleicht eine bessere Idee?“, blaffte Manuel Dorfmann, der sich trotzdem nicht so einfach bremsen lassen wollte.
„Wir sollten tatsächlich noch einmal versuchen zu transistieren, mit eingeschaltetem Kompaktschirm“, schlug die Kommandantin mit den intensiv grünen Augen vor, und nicht nur der Professor schnappte nach Luft.
„Du bist ja verrückt“, stieß er hervor und stakste einige Schritte davon. Auch Qui schüttelte ungläubig den Kopf, als könnte er nicht glauben, was er gerade gehört hatte.
„Warum eigentlich nicht?“, fragte Lynsha sanft.
Manuel Dorfmann blieb stehen. „Nun, weil weil es noch niemand je getan hat. Und weil es nicht geht“, erklärte er voller Überzeugung.
„Es war auch noch nie jemand in einer solchen Situation. Wie können wir da wissen, ob es für uns nicht die letzte Rettung bedeutet? Wenn es noch niemand probiert hat, kann auch keiner wissen, ob es funktioniert“, führte Lynsha die logischen Gegenargumente an und erntete ein weiteres Kopfschütteln des Professors.
„Jeder wissenschaftliche Verstand wird dir sagen, dass es vollkommen unmöglich ist, mit eingeschaltetem Kompaktschirm zu springen. Hast du jemals auch nur den Versuch gemacht, den Schirm bei einer Transition einzuschalten? Nein! Und warum nicht? Weil es nicht geht. Basta!“
Manuel Dorfmann war von seiner Ansicht nicht abzubringen, und vom wissenschaftlichen Standpunkt unter normalen Umständen mochte er sogar Recht haben. Nur waren das hier ganz sicher keine normalen Umstände, und der wissenschaftliche Standpunkt spielte keine große Rolle. Verzweifelte Lagen erforderten nun einmal verzweifelte Auswege. Aber gleich so verzweifelt?
Der Professor tippte sich in einer eindeutigen Geste an die Stirn, doch die Kommandantin ließ sich auch davon nicht beeindrucken.
„Sag mir, was wird dann passieren?“, fragte sie provozierend.
„Was passieren kann?“ Manuel rang nach Luft, um eine längere ausführliche Antwort zu geben, aber dann hielt er inne und kratzte sich ratlos am Schädel. „Hier im Para-Kontinuum? Na, ich denke, erst mal gar nichts, weil der Kompaktschirm und der Transitionsantrieb interferieren. Das eine schließt das andere aus.“
„Hier im Para-Kontinuum?“, wiederholte Lynsha seine Worte süffisant. „Wo steht das geschrieben?“
Auch Qui hörte der Auseinandersetzung gebannt zu und grinste. „Ja, Professor, wo steht das geschrieben?“, wiederholte er. Er hatte im Kopf ebenfalls schon Berechnungen angestellt, aber ein eindeutiges Ergebnis konnte keiner vorweisen, weil es ganz einfach keine vergleichbaren Daten gab. Das Para-Kontinuum war nicht einmal zu einem Prozent erforscht, niemand war in der Lage Prognosen abzugeben.
„Vielleicht funktionieren nur im Normalraum Sprungantrieb und Kompaktschirm nicht zusammen“, versuchte Lynsha die bisherigen Ergebnisse zusammenzufassen.
„Wo das geschrieben steht?“, fauchte Manuel Dorfmann, durch den Widerspruch von Qui erneut aufgebracht. „Hier drinnen, mein Lieber.“ Er schlug sich an die Stirn. „Hier drinnen. Wer ist denn hier der Wissenschaftler? Willst du mir jetzt meine Arbeit erklären?“ Bevor es zwischen den beiden Männern erneut zu einer Auseinandersetzung kommen konnte, schaltete sich Lynsha wieder ein.
„Ich verstehe das doch richtig, dass es keine eindeutigen Ergebnisse gibt, wie ein Kompaktschirm im Para-Kontinuum überhaupt funktioniert? Dann werden wir tatsächlich die Probe aufs Exempel machen müssen, und du, Manuel, solltest alles genau dokumentieren. Oder habt ihr vielleicht Lust, noch länger hierzubleiben und keinen Ausweg mehr zu finden? Manuel, ich könnte mir wohl vorstellen, dass du dich als Gladiator in der Arena recht gut machst, aber ohne deine Maschinen dürfte das ein sehr einseitiger Kampf werden. Ihr könnt euch alle natürlich gleich den G’oerron ergeben, die haben sicher noch mehr Platz in der Arena. Aber wer das will, sollte die FERRUM besser auf der Stelle verlassen. Wir werden jetzt einen Versuch mit dem eingeschalteten Kompaktschirm unternehmen und sehen, was dabei passiert.“
Manuel Dorfmann senkte die Schultern. Die Kommandantin hatte natürlich Recht, niemand wollte länger als unbedingt notwendig hierbleiben. Außerdem musste die FERRUM schnellstens aus der Reichweite der Ankerschiffe, die Übermacht war zu groß, als dass das Schiff auf Dauer den Angriffen standhalten konnte.
Lynsha Nash ging damit ein großes Risiko ein, es mochte jedoch auch nicht größer sein, als weiter hier im Para-Kontinuum vor den G’oerron davonzulaufen. Qui setzte sich wieder an seine Konsolen, Manuel Dorfmann verschwand in seiner Kabine, um wieder einmal die Funktionstüchtigkeit seiner Maschinen zu überprüfen, und alle anderen bereiteten sich innerlich auf etwas vor, von dem niemand wusste, was es sein würde.
Lynsha Nash saß in ihrem Kommandosessel und schaute in die Runde. Ihre Stimme klang belegt aber fest, als sie die Befehle gab.
„Kompaktschirm auf volle Leistung.“ Augenblicklich spannte sich eine energetische Hülle um die FERRUM. Schlieren tanzten darauf herum, schufen phantastische Bilder und kleine Entladungen in einem atemberaubenden Panorama und täuschten so darüber hinweg, dass es sich um eine tödliche Hülle handeln konnte.
„Transition.“
Ein seltsames Brummen setzte ein, brachte die gesamte Hülle der FERRUM zum Schwingen und machte auch nicht vor der Einrichtung und der Besatzung Halt.
„Das große Zittern“, bemerkte die Bordärztin Alienor Domestan in ihrer typisch trockenen Art. Die Ironie verging ihr jedoch gleich wieder, als die Erschütterungen weiter zunahmen und alle Gegenstände an Bord zu tanzen begannen.
„Das ... muss ... aufhören“, rief die Ärztin und befürchtete schwerwiegende körperliche Schäden für die Lebewesen.
Lynsha Nash schaute in die Runde und sah alles nur noch bruchstückhaft. Sie streckte den Arm aus, um den Kompaktschirm doch abzuschalten. Es erwies sich jedoch praktisch als unmöglich, die Konsolen mit dem Schalter zu treffen, für sie und jeden anderen. Nichts hielt mehr still, da konnte die Rasuunerin ruhig versuchen, sich an einer Kante festzuhalten und sich dann voran zu tasten. Ihre Hände glitten ab, und sie wurde aus dem Sessel geschüttelt, nur die Gurte verhinderten, dass sie auf dem Boden aufschlug und haltlos umherwirbelte.
Den anderen Besatzungsmitgliedern erging es auch nicht viel besser, besonders der Shatore litt unter den Erscheinungen. Sein insektenhafter Körper klapperte, als schlügen die Knochen eines Skeletts aufeinander, und das Reiben der mit einem Chitinpanzer überzogenen Gliedmaßen trug mit dazu bei, das Inferno in der Zentrale zu vergrößern. Dieses Geräusch machte allen besonders zu schaffen.
„Hört auf“, brachte Lord Hobble hervor, doch niemand war in der Lage, der Bitte des Shatoren nachzukommen. Nicht einmal Quiberon Four gelang es, seinen Körper soweit unter Kontrolle zu bekommen, dass er Schaltungen auf der Konsolen vornehmen konnte. Und noch immer steigerten sich die Erschütterungen, bis alle völlig erschöpft in ihren Sesseln hingen oder sogar durch gerissene Gurte auf dem Boden aufschlugen.
Die FERRUM machte keine Anstalten, in die befohlene Transition zu gehen, obwohl der Impuls dazu schon lange gegeben war. Das Raumschiff verharrte auch weiterhin im Para-Kontinuum auf der Stelle und rührte sich nicht. Es war, wie schon zuvor, eingefroren. Und die Qual wurde vergrößert durch den Einsatz des Schirmes, der die Insassen eigentlich schützen sollte.
*
Ein Zentnergewicht lag auf seiner Brust. Was er unter anderen Umständen vielleicht sogar für kurze Zeit genossen hätte, drohte ihm jetzt den Atem abzuschnüren und an den Rand des Todes zu bringen.
Seamus O’Connell, der homosexuelle Bordingenieur, hatte für kurze Zeit eine fast sinnliche Phase verspürt, als die entsetzlichen Erschütterungen endlich aufgehört hatten und die FERRUM zu einer relativen Ruhe gekommen war. Erleichtert hatten sich alle aufgerappelt.
Aus dem Raum von Manuel Dorfmann waren lautes Jammern und wüste Beschimpfungen gekommen, offenbar waren seine Maschinen nicht ohne Beschädigung geblieben. Doch auf Seamus lastete das Gewicht von Alienor Domestan, die durch einen Sturz kurzfristig bewusstlos geworden war. Vorsichtig schob Seamus sie zur Seite, eine Frau war nun wirklich das letzte, was ihn reizen konnte, und das Gefühl der Sinnlichkeit verflog sofort.
Lynsha Nash erhob sich taumelnd und blickte als erstes auf die Anzeigen. Der Kompaktschirm hatte sich offenbar selbständig deaktiviert. Gerade deswegen – oder vielleicht auch trotzdem – hatte die Transition stattgefunden. Die FERRUM befand sich augenblicklich außerhalb der Reichweite der G’oerron, was jedoch nicht bedeutete, dass das auch so bleiben musste. Hämmernde Kopfschmerzen drohten Lynsha Nash an den Rand des Wahnsinns zu bringen. Rote und schwarze Funken wirbelten vor ihren Augen. Sie fühlte sich eingeengt, das Gesichtsfeld war stark beschränkt, und jedes noch so kleine Geräusch kam dem Aufprall einer Bombe gleich. Übelkeit breitete sich vom Magen her aus, und die Rasuunerin wünschte sich, tot zu sein. Aber nein, sie trug die Verantwortung für das Schiff und die Mannschaft, sie musste durchhalten.
Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten, mit letzter Kraft umklammerte sie die Lehne des Sessels, war aber längst nicht mehr in der Lage, eine sinnvolle Handlung zu vollziehen. Wie schon beim ersten Durchgang durch das Para-Kontinuum kam es auch jetzt wieder zu unglaublichen Phänomenen, die jeden auf eine ganz persönliche Art betrafen und niemanden ungeschoren ließen. Die Belastungen der letzten Wochen zehrten noch an ihnen allen, eigentlich hätte jeder dringend eine lange Pause gebraucht; Landurlaub auf der Erde, oder wo auch immer.
Die Ereignisse in der Galaxis nahmen jedoch keine Rücksicht auf persönliche Gefühle oder Notwendigkeiten, und bisher hatte die Mannschaft der FERRUM noch immer alles durchgestanden. Hier jedoch gerieten alle an ihre Grenzen.
Lynsha Nash löste sich von ihrem Sessel, sie wollte zur Bordärztin, um von ihr ein schnell wirkendes Schmerzmittel zu erhalten. Schließlich musste jemand das Kommando auf der Brücke führen. Warum war die Zentrale nur plötzlich wie ein Schlauch geformt? Und warum pulsierte das ganze Schiff im Takt ihres eigenen Herzschlags? Lynsha war nicht mehr fähig zu erkennen, dass sie selbst es war, deren Psyche auf eine überaus starke Beanspruchung reagierte. Sie wollte eigentlich nur, dass endlich diese quälenden Kopfschmerzen nachließen, die ihren Schädel zu sprengen drohten.
Noburu Kawagama erging es nicht viel anders, auch er wurde von den Schmerzen fast zerrissen. Doch er besaß nicht mehr so viel körperliche Widerstandskraft wie die anderen. Der Japaner, der als Techniker und Pilot fungierte, lag verkrümmt am Boden und dämmerte nur noch vor sich hin.
Alienor Domestan und Seamus O’Connell hatten durch einen roten Schleier aus Schwindel und Übelkeit gesehen, dass die Kommandantin zusammengebrochen war, ebenso wie der Techniker. Man musste ihnen zu Hilfe eilen. Besonders die Ärztin kroch mehr als sie ging, ihr Körper weigerte sich, den Befehlen zu gehorchen. Rote Blasen tanzten durch die Luft, und darin konnte Alienor Szenen aus ihrer Jugend und Ausbildung erkennen. Szenen, an die sie sich teilweise gar nicht erinnern wollte.
Sie hatte schon von klein auf eine bestimmende Art an sich gehabt und wollte stets alles unter Kontrolle haben. Ihre Mutter, eine sanfte freundliche Frau, war mit der Erziehung des
eigensinnigen Kindes hoffnungslos überfordert gewesen. Das Mädchen hatte stets seinen Kopf durchgesetzt, Freunde hatte Alienor fast keine besessen. Mit ihrer schroffen Art stieß sie die meisten Menschen vor den Kopf. So hatte sie sich ganz auf das Lernen konzentriert. In einer der Traumblasen, von der Besatzung schon beim ersten Durchgang Memory-Spot genannt, sah sie den ersten jungen Mann, der sich für sie interessierte. Er war lieb und zärtlich gewesen, doch er kam mit ihrem Ehrgeiz nicht zurecht. Alienor hatte ihn zutiefst verletzt, als sie ihn mit der Bemerkung, er würde sie in ihrer Karriere behindern, davon schickte. Natürlich war das nicht die ganze Wahrheit gewesen. Alienor hatte im Laufe der Jahre eine schier undurchdringliche Mauer um sich und ihre Seele gebaut. Sie wollte nichts und niemanden, und schon gar keine Gefühle, an sich heranlassen. Ihre Mutter war unglücklich in ihrer Ehe, doch sie hatte Alienors Vater geliebt und deshalb klaglos alles hingenommen, was er im Laufe der Zeit tat. Mochte es sich dabei um den häufigen Wechsel der Arbeitsstelle handeln, verfehlte Spekulationen mit dem Geld, oder sogar die Existenz einer anderen Frau. So etwas wollte Alienor auf keinen Fall erleben, sie würde sich dagegen wappnen, indem sie alles ausschloss, was ihren Panzer durchbrechen konnte.
Als die Ärztin jetzt jedoch in diesem Memory-Spot die treuen traurigen Augen des Mannes sah, den sie so brüsk von sich gestoßen hatte, regte sich das schlechte Gewissen in ihr. Hatte sie in ihrem Leben nicht doch etwas verpasst? Hatte sie sich selbst um Gefühle und damit tiefgreifende Erfahrungen betrogen? Alienor wandte sich fast gewaltsam von dem Bild ab. Sie musste sich wieder auf ihre Arbeit konzentrieren, sie musste helfen. Und doch war sie gefangen in den Erinnerungen, denn kaum hatte sie den Blick von diesem Ereignis losgerissen, tauchte schon ein neues auf.
Stöhnend krümmte sich Alienor am Boden und überließ sich schließlich den körperlichen Beschwerden, die sie offenbar leichter ertragen konnte als die Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit. Aber dieser Trick funktionierte nicht. Vor sich sah sie plötzlich das ausgezehrte Gesicht einer jungen Frau. Schlagartig kehrte auch diese Erinnerung mit voller Wucht zurück.
Es war während ihrer Zeit als Assistenzärztin geschehen. Mit unbekannten Symptomen war diese Frau ins Hospital eingeliefert worden. Erstmals trug Alienor allein die Verantwortung für eine Patientin, und anfangs ging sie noch davon aus, die bisher noch unbekannte Krankheit schnell in den Griff zu bekommen. Aber was Alienor auch unternahm, die Patientin reagierte nicht darauf. Auch als sich die junge Ärztin endlich dazu durchringen konnte, die Hilfe erfahrener Kollegen zu erbitten, verbesserte sich der Zustand nicht. Das Virus, mit dem die Frau infiziert war, ließ sich nicht lokalisieren und zuordnen, Alienor hatte vor der unheimlichen Aufgabe gestanden, diese Patientin bis in den Tod zu begleiten, weil es keine Hilfe gab. Diese Erfahrung hatte die Ärztin zutiefst verstört, obwohl sie sich selbst keine Schuld geben konnte. Dennoch war von jenem Tag an ihr Leben geprägt von dem festen Willen, nie wieder einfach so einen Patienten zu verlieren.
Natürlich hatte es im Laufe der Zeit Todesfälle gegeben, gegen die auch Alienor machtlos war. Aber dieses schreckliche Gefühl von Hilflosigkeit hatte sie nie wieder erleben wollen. Das bewies nur, dass Alienor Domestan durchaus ein weiches Herz besaß, welches sie nur erfolgreich verbarg. Die Crew der FERRUM wusste längst, wie empfindsam die Bordärztin war, doch sie legte Wert darauf, nach außen hin als unerschütterlich zu gelten. Wie die Eigenheiten eines jeden anderen wurde auch das respektiert. Die Konfrontation mit den eigenen Gefühlen brachte Alienor jetzt jedoch in einen schweren seelischen Konflikt, und sie rollte sich in embryonaler Haltung auf dem Boden zusammen, nur noch beschäftigt mit sich selbst.
Auch Seamus O’Connell tauchte in seine Vergangenheit ein. Bei ihm gab es ebenfalls eine Reihe unschöner Erinnerungen, doch er konnte damit offensichtlich besser umgehen als die Ärztin. Seine Zeit bei der Spaceguard jedoch wühlte ihn zutiefst auf, denn dort war er gleichzeitig glücklich und verzweifelt gewesen. Seamus kam irgendwann kurz zu sich und bemerkte, dass er weinte. Voller Wut und Hilflosigkeit schlug er mit den Fäusten auf den Boden. Was war das nur hier im Para-Kontinuum, das sie fast alle in den Wahnsinn trieb? Er wollte nicht über seine Vergangenheit nachdenken, all das lag hinter ihm und war abgeschlossen. Fast mit Gewalt verdrängte er die auf ihn einstürmenden Gedanken und schaffte es, einigermaßen klar zu bleiben. Doch gegen die körperlichen Beeinträchtigungen war auch er machtlos. Die Schwindelanfälle nahmen zu, aber auch der Wille, sich um die Kommandantin zu kümmern, nutzte ihm nicht viel. Sein Körper verfiel in unkontrollierte Zuckungen, bis schließlich das gequälte Gehirn den Dienst versagte.
In seiner Kabine hockte Manuel Dorfmann. Er war umgeben von seinen Maschinen, die er zärtlich streichelte, als könnten sie die Berührung spüren. Vielleicht konnten sie das sogar. Bei all den Modifizierungen und Weiterentwicklungen, die der Professor im Laufe der Zeit vorgenommen hatte, war es nicht abwegig zu glauben, dass all diese kleinen unterschiedlichen Roboter mittlerweile ein Eigenleben und eine Art Gefühle besaßen.
Ein Klicken, Zirpen und Piepsen erfüllte die Kabine, obwohl es natürlich längst möglich war, dass sich die Maschinen in menschlicher Sprache verständigten. Manuel legte jedoch aus einem nicht ganz nachvollziehbaren Grund immer noch Wert darauf, dass eine Art Maschinensprache benutzt wurde, die außer ihm niemand enträtseln konnte.
Er hatte sich nach der Auseinandersetzung in der Zentrale in seine Kabine zurückgezogen, wo er sich mit den einzigen Wesen beschäftigen konnte, die ihn – seiner Meinung nach – wirklich verstanden. Hier fühlte er sich sicher, niemals würden ihn seine Babys angreifen oder ihm Kummer bereiten. Auch Manuel sah die Memory-Spots, und er konnte sich in einigen davon erkennen. Doch er ließ nicht zu, dass schmerzliche Erinnerungen in ihm Überhand nehmen konnten. Der Professor saß auf dem Boden und spielte wie ein kleines Kind mit den bizarr aussehenden Robotern. Ab und zu kicherte er vor sich hin, stapelte dann einige Maschinen aufeinander und freute sich daran, wenn sie umgestürzt dalagen. Er reagierte nicht einmal mit dem sonst üblichen cholerischen Anfall, als durch das ganze Schiff ein shatorischer Heldengesang ertönte.
Lord Hobble war von dem seltsamen Phänomen im Para-Kontinuum praktisch nicht betroffen, aber er spürte natürlich ganz genau, was an Bord vorging. Um seine innere Unsicherheit zu überspielen, hatte er zu dem einzigen Mittel gegriffen, das ihm augenblicklich zur Verfügung stand. Er sang die traditionellen heimatlichen Lieder, die einen Menschen normalerweise verrückt machen konnten, weil sie wie bei einer Heuschrecke durch das Reiben der Gliedmaßen mit dem dicken Chitinpanzer entstanden. Das brachte ihm zwar keine Erleichterung auf der Suche nach seiner Heimat, doch er verhinderte damit, selbst in tiefe Depression zu verfallen, weil es ihm auch unmöglich war, den Freunden hier an Bord zu helfen. Die kraftvollen Töne durchdrangen selbst verschlossene Türen und erfüllten das Schiff mit einer seltsamen Atmosphäre, die angesichts der Phänomene im Para-Kontinuum jedoch nicht weiter auffällig war.
Quiberon Four hatte mehr Mühe, sich gegen die eindringenden Memory-Spots zu wehren. Er wollte auf keinen Fall noch einmal in seine Vergangenheit eintauchen. Es war ihm unter großen Mühen gelungen, sein Gedächtnis quasi abzuschalten, nichts Menschliches mehr sollte an ihn herankommen. Er dachte und handelte wie eine Maschine, in seinem Kopf und Körper liefen offenbar nur noch mechanische Prozesse ab, die nichts mehr damit zu tun hatten, dass es sich bei Qui im Grunde noch immer um ein menschliches Wesen handelte. Das verlangsamte seine Fähigkeiten enorm. Er bewegte sich wie in Zeitlupe, schien ständig zu überlegen, was er als nächstes tun sollte, und versuchte vor allem den Memory-Spots nicht zu nahe zu kommen. Er befürchtete, dass all seine Vorsichtsmaßnahmen nichts mehr nutzen würden, sobald er mit einer der Traumblasen zusammenstieß. Dann würden ihn die Erinnerungen wieder überfluten und letztendlich handlungsunfähig machen. Dabei war er im Augenblick der einzige an Bord, der noch zielgerichtet handeln konnte, wenn man von Lord Hobble absah, der jedoch viel zu sehr damit beschäftigt war, seine shatorischen Heldenlieder zum Besten zu geben, und zur Hilfe in technischer Hinsicht wohl kaum in der Lage war.
Mit Bedauern betrachtete Qui die am Boden liegenden Kameraden. Alienor und Seamus schienen einen Kollaps erlitten zu haben, und auch Lynsha Nash und Noburu krümmten sich vor Schmerzen und waren kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Vielleicht wäre das in der augenblicklichen Lage sogar das Beste gewesen, denn Qui konnte sehen, dass sich über allen Memory-Spots gesammelt hatten. Mit Sicherheit wurden alle von grausigen Erinnerungen geplagt, und es wäre besser, nicht bei sich zu sein, um dem nicht länger ausgesetzt zu werden.
Quiberon Four programmierte mit langsamen Bewegungen die Medo-Robots. Die Maschinen konnten die betroffenen Menschen besser versorgen, doch solange sich die FERRUM im Para-Kontinuum befand, nutzte die beste Medizin nichts, wie Qui längst wusste. Wie lange sollte dieser unwirkliche Zustand noch dauern? Quis Blick fiel auf den Chronometer. Die Zeit stand still, sie war offensichtlich wirklich eingefroren. Hatten sie dieses Phänomen nicht schon erlebt, als die Ankerschiffe mit technischen Mitteln eine Transition verhindert hatten? War es den G’oerron jetzt endgültig gelungen, die FERRUM in der Zeit festzuhalten? Warum aber konnte er sich bewegen? Die Zeit war doch eine Konstante, solange man sich in ihr befand. Wie konnte etwas Feststehendes überwunden werden? Vor allem in einer derart seltsamen Form, dass die Kameraden in der Zeit eingefroren waren, während er selbst sich außerhalb bewegte.
Qui wollte nicht länger darüber nachdenken, er würde hier und jetzt vermutlich keine Antwort darauf finden. Unter Umständen konnte sich später Manuel mit diesem Phänomen beschäftigen, immer unter der Voraussetzung, dass es ihm gelang, die FERRUM mit der Besatzung wieder in die Realität zu bringen. Aber vielleicht verging ja die Zeit draußen in der Wirklichkeit ganz anders. Dieses Problem konnte hier und jetzt nicht gelöst werden, sollten sich doch später kluge Köpfe mit dieser Frage beschäftigen.
„Ich kann nicht mehr“, schrie Noburu Kawagama in diesem Augenblick und krümmte sich zusammen, die Hände fest an den Kopf gepresst, als ließen sich die quälenden Schmerzen auf diese Weise besiegen. Quiberon gab einem Roboter einen Befehl, mit noch stärkeren Schmerzmitteln Linderung zu verschaffen. Es war jedoch wie verhext, keines der an Bord befindlichen Mittel schlug an. Qui vermutete, dass die Schmerzen aus den Bereichen des Gehirnes kamen, die normalerweise brachlagen und nicht angesprochen wurden; möglicherweise waren das die Bereiche, in denen parapsychische Fähigkeiten erzeugt wurden. Diese waren unter den Menschen jedoch nicht sehr verbreitet und noch viel weniger erforscht. Dennoch gab es auch Heilmittel, gleich welcher Art, um diese Zonen zu dämpfen.
Qui fing einen Blick von Lynsha Nash auf, auch bei ihr war die Pein unerträglich. Als Rasuunerin war sie von Natur aus latent parapsychisch veranlagt, auch wenn die Fähigkeit nie verstärkt zum Vorschein gekommen war. Doch in ihrem Kopf tobte ein Chaos, dem man nicht mehr begegnen konnte, es gab keine Linderung für Lynsha.
Sie wechselte noch einen Blick mit Qui, ohne sich dessen überhaupt richtig bewusst zu sein. Er verstand jedoch, dass er die Kontrollen des Schiffs übernehmen sollte. Unruhig schweiften seine Augen über die Konsolen, während er sich verzweifelt fragte, was er in dieser Situation an den Kontrollen noch tun konnte. Die lauten schrecklichen Töne der shatorischen Heldenlieder erfüllten die Zentrale. Lord Hobble machte sich offenbar selbst Mut, oder es war seine Art, Verzweiflung auszudrücken. Warum war er nicht von diesem Phänomen betroffen? Oder erlebte er gerade auf diese Weise einen Memory-Spot? Qui wollte das gar nicht so genau wissen.
Eine Bewegung erregte seine Aufmerksamkeit. In der offenen Tür stand Manuel Dorfmann, hielt in beiden Händen einige seiner Roboter und starrte unglücklich auf die am Boden liegende Besatzung.
„Was soll ich tun?“, fragte er ratlos.
Qui musterte ihn und schüttelte den Kopf. „Du kannst im Augenblick nicht viel tun, solange wir in diesem merkwürdigen Kontinuum sind. Es sei denn, du vermagst es, uns hier herausholen. Wir können nur versuchen, den anderen zu helfen. Bist du denn nicht auch von den Memory,Spots betroffen?“
„Wovon redest du da? Ich will mit meinen Babys spielen, aber niemand hilft mir, wenn sie nicht richtig funktionieren.“ Der Professor war offenbar doch nicht ganz bei sich. Er wollte auch keine weitere Auskunft haben, denn er hielt Quiberon Four einige seiner Maschinen vor das Gesicht.
„Sind sie nicht schön?“, fragte er fast ehrfürchtig und ließ sie dann fallen, wobei eines davon auf dem Boden zerschellte. Verblüfft blickte der kleine dickliche Professor auf die Trümmer, dann brach er unvermittelt in Tränen aus.
Qui spürte, dass er etwas unternehmen musste, sonst würde auch Manuel Dorfmann in einen nicht mehr kontrollierbaren Zustand abgleiten. Insgeheim wusste er jedoch, dass seine Bemühungen auch hier nicht sehr erfolgreich sein würden.
„Lass es liegen“, befahl er scharf, so wie man mit einem kleinen Kind sprach. „Du musst mir helfen, unsere Freunde zu versorgen. Später kannst du dich wieder um deine Maschinen kümmern. Dann will ich dir auch gerne helfen.“
Im Normalfall hätte der Professor niemals darauf reagiert, sich im Gegenteil wohl eher auf einen Streit eingelassen. Jetzt jedoch wirkte er tatsächlich wie ein kleines Kind und reagierte voller Eifer auf die Anweisung. Das machte ihn aber auch gefährlich, denn er tat nur genau das, was ihm gesagt wurde, jeder Handgriff musste ihm beigebracht werden. Er selbst stellte nicht nur eine Reihe unsinniger Fragen, er fasste auch alle Gegenstände und Kontrollen an, von denen er besser die Finger gelassen hätte. Es spielte zwar keine große Rolle, wenn Manuel aus reinem Entdeckertrieb hier einen Schalter betätigte und dort ein paar Köpfe drückte – im Augenblick reagierte im Schiff ohnehin nichts. Doch in dem Moment, wo die FERRUM wieder in den Normalraum zurückkehrte, konnte sich jede dieser Schaltungen als fatal erweisen.
Qui bekam schon nach kurzer Zeit mehr als genug von dieser Art Hilfsbereitschaft, dabei handelte es sich eher um eine Last denn um eine Hilfe.
„Geh in dein Zimmer und versuche deine Spielzeuge zu reparieren“, befahl er schließlich. Manuel Dorfmann setzte sich trotzig auf den Boden, betrachtete die verbogenen Einzelteile und steckte sie schließlich in die diversen Taschen seiner Bordkombi.
„Du bist gemein“, verkündete er und trollte sich. Qui schüttelte den Kopf. Was nützte es ihm, dass noch jemand einigermaßen bei sich war, wenn er von ihm keine Hilfe zu erwarten hatte? Er hoffte, dass Manuel von seiner Kabine aus keinen Unsinn anstellen konnte.
Die Zeit verging für Qui quälend langsam. Er war der einzige in der Zentrale, nein, im ganzen Schiff, der Herr seines Willens war. Auch er kämpfte mehr als einmal gegen den Ansturm der Memory-Spots, doch da er jetzt wusste, wie er sich dagegen wehren konnte, gelang es ihm jedes Mal, einen neuen Anfall abzublocken.
Der Zustand der Kameraden bereitete ihm hingegen große Sorgen. Trotz aller medizinischen Versorgung, die durch die Roboter vorgenommen wurde, kamen die Kommandantin oder einer der anderen nicht wieder zu sich. Die Schmerzen hatten die Kontrolle über den Körper übernommen, und die Erinnerungen beherrschten den Geist. Eine heimtückische und sehr wirkungsvolle Art, Menschen auszuschalten. Jedenfalls schien es keine Möglichkeit zu geben, dass einer der Kameraden wieder zu klarem Verstand kommen konnte.
Alienor Domestan, die Bordärztin, war ohnehin die einzige, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und auch Intuition in der Lage wäre, den Betroffenen Hilfe zu bieten. Doch sie lag ebenfalls am Boden – der Blick leer und in weite Ferne gerichtet, das Gesicht schmerzlich verzogen. Ihr Kreislauf war völlig zusammengebrochen, sie würde sich nicht einmal auf den Füßen halten können. Qui versuchte trotzdem, sie zu Bewusstsein zu bringen. Alienor blickte für einen Moment mit verschleierten Augen auf Qui und den neben ihm stehenden Robot, dann versank sie wieder im Dunkel der Erinnerungen.
Wie lange würde dieser Zustand noch dauern?
Der Übergang kam so abrupt, dass Quiberon Four es im ersten Augenblick nicht einmal bemerkte. Er war weiterhin damit beschäftigt, den Attacken der Memory-Spots auszuweichen. Und plötzlich war alles vorbei.
Die FERRUM schwebte im Weltraum, nicht weit vom Verteiler oder Schlund entfernt, trieb ohne Maschinenkraft umher und wurde zum Spielball der hier herrschenden Kräfte. Im nächsten Moment heulten alle Sirenen an Bord der FERRUM auf, und die künstliche Intelligenz der Tronic, Syd, meldete sich mit unzusammenhängenden Sätzen.
Lynsha Nash machte einen verzweifelten Versuch aufzustehen, doch die Beeinflussung auf ihr Gehirn hatte auch ihren Körper in Mitleidenschaft gezogen. Sie, wie auch die anderen, war noch längst nicht in der Lage, sich koordiniert zu bewegen, geschweige denn Anweisungen zu erteilen.
Alienor riss sich mühsam zusammen, kam taumelnd auf die Füße und schaute sich entsetzt um. Ihre Blicke streiften die Roboter, dann schimpfte sie leise.
„Sorge dafür, dass die Blechkästen verschwinden. Ich bin schon wieder okay.“
Ein bitteres Auflachen kam von Seamus O’Connell. „Du siehst aus wie ein Gespenst, wie willst du jemandem helfen?“, krächzte er und klammerte sich an eine Konsole. „Ich brauche Urlaub“, stellte er zusammenhanglos fest und setzte sich wieder auf den Boden.
„Halt den Mund“, brummte die Ärztin. „Es wird nicht mehr lange dauern, bis ich uns wieder auf die Beine bringe.“
Doch entgegen ihrer Vorhersage gelang es Alienor nicht, die angeschlagene Mannschaft wieder handlungsunfähig zu machen. Lynsha hockte zusammengesunken im Kommandosessel und presste immer wieder die Hände gegen die Schläfen. Ihre Augen waren auch weiterhin verschleiert, ihre Bewegungen langsam und manchmal unkoordiniert, aber sie zwang sich, das Kommando auszuführen.
Alle anderen, die von dem Para-Kontinuum-Phänomen betroffen waren, hatten ebenfalls versucht, wieder ihre Plätze einzunehmen, so dass die Zentrale im Augenblick eher einem Lazarett glich als dem Kommandostand des mächtigsten Raumschiffs der Erde.
Quiberon Four blickte sich ungläubig und fragend um. Unter diesen Umständen erschien es ihm völlig unmöglich, ein Raumschiff zu führen, auch wenn die Dringlichkeit gegeben war, diesen Ort schnellstens zu verlassen. Doch dann zog ein unerwartetes Geräusch die Aufmerksamkeit aller auf sich. Der Funkspruch, der permanent die Verbindung mit einem anderen irdischen Schiff aufbauen sollte, hatte endlich Erfolg. Unterbrochen von zahllosen Störungen meldete sich die RASUUN, und vor Erleichterung fiel Seamus O’Connell in Ohnmacht.
*
Andrew Frost schlug die Augen auf. Einen großen Unterschied machte das nicht, denn es war stockdunkel um ihn herum. Er setzte sich auf und fühlte einen stechenden Schmerz in seinem Kopf.
Wo war er? Wer war er?
Seine tastenden Hände fühlten eine relativ harte Matratze auf einem Gestell aus Metall, offensichtlich eine Art Feldbett. Arnos fuhr sich mit den Händen durch das Gesicht und presste dann die Handballen gegen die Schläfen, um die pochenden Schmerzen zu lindem. Wieso konnte er jedes Ding – alles was er fühlte und ertasten konnte – mit Namen benennen, nur sein eigener Name wollte ihm partout nicht einfallen?
Die vollkommene Stille um ihn herum irritierte ihn. Befand er sich in einem hermetisch abgeschlossenen Raum? In einem Keller? Andrew Frost tastete umher, konnte jedoch nichts weiter entdecken. Der Boden wirkte glatt und kühl, es gab auch keine Hinweise darauf, wo sich dieser Raum befand. Andrew stand auf, die Hände weit ausgestreckt, tastete sich Schritt für Schritt voran, bis er auf eine glatte Wand traf. Da war kein Unterschied zum Boden, und er konnte keinen Ausgang entdecken, alle Wände wirkten gleich. Natürlich musste das nichts heißen. In dieser vollkommenen Dunkelheit war nicht festzustellen, ob er tatsächlich alle Wände untersucht hatte. Er hielt plötzlich inne. War es nicht viel wichtiger, darüber nachzudenken, wer er war? Alles andere würde sich dann vielleicht von allein ergeben.
Andrew Frost blieb stehen und versuchte seine Gedanken zu ordnen. Das Nachdenken verstärkte die Schmerzen in seinem Kopf noch, aber er wollte nicht einfach aufgeben. Seine Hände glitten nun an seinem Körper entlang. Er trug einen Anzug, und in den Taschen befanden sich Gegenstände. Seine Finger ertasteten eine kleine Chipkarte.
Eine Chipkarte? Woher wusste er so genau, was das war? Das absolut glatte Material wies an einem Rand einige Vertiefungen auf. Schriftzeichen? Ohne bemerkenswerten Übergang gab es einen blendenden Blitz in seinem Kopf. Schlagartig kehrte die Erinnerung zurück und versetzte ihm einen Schock.
Andrew Frost, Chef der Frost Space Company, kurz FSC genannt, Leiter eines Wirtschaftsimperiums mit einer gigantischen Arbeitsstation im Weltall. Man hatte ihn entführt, direkt aus der Asteroidenwerft.
Flüchtig zogen die letzten Eindrücke an ihm vorbei, jedenfalls diejenigen, an die er noch eine Erinnerung besaß. Er sah das entsetzte Gesicht von Eleni Papadopoulos, die Augen in Todesangst weit aufgerissen; drei Männer, die sich unglaublich sicher fühlten, obwohl sie gerade eines der schlimmsten Verbrechen begangen hatten, und dann folgte eine Explosion. Eleni war durch die Luft geschleudert worden, anschließend hatte sich Dunkelheit über ihn selbst gesenkt, und er hatte das Bewusstsein verloren.
Wie mochte es Eleni gehen? Ob sie die Explosion überlebt hatte? Und inwieweit hatte diese Explosion Verletzte oder Menschenleben gefordert? Wie hatte es überhaupt dazu kommen können, dass sämtliche Sicherheitsvorkehrungen versagt hatten? Thomas Montague würde sich bestimmt darum kümmern, und vermutlich würde er sich auch eine Menge Vorwürfe machen, weil es offenbar doch noch Schlupflöcher gegeben hatte, die er nicht entdecken konnte.
Andrew Frost bemerkte, dass er versuchte, sich selbst abzulenken. Er hatte Angst, eine völlig natürliche Reaktion, die ihm aber bestimmt nicht weiterhelfen würde. Wenn er heil aus dieser Geschichte herauskommen wollte, musste er einen kühlen Kopf bewahren und selbst etwas tun.
Zunächst einmal musste er mit seiner Angst fertig werden. Früher oder später würden sich seine Entführer zu erkennen geben und ihre Forderungen stellen. Die Frage war dann, um welche es sich handelte. Konnte er sie erfüllen und damit sein Leben retten? Die Antwort lautete wohl eher Nein. Aufgrund der Explosion musste Andrew Frost davon ausgehen, dass es sich um skrupellose Leute handelte, denen ein Leben nicht viel wert war. Selbst wenn er die Forderungen erfüllte, hieß das noch lange nicht, dass man ihn lebend gehen lassen würde.
Er tastete sich wieder zu dem Bett, auf dem er erwacht war. Hier gab es etwas, das ihm vertraut und bekannt vorkam, ohne dass er einordnen konnte, um was es sich handelte. Aufmerksam lauschte er, versuchte mit seinen Blicken die Dunkelheit zu durchdringen, und zwang sich zur Ruhe. Wenn er in Panik verfiel, würde ihm das nicht helfen. Da trotz aller Vorsichtsmaßnahmen diese Entführung gelungen war, handelte es sich um Leute, die über eine hervorragende Ausstattung verfügten und sicher keine Möglichkeit außer acht ließen, ihr Opfer in den Händen zu behalten. Wieder dachte er an Eleni, und ein schmerzhafter Stich durchfuhr ihn. Seine Stellvertreterin war fast unersetzlich. Sollte ihr etwas zugestoßen sein, würde er ...
Ja, was würde er dann tun? Im Augenblick sicher nicht viel. Die nüchterne Überlegung kehrte zurück, nachdem Andrew fast von seinen Gefühlen überwältigt worden war. Er nahm seine Umgebung jetzt mit geschlossenen Augen auf. Das war einfacher, ein kleiner Trick, um das Gehirn zu überlisten, denn die völlige Dunkelheit irritierte ihn. Mit geschlossenen Augen besaß er eine bessere Vorstellungskraft.
Das, genau das war es, was ihm vertraut vorkam. Dieser Geruch! Scharf nach Metall und verschiedenen chemischen Komponenten riechend, mit einer Beimengung von undefinierbaren Zusatzstoffen. Andrew war in diesem Moment sicher, sich an Bord eines Raumschiffs zu befinden. Auf dem Weg wohin? Und wer verfügte über Raumschiffe, die praktisch unkontrolliert durch das System fliegen konnten? Die Antwort lag so offen auf der Hand, dass sie schon fast wieder unglaublich schien.
Bevor der einsame Mann im Dunkeln aber noch weitere Mutmaßungen anstellen konnte, klang aus dem Dunkel eine Stimme auf.
„Andrew Frost, machen Sie sich bereit.“ Die Stimme klang klar und kalt, ohne Emotionen oder Modulationen, dennoch keine Maschine, dessen war sich der Mann sicher.
„Wozu soll ich mich bereit machen? Wollen Sie mich endlich freilassen? Wenn Sie jetzt noch Vernunft beweisen, ist es sicher noch nicht zu spät, um alles in Ordnung zu bringen.“
„Irrelevant“, kam kurz und knapp Antwort. „Halten Sie sich bereit, uns Rede und Antwort zu stehen.“
Mit einem kaum hörbaren Knacken wurde die Verbindung unterbrochen. Andrew lauschte den Worten noch eine Weile hinterher. Worüber sollte er Antworten geben? Man erwartete doch hoffentlich nicht, dass er über die Geheimnisse der FSC sprach? Selbst wenn er das wollte, würde er das nicht einfach können. Eine posthypnotische Sperre verhinderte den ungewollten Verrat, obwohl er natürlich die Möglichkeit besaß, diesen inneren Befehl aufzuheben. Und außerdem gab es noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, diese Sperre zu durchbrechen. Im Augenblick konnte er selbst jedoch nichts dagegen unternehmen.
Andrew spürte das Schlagen seines Herzens, er hatte Angst. Doch er würde den Teufel tun, seine unbekannten Entführer etwas davon merken zu lassen.
*
Die Troopers hatten auf eine Reihe von Erfolgen zu verweisen, die kaum jemandem bekannt waren.
Es handelte sich bei den Troopers um eine streng geheime Einsatztruppe der Spaceguard. Nur wenige der Führungsoffiziere waren eingeweiht in ihre Existenz, und noch weniger von ihnen wussten bis in alle Einzelheiten um die Hintergründe.
Jedes Mitglied der Troopers wurde sorgfältig aus der Truppe der Spaceguard ausgewählt. Mit dem Eintritt in diese ganz besondere Elitegruppe verloren die Leute alle Bindungen an ihr früheres Leben, alle jemals existierenden Daten der entsprechenden Person wurden gelöscht. Freunde und Familie – soweit überhaupt vorhanden – erhielten eine fingierte Nachricht, dass der- oder diejenige in einem Einsatz den Heldentod gestorben war. Die Disziplin bei den Troopers galt als mörderisch, jeder von ihnen würde mit offenen Augen in den Tod gehen, sollte es erforderlich sein. Und doch hatte bisher noch keiner abgelehnt, wenn das Angebot an ihn herangetragen worden war.
Die Troopers besaßen fast unumschränkte Vollmachten und wurden in kritischen und gefährlichen Situationen eingesetzt. Bezahlt wurde die geheime Eingreiftruppe aus einem Reptilienfonds, über dessen Ausgaben der Minister des Inneren niemandem Rechenschaft schuldig war. So kam es, dass die Troopers die bestmögliche Ausrüstung besaßen, die man für Geld in der Galaxis bekommen konnte. Trotzdem reichten die Mittel nicht immer, und der Oberkommandierende versuchte weitere Gelder aufzutreiben, ohne deutlich kenntlich zu machen, für wen sie bestimmt waren. Er war bei diesen Missionen außerordentlich erfolgreich, und niemand fragte nach, auf welche Weise er die Sponsoren überredete, großzügige Spenden zu leisten.
In der letzten Zeit hatten die Troopers nur einen ernsthaften Einsatz zu verzeichnen gehabt. Auf der Moonfactory hatten sie in einem überraschenden Handstreich Omar Ben Saleph festgenommen. Der Mann galt als Drahtzieher für die Anschläge auf der Asteroidenwerft und die Entführung von Andrew Frost. Man verdächtigte ihn auch, etwas mit den Attentaten auf Katta zu tun zu haben, doch die Beweislage war noch dünner als ohnehin schon. Es gab nur Indizien, die auf eine Täterschaft deuteten. Schwer fiel bei dieser Anklage jedoch ins Gewicht, dass ohne Ben Salephs Wissen nichts auf der Moonfactory geschah. Er befand sich jedenfalls in sicherem Gewahrsam und wurde intensiv verhört, schwieg bisher aber beharrlich.
Der Einsatz der Troopers war trotzdem als voller Erfolg zu betrachten, doch die Angelegenheit war damit noch lange nicht beendet. Das konnten die einzelnen Mitglieder jedoch nicht wissen. Sie bekamen und befolgten Befehle. Warum und von wem diese gegeben wurden, spielte keine Rolle, entscheidend war nur, dass sie befolgt wurden.
Ein Mitglied der Truppe, in der es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gab, war Georgina Blaisdale. Sie diente mit Herz und Seele in der Gruppe, soweit man bei der Konditionierung überhaupt noch von Herz und Seele sprechen konnte. Sie besaß hervorragende Reflexe, überaus komplexe Fähigkeiten im Kampf und befolgte jeden Befehl bis auf den Punkt genau. Aufgrund ihrer Kampfkraft hatte das Oberkommando sogar schon entschieden, dass ihre Gene zum Klonen freigegeben wurden, was unter strengste Geheimhaltung fiel. Das eigentlich verbotene Klonen war auf Dauer einfacher, als ständig durch kostenintensive und aufwendige Prüfungen neue Mitglieder zu rekrutieren. Das Klonen ersparte außerdem die Geheimhaltung innerhalb der Spaceguard, denn es musste früher oder später den einen oder anderen geben, der trotz aller Vorsichtsmaßnahmen nicht darüber schweigen konnte, dass es eine elitäre Truppe gab, die eigentlich im Verborgenen bleiben wollte.
Georgina war also ein perfekter Trooper, sie besaß nur einen Fehler, wenn man es denn einen Fehler nennen wollte. Sie war so sehr damit beschäftigt, Befehle zu befolgen, dass es ihr an Eigeninitiative mangelte. Trotzdem hatte sie den Ehrgeiz, in der Hierarchie weiter aufzusteigen. Das eine schloss das andere jedoch aus, was ihr bisher nicht bewusst geworden war. So stellte sie auch jetzt keine Fragen, als genau dieselbe Einsatztruppe zusammengestellt wurde, mit der sie bereits vor einigen Tagen die Moonfactory erobert hatte. Dennoch war sie ein wenig erstaunt, als sie beim Briefing hörte, dass es erneut gegen die Moonfactory ging.
Der Einsatzleiter stand vorne im Raum, die rund ein Dutzend Gruppenmitglieder hockten auf harten Stühlen, hielten den Rücken gerade und verfolgten mit den Augen Major Duncan McBride, der mit knappen Worten und ruhigen Bewegungen seine Anweisungen gab.
„Wir haben es hier mit dem einmaligen Fall zu tun, dass wir aufgrund einer anonymen Anzeige in den Einsatz gehen. Bisher wurde uns über die Hintergründe nicht viel erzählt, hier scheint es anders zu sein, denn es geht immerhin um ein Wirtschaftsimperium, das wir zum zweiten Mal aufsuchen werden. Dieser ernst zu nehmende anonyme Hinweis lässt Rückschlüsse zu, dass wir zur endgültigen Aufklärung des Falles zusätzliche Daten in den Speichern der Tronics finden werden. Die Regierung kann es nicht zulassen, dass sich eine eigene Gesetzgebung etabliert, egal wo oder wie auch immer, die außerhalb der Legalität steht. Nun – wir tun das auch in gewisser Weise, und doch vertreten wir Recht und Ordnung und natürlich das Gesetz, und wir sorgen dafür, dass sich auch andere Leute daran halten. Der Chef will, dass ihr in diesem Fall darüber informiert seid, weil unter Umständen die Gefahr besteht, dass jedem von uns mit einer Klage gedroht wird. Diese Klagen, falls sie erfolgen sollten, würden zwar grundsätzlich gegen die Troopers als ausführendes Organ laufen. Doch immerhin könnte das zu einer öffentlichen Anhörung fuhren, in deren Verlauf man euch als Zeugen aufrufen würde. Deshalb sollt ihr von vornherein wissen, um was es bei diesem Einsatz geht. Ich gehe nicht davon aus, dass einer von euch den Einsatz verweigert. Gibt es sonst noch Fragen? Falls nein, erkläre ich weitere Einzelheiten.“
Natürlich erhob sich keine Hand, in den Gesichtern der Leute fand sich eher Unverständnis. Diese Anweisung ergab keinen rechten Sinn. Jeder von ihnen führte seine Befehle aus und konnte dafür auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Befehlsnotstand nannte man das. Im Übrigen besaßen die Troopers Sonderrechte in jeder Beziehung, und niemand, nicht einmal der Premierminister, konnte ein Verfahren gegen die eigene staatliche Truppe anstrengen, mochte sie auch noch so geheim sein. Was steckte wirklich dahinter?
Die Mitglieder dieser Truppe wussten nicht, dass sie mit diesem rätselhaften Hinweis einer weiteren Prüfung unterzogen wurden. Wer von ihnen den Mut und Ehrgeiz besaß, Fragen zu stellen und sich für mehr zu interessieren als die reine Befehlsausführung notwendig machte, war womöglich geeignet für eine weitere Offizierslaufbahn. Vorgesetzte mussten schließlich in der Lage sein, selbständig zu denken und auch Risiken abzuwägen. Nun, man würde sehen, ob sich hier wenigstens einer fand, der bereit war, den Mund öffnen. Dann konnte man mit weiteren Prüfungen die endgültige Eignung testen.
Georgina gehörte nicht zu denen, die sich darüber hinaus Gedanken machte. Obwohl sie durchaus den Ehrgeiz hatte, in der Hierarchie aufzusteigen, fand sie es nicht notwendig, Anweisungen zu hinterfragen oder zusätzliche Informationen zu verlangen. Auf keinen Fall wollte sie negativ auffallen, doch positiv machte sie sich mit diesem Verhalten auch nicht bemerkbar. Aber sie war ein guter Soldat, wie sich im Einsatz immer wieder bewies.
Die Schiffe der Troopers flogen die Moonfactory an, riegelten auch aus dem Weltraum alles ab und kümmerten sich nicht um die lautstarken Proteste. Georgina gehörte zu denjenigen, die sich Einlass in die Büros verschafften, zusammen mit Denis O’Leary und Markus Berger. Der Haupteingang zum Bürotrakt war durch ein schweres Schott verschlossen. Georgina betätigte die Com-Anlage neben dem Schott. Das abweisende Gesicht eines jungen, relativ ängstlich dreinschauenden Mannes erschien.
„Öffnen Sie, sofort! Hier ist die Eingreiftruppe der Spaceguard. Sie haben allen Anweisungen unbedingt Folge zu leisten. Sollte es Widerstand geben, sind wir berechtigt, Gewalt anzuwenden.“
Der Mann schluckte, setzte mehrmals zum Sprechen an und holte dann tief Luft.
„Ich habe strikte Anweisung, niemanden hereinzulassen“, presste er schließlich hervor.
„Das gilt nicht für uns. Wir haben unsere Befehle, die durch Anweisungen aus dem Ministerium gesichert sind“, behauptete Georgina. „Öffnen Sie auf der Stelle, sonst werden wir uns den Weg freischießen. Und anschließend wollen wir Awanda Singhal und Sondra Perkins sprechen.“
„Das ... das geht nicht“, kam die ängstliche Antwort.
„Geht nicht gibt es nicht“, behauptete Denis O’Leary. „Schluss jetzt mit dem Theater.“ Er legte die Waffe an und zielte auf den Verschlussmechanismus. Ein blendend heller Strahl löste sich aus der Waffe und traf das Schloss. Da es sich um einen thermonuklear-verdichteten Stahl handelte, hatte der Beschuss nicht sofort Erfolg.