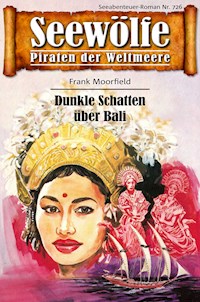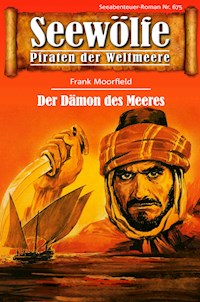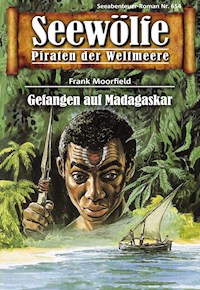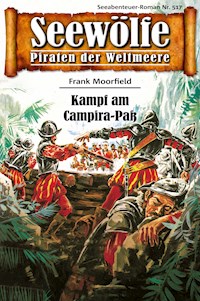Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Hasard und seine Männer wirbelten herum - da sahen sie, daß Concarneau gar nicht so menschenleer war, wie sie geglaubt hatten. Plötzlich, wie herbeigezaubert, tauchten überall Soldaten auf. Die Läufe zahlreicher Musketen waren drohend auf die zwölf Männer gerichtet. Selbst in den Fensteröffnungen einiger Häuser blinkte das Metall von Gewehrläufen. Aus einer dunklen Türnische trat ein schwergewichtiger Mann mit rotem Gesicht und weißem Oberlippenbart auf Hasard und seine Männer zu und erklärte sie für festgenommen. Es wäre Wahnsinn gewesen, sich in dieser Situation zur Wehr zu setzen - sie wären zusammengeschossen worden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2017 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.ISBN: 978-3-95439-690-0Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
Jetzt, in der Mitte des Monats November 1592, schien sich die Sonne ganz von der zerklüfteten Küstenlandschaft der Bretagne und der kabbeligen Wasserfläche des Atlantiks zurückgezogen zu haben. Am Himmel segelten bleigraue Wolkenfetzen entlang, die sich irgendwo hinter der östlichen Kimm verloren. Es war kühl, und der kalte Wind strich leise singend durch die Wanten und Pardunen der wracken Galeone, die vor der Nordküste der bretonischen Felseninsel Mordelles hilflos in der Dünung schaukelte.
Über das Hauptdeck der „Louise“, einstmals das Flaggschiff einer ganzen Piratenflotte, drang ein langgezogenes Stöhnen.
Yves Grammont wälzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht zur Seite. Die rechte Hand hatte er gegen die Rippen gepreßt, sein weißes Hemd war blutverschmiert.
Aber nicht nur die schmerzhaften Fleischwunden, die über den ganzen Oberkörper verteilt waren, ließen ihn aufstöhnen, sondern auch die unbändige Wut, die sich wie ein Geschwür durch seinen Körper fraß. Er, Yves Grammont, einer der berüchtigsten Piratenkapitäne Frankreichs, hatte die größte Niederlage seines Lebens hinnehmen müssen. Jedesmal, wenn er daran dachte, wie dieser Philip Hasard Killigrew, den man den Seewolf nannte, ihn gedemütigt hatte, schloß er erneut in ohnmächtigem Zorn und blindwütigem Haß die Augen.
Mühsam versuchte Grammont auf die Beine zu kommen. Sein Blick fiel dabei auf Saint-Jacques, der sich nur wenige Schritte von ihm entfernt auf den Planken wälzte. Auch er, der ehemalige Kapitän der „Coquille“, stöhnte unter seinen Blessuren.
„Was, zum Teufel, ist mit dir los?“ fragte Grammont keuchend. Es gelang ihm, sich schwankend auf den Beinen zu halten. Sein Gesicht war kalkweiß, das Auge, das nicht von der schwarzen Binde verdeckt wurde, wirkte blutunterlaufen.
Saint-Jacques, der nicht besser aussah, drehte ihm den Kopf zu.
„Meine Schulter – und die Hüfte!“ stieß er hervor. „Verdammt, tu endlich was! Oder willst du, daß wir beide hier verrecken?“
Über Grammonts Lippen drang ein wütender Fluch.
„Schau mich an!“ zischte er. „Glaubst du vielleicht, daß ich noch wie ein Fohlen springen kann?“
Der flackernde Blick des Piratenführers tastete sich über die Decks der „Louise“ – oder vielmehr über das, was davon übriggeblieben war. Es gab tatsächlich noch einige Männer an Bord, die das Gefecht mit der „Hornet“ überlebt hatten. Außer fünf Kerlen aus seiner Bande, die teilweise apathisch auf den Planken hockten und, aus zahlreichen Wunden blutend, vor sich hin starrten, entdeckte er noch vier Engländer aus der Horde Easton Terrys, die ebenfalls auf seiner Seite gekämpft hatten. Auch sie sahen aus wie lebende Leichen.
Grammont wandte sich wieder dem verletzten Saint-Jacques zu.
„Warte einen Augenblick“, stieß er hervor, „ich werde mich um Verbandszeug kümmern. Irgendwo muß sich der verdammte Kasten mit den Quacksalbereien ja noch befinden.“
„Beeil dich“, winselte Saint-Jaques, der plötzlich um sein verlottertes Leben zu bangen schien, „beeil dich, oder ich krepiere!“ Wieder drang ein Stöhnen über seine schmalen Lippen.
Yves Grammont stolperte mehr, als daß er ging, auf das Schott des Achterdecks zu. Der große, athletische Mann, dem Kopftuch und Augenbinde ein verwegenes Aussehen verliehen, wirkte jetzt wie ein Greis, dessen Körper von der Gicht gekrümmt war. Unablässig fluchend bewegte er sich vorwärts. Die scharfen Windstöße, die über die Decks pfiffen, bemerkte er nicht. Ihm war heiß – vor Schmerz, Zorn und Haß.
Ja, er hatte sich tatsächlich zu früh die Hände gerieben, weil er den Seewolf gewaltig unterschätzt hatte. Der größte Teil seiner Flotte war von den beiden englischen Galeonen und diesem unheimlichen Schwarzen Segler mit den Nordmännern an Bord versenkt worden. Wenn man einmal von den Verlusten der vergangenen Tage und Nächte absah, hatten auch jetzt, beim letzten Gefecht, wieder mehrere Schiffe daran glauben müssen.
Die „Coquille“ und eine Karavelle des Viererverbandes aus Saint-Nazaire waren versenkt worden. Eine weitere Galeone war durch die fürchterlichen Höllenflaschen der englischen Bastarde zerfetzt worden, und das letzte noch intakte Schiff hatte sich in Anbetracht der gewaltigen Schlagkraft der Engländer hinaus auf See verzogen.
Die „Louise“, auf der er selbst blutend zurückgeblieben war, erinnerte nur noch in Fragmenten an ihr einstmals so stolzes Aussehen.
Auch an Menschen hatte Yves Grammont gewaltige Einbußen erlitten. Pierre Servan und Jean Bauduc waren tot. Desgleichen Ferret, Jules Arzot und zahlreiche andere Männer aus seiner Bande. Zudem hatten noch einige der englischen Meuterer, die unter Terrys Führung für ihn gekämpft hatten, ins Gras beißen müssen. Darunter auch Halibut, der Kerl mit der platten Nase und dem stumpfsinnigen Gesichtsausdruck. Easton Terry lebte zwar noch, aber er war von den Seewölfen gefangengenommen worden.
Yves Grammont fand die Holzkiste, in der das Verbandszeug aufbewahrt wurde. Stöhnend und mit zusammengebissenen Zähnen versorgte er seine Wunden. Dann schleppte er, müde und gebeugt, die Kiste an Deck, um auch Saint-Jacques und die anderen Männer zu verbinden.
Der Kapitän der gesunkenen „Coquille“ lag immer noch wimmernd auf den Planken.
„Ich – ich sterbe! Mon dieu – ich verblute!“ jammerte er. Hilfesuchend streckte er Grammont eine Hand entgegen.
Doch der Bandenführer war aus härterem Holz geschnitzt.
„Hör auf mit dem Gejammer!“ fauchte er Saint-Jacques an. „Bist du ein Mann oder ein verheultes Weibsstück, he? So schnell, wie du meinst, stirbt man nicht! Jetzt hoch mit dir, sonst kann ich dich nicht verbinden!“ Obwohl selbst noch auf wackligen Beinen stehend, packte er den Verletzten, richtete dessen Oberkörper auf und legte ihm die nötigen Verbände an.
Dann nahm er sich die übrigen Kerle der Reihe nach vor, deren Verletzungen jedoch weniger schwer waren. Meist hatten sie Beulen oder Schrammen davongetragen.
„Macht, daß ihr so rasch wie möglich wieder auf die Beine kommt!“ brüllte Grammont sie an. „Wir können uns nicht auf die faule Haut legen und auf den Winter warten. Wenn es diesem Killigrew einfällt, kehrt er zurück und schießt uns endgültig in Fetzen!“
Diese düster gefärbten Zukunftsaussichten schienen zu wirken. Einer nach dem anderen raffte sich auf.
Grammont arbeitete sich abermals über die Trümmer weg und drang bis zum Achterkastell vor. Da hörte er plötzlich einige klatschende Geräusche. Reflexartig fuhr er herum und verzog dabei das Gesicht zu einer Grimasse, weil die jähe, unkontrollierte Bewegung ihm erneute Schmerzen bereitete.
Da aber sah er, was geschehen war.
Die vier Engländer, die mit Terry an Bord gewesen waren, schienen sich verholen zu wollen. Jedenfalls waren sie über Bord gesprungen und schwammen mit weit ausholenden Bewegungen auf die Insel zu – wahrscheinlich, um sich dort zu verkriechen.
Grammont spuckte verächtlich auf die Planken.
„Feiges Pack!“ brüllte er. „Paßt auf, daß euch die vollen Hosen nicht nach unten ziehen!“
Im ersten Moment verspürte er das Verlangen, sich ein Tromblon zu holen und den feigen Burschen einige Ladungen gehacktes Eisen und Blei nachzuschicken, dann aber verzichtete er darauf. Sollten sie doch abhauen! Mit diesen Mistkerlen war sowieso nichts mehr anzufangen.
Er trat an die zerfetzte Schmuckbalustrade des Achterkastells und warf einen Blick auf die fünf Männer aus seiner Bande.
„Und ihr?“ brüllte er. „Wollt ihr auch die Ärsche zukneifen und verschwinden?“
Die verludert aussehenden Kerle, die alle irgendwelche Verletzungen abgekriegt hatten, blickten sich einen Atemzug lang irritiert an.
Dann brüllte einer von ihnen zurück: „Sind wir vielleicht Engländer, he?“
Über das Gesicht Grammonts huschte seit langer Zeit das erste Grinsen.
„Gut so!“ rief er zurück. „Wir geben noch lange nicht auf! Und wir werden eine Gelegenheit finden, uns an den englischen Bastarden zu rächen!“ Schweren Schrittes stapfte er ins Achterkastell und suchte dort seine Kapitänskammer auf.
Aber dort wartete eine neue Überraschung auf ihn, und zwar eine verdammt böse Überraschung.
In der Kammer sah es aus, als hätten die Vandalen gehaust. Selbst eine Kanonenkugel hätte kein größeres Durcheinander anrichten können. Es hatte hier ganz offensichtlich ein Kampf stattgefunden. Aber warum gerade in der Kapitänskammer? Alles lag kreuz und quer übereinander. Schapps und Spinde waren aufgerissen worden, ihr Inhalt lag verstreut auf den Bodenplanken. Selbst die Koje hatte man auseinandergenommen.
Erst als der Blick Grammonts auf das Brettergeviert seiner Koje fiel, begriff er, was hier tatsächlich geschehen war.
„Das Gold!“ murmelte er vor sich hin. „Bei allen Teufeln und Heiligen – das Gold ist weg!“ Diese Erkenntnis traf ihn wie ein Hammerschlag und ließ ihn für einen Augenblick sämtliche Schmerzen vergessen.
Hastig arbeitete sich Grammont an die Koje heran, schleuderte die aufgestemmten Bretter zur Seite und griff in die Nische, in der er eine Schatulle voller Goldmünzen versteckt hatte.
Er hatte sich nicht getäuscht. Das Versteck war leer, die Schatulle war weg.
Es handelte sich zwar nicht um unermeßliche Reichtümer, aber dennoch hatte er dort einen recht erheblichen Anteil von den Geldern versteckt, die er bis jetzt von den Spionen des spanischen Hofes für seine Störaktionen gegen englische Schiffe erhalten hatte.
Yves Grammont richtete sich mit irrem Blick auf. Aus seiner Kehle löste sich ein Schrei, der die wracke Galeone bis in die letzten Verbände erzittern ließ. Und die Flüche, die sich diesem Schrei anschlossen, ließen mit Sicherheit nicht nur alle Heiligen, sondern auch sämtliche Dämonen der Hölle erblassen.
Der Piratenführer wankte wie ein Betrunkener aus der Kapitänskammer. Den Verlust von Schiffen und Menschen – den ertrug er gerade noch. Aber das Verschwinden einer großen Schatulle, angefüllt mit Münzen aus purem Gold, das konnte auch einen Mann wie Yves Grammont aus den Stiefeln heben.
„Der Himmel hat sich gegen mich verschworen“, stammelte er. „Alle lichten und dunklen Mächte müssen sich gegen mich zusammengerottet haben!“
Er hatte gar nicht so unrecht mit diesen finsteren Vermutungen, denn das Schicksal hielt an diesem schwarzen Tag noch weitere Überraschungen für ihn bereit.
Die nächste begegnete ihm bereits, als er das Achterkastell verlassen wollte. Das leise, aber anhaltende Zischen, Gurgeln und Plätschern entging ihm nicht. Und er registrierte auch, daß diese Geräusche aus dem Inneren der gemächlich dahintreibenden „Louise“ drangen, genauer gesagt: aus den unteren Schiffsräumen.
„Was ist los mit dir? Warum hast du so laut gebrüllt?“ fragte Saint-Jacques, der sich in der Zwischenzeit ebenfalls wieder aufgerafft hatte und Grammont mühsam zum Achterkastell gefolgt war.
Aber der Bandenführer bedachte ihn statt einer Antwort mit einem Blick, der Wut, Haß und Entsetzen zum Ausdruck brachte. Wortlos deutete er mit dem Zeigefinger nach unten.
Da hörte auch Saint-Jacques das Plätschern und Gurgeln. Seine tiefliegenden Augen weiteten sich vor Schreck, dann stützte er sich auf die Reste der Schmuckbalustrade, während Grammont unter Deck verschwand, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Als der Piratenkapitän zurückkehrte, strahlte sein Gesicht eine geradezu unheimliche Ruhe aus. Und Saint-Jacques wußte augenblicklich, daß es die Ruhe vor dem großen Sturm war. Er wagte jetzt nicht, eine Frage zu stellen, sondern blickte dem Kapitän der „Louise“ lediglich stumm entgegen.
„Die Stunden der ‚Louise‘ sind gezählt“, sagte Grammont mit fast tonloser Stimme. „Das Wasser in den unteren Räumen steigt unaufhaltsam. Selbst wenn wir hundert Mann an Bord hätten, könnten wir die Lecks nicht mehr rechtzeitig abdichten.“
„Aber – warum Lecks?“ stammelte Saint-Jacques, dem jetzt kalte Schauer über den Rücken jagten. „Wir haben doch keinen Treffer unterhalb der Wasserlinie abgekriegt!“
Grammont nickte.
„Das nicht. Aber bevor die Hunde das Schiff verließen, haben sie es angebohrt! Und glaube mir, sie haben ganze Arbeit geleistet!“
Für einen Augenblick schien es, als habe sich Yves Grammont resigniert in sein Schicksal gefügt. Aber Saint-Jacques kannte ihn, er wußte instinktiv, was noch folgen würde.
Und es folgte.
Urplötzlich, wie der Ausbruch eines gewaltigen Sturmes, brüllte Grammont auf, fuhr herum und trommelte mit den Fäusten gegen die Wände des Achterkastells. Er schrie, spuckte, tobte und raste wie ein Irrsinniger. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen das Holz, als müsse er ganze Mauern einrennen. Vor seinen Mund trat Schaum, und sein unheimliches Gebrüll erinnerte an eine Ochsenherde, die man zur Schlachtbank führt.
Saint-Jacques, der schon manchen Tobsuchtsanfall Grammonts miterlebt hatte, wich entsetzt zurück, denn jetzt – jetzt packte ihn tatsächlich die nackte Angst.
2.
Der Dreierverband, der mit achterlichem Wind auf das bretonische Hafenstädtchen Concarneau zusegelte, sah rein äußerlich recht harmlos aus.
Die beiden englischen Dreimastgaleonen „Hornet“ und „Fidelity“ wirkten wie Handelsschiffe. Aber genau das waren sie nicht. Entsprechend dem Geheimauftrag der englischen Königin, der seinen geheimen Charakter durch den Verrat Easton Terrys längst verloren hatte, waren die Segler hervorragend armiert. Beide waren mit je zwanzig Culverinen und sechs Drehbassen bestückt, wenn man von den Schleudervorrichtungen absah, mit denen man hochgefährliche Flaschenbomben auf die Reise schicken konnte.
Die „Hornet“ segelte unter dem Kommando Philip Hasard Killigrews, des Seewolfs, und die „Fidelity“ stand unter der Befehlsgewalt von Jerry Reeves, der den verräterischen Easton Terry als Kapitän abgelöst hatte.
Das dritte Schiff, eine merkwürdige Mischung aus Galeone und fernöstlicher Dschunke, mit schwarzem Rumpf und ebenso schwarzen Segeln, trug den poetischen Namen „Eiliger Drache über den Wassern“, wurde aber meist nur der Schwarze Segler genannt. Er stand unter dem Kommando Thorfin Njals, des Wikingers, der dem Seewolf und seinen Männern sehr eng verbunden war.
Die „Hornet“, bei deren Kapitän die Leitung des ganzen Unternehmens lag, fuhr als Flaggschiff, die „Fidelity“ und der Schwarze Segler, der erst vor kurzem zufällig mit den Seewölfen zusammengetroffen war, folgten ihr in Dwarslinie.
Die Ereignisse der letzten Stunden waren auf den drei Schiffen Gegenstand vieler Gespräche und Debatten. Alle waren froh darüber, daß es ihnen gelungen war, Yves Grammont, dem Handlanger der spanischen Spione, eine weitere vernichtende Niederlage zugefügt zu haben. Aber sich so richtig darüber freuen – nein, das konnte im Augenblick niemand.
Das, was insbesondere den Seewölfen an Bord der „Hornet“ an die Nieren ging, war das ungewisse Schicksal Paddy Rogers. Die Unklarheit über das, was mit dem bulligen Mann mit den roten Haaren und der gemütlichen Knollennase geschehen würde, schwebte wie ein dunkler Schatten am Horizont.
Und alle Gespräche und Diskussionen dienten letztlich nur dazu, die Nervosität und die bange Erwartung dessen, was vielleicht eintreten könnte, zu überdecken. Die Gedanken aller kreisten immer wieder um das, was zur Zeit in einer stillen Kammer des Achterdecks geschah.
Dort würde sich das weitere Schicksal Paddys – zwar nicht grundlegend, aber doch zu einem großen Teil – entscheiden.
Paddy Rogers lag schwer atmend auf einem langgestreckten Tisch. Die Musketenkugel, die Lucio do Velho, der Anführer der spanischen Spione, ohne Vorwarnung auf ihn abgefeuert hatte, war ihm in die Brust gedrungen. Paddy war zwar am Leben geblieben, aber bis zur Stunde wußte niemand, welche inneren Verletzungen das Geschoß herbeigeführt hatte. Im Augenblick sah es schlimm um ihn aus.
In der Achterdeckskammer brannten mehrere Talglampen, denn ausreichende Sicht war eine Grundvoraussetzung für das Gelingen einer Operation. Niemand durfte den Raum betreten außer denjenigen, die dem Kutscher zur Hand gehen sollten. Der Seewolf, als Kapitän der „Hornet“, hatte natürlich ebenfalls Zutritt.