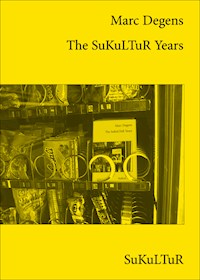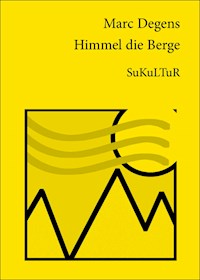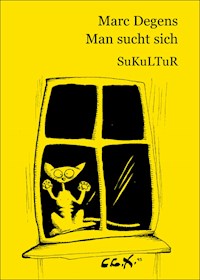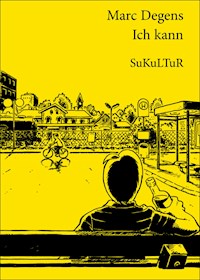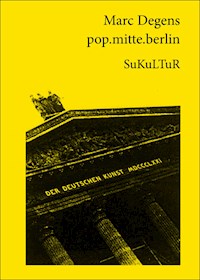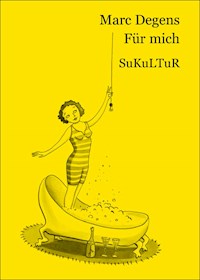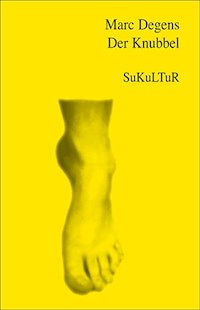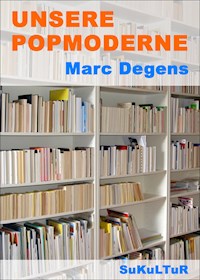Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass Herr Rutschky in seinen Tagebüchern nicht über Susan Sontag schreibt, sondern über ihn, und nicht einmal schmeichelhaft, das ist für Marc Degens Ausgangspunkt für ein virtuoses Stück Autofiktion. Sein Bericht über ein Stück höfische Kultur im 21. Jahrhundert und was sie anrichten kann, hat es in sich. Wie das eigene Leben von den hierarchischen Zufällen in einem eifersüchtig umtanzten Intellektuellen-Zirkel hin und her geworfen wird und welche Kollateralschäden dabei drohen, diese überaus ernsthafte komische Geschichte wurde so noch nie erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Degens
Selfie ohne Selbst
»Man ist, was man verschweigt.«
@denkkerker
Um neunzehn Uhr sind Herr Rutschky und ich in der »Bar Centrale« in der Yorckstraße in Berlin verabredet. Ich bin schon ein paar Minuten früher am verabredeten Ort, vor der Bierkneipe nebenan sitzt mein früherer Agenturkollege Kristof Magnusson an einem Tisch vor einem Haufen Notizen und schreibt. Wir unterhalten uns kurz, dann sehe ich auch schon Herrn Rutschky um die Ecke kommen und verabschiede mich von Kristof. Ich begrüße Herrn Rutschky, und wir beide setzen uns in das vornehme italienische Restaurant, in dem wir uns schon Ende der neunziger Jahre, noch bevor ich nach Berlin gezogen war, regelmäßig getroffen hatten. Das Treffen ist sehr schön. Er trinkt Weißwein, ich Bier. Wir unterhalten uns über Toronto und das Leben in Kanada, dann endlich kommen wir auch auf seine Krebserkrankung zu sprechen. Herr Rutschky hat keine Haare mehr auf dem Kopf und bereits sechs Chemotherapien hinter sich. Seine prognostizierte Lebenserwartung betrage noch vier Jahre. Dann sei er fast achtzig, erzählt er mir, das reiche, irgendwann müsse auch mal Schluss sein. Ich nicke stumm. Anschließend sprechen wir über unsere Arbeit. Ich erzähle ihm von meinem neuen Romanprojekt, er wiederum berichtet von seinem nächsten Tagebuchband, der die Wendejahre bis 1992 darstellt. Ich frage ihn, ob er es jemals bereut habe, dass er keine Kinder hat. Herr Rutschky schüttelt den Kopf und sagt, er habe ja mich und die anderen jungen Menschen, zu denen er immer den Kontakt gesucht habe. Ich freue mich über diese Antwort. Zum Schluss lädt er mich ein, wie früher so oft, und sagt, wie charmant er den Abend fand. Wir sehen uns wieder, erklärt er zum Abschied zweimal. Ich hoffe, dass das stimmt, und freue mich bereits auf das Wiedersehen. Drei Tage später fliege ich zurück nach Kanada.
Im September bestelle ich mir sein gerade erschienenes zweites Tagebuch In die neue Zeit und lasse es mir nach Toronto schicken. Ein halbes Jahr später, als ich gerade dabei bin, eine E-Mail an Kathrin Passig zu schreiben, erhalte ich die Nachricht, dass Herr Rutschky in der Nacht gestorben sei. Ich fange an zu weinen. Dann ziehe ich seine Bücher aus dem Regal, breite sie auf dem Boden aus, fotografiere sie und veröffentliche das Foto auf Instagram, Twitter und Facebook.
so traurig, so dankbar #MichaelRutschky
Den Post verknüpfe ich mit einem Link zu einem Text von mir, den ich vor ein paar Jahren für ein Radiofeature geschrieben hatte: »Einen Meister habe ich nicht gehabt, aber einen Mentor: Michael Rutschky. Ich kenne einige Autoren, die durch die sogenannte ›Rutschky-Schule‹ gegangen sind – ich glaube, dieses Wort ist tatsächlich angebracht. Ich habe Michael Rutschkys Bücher bewundert, ihn angeschrieben, damals war ich noch Student. Michael Rutschky wohnte in Berlin, ich im Ruhrgebiet, auf dem Germanistentag 1997 in Bonn haben wir uns das erste Mal getroffen. Ich wollte freier Autor werden, wusste aber nicht wie, natürlich hatte ich viele berechtigte Ängste. Immer wenn ich später in Berlin war, habe ich mich bei Michael Rutschky gemeldet, und er hat mich zum Bier eingeladen. Über meine Texte haben wir eigentlich nie gesprochen; er hatte einen Aufsatz von mir in seiner Zeitschrift Der Alltag veröffentlicht, das reichte mir als Bestätigung. Michael Rutschky hat mich gefördert, indem er mich weiterempfahl, er hat mich beraten, oft vergeblich, und er hat mir viele Lektüretipps gegeben. Am wichtigsten aber war für mich sein Vertrauen: ›Herr Degens, Sie gehen schon ihren Weg.‹«
In meinem Kopf schwirren ganz viele Gedanken. Einer der ersten: Ich muss ihm auch Eriwan widmen. Nicht nur Katharina Rutschky, seiner acht Jahre zuvor verstorbenen Ehefrau, der ich das Versprechen gab, das Buch zu schreiben. Quälend stelle ich mir immer wieder eine Frage: Warum bloß habe ich die beiden damals nicht zu meiner Hochzeit eingeladen? Alexandra zeigt mir einen Facebook-Post von René Kemp: »Heute ist kein schöner Tag, denn heute ist Michael Rutschky gestorben, von dem ich ja auch den Nachnamen geklaut habe, für dieses shithole hier. Sein Foto-Buch Auf Reisen ist immer noch eines der besten Foto-Bücher überhaupt, und wer die deutsche Sprache mag, der wird nicht anders können, es auch zu lieben.« In den nächsten Tagen lese ich viele Nachrufe auf Herrn Rutschky und persönliche Erinnerungen. Die detailliertesten und ergreifendsten veröffentlicht Kurt Scheel auf dem von Herrn Rutschky gegründeten Blog Das Schema. In einem Eintrag schreibt er über die letzten Wochen seines Freundes: »Was wird aus [seinem Hund] Quarto? Das war seine größte Sorge. Und was wird aus dem Tagebuchprojekt? [Sein Verleger] Berenberg hatte gesagt, er wolle einen dritten Band, 1993 bis 2017, herausbringen. Etwa die Hälfte des Manuskriptes liege vor, er bräuchte noch ein Vierteljahr, um das abzuschließen, ›Sonst musst du das mit Berenberg fertigmachen, es muss ja nichts neu geschrieben werden, man braucht eigentlich nur einen guten Herausgeber.‹«
Am zweiten Montag im April schreibt mir David Wagner, dass am Mittwoch die Seebestattung von Herrn Rutschky stattfinden wird, von einem Boot von Warnemünde aus. Am Freitag lese ich auf Das Schema den schönen Eintrag von Kathrin über die Bestattung im 1A-Rutschky-Ton: »Die Trauergäste sehen noch minutenlang ins Wasser, wohl um sicherzugehen, spottet R. insgeheim, dass das Ding nicht doch noch mal auftaucht. Zum anschließenden Essen ins Restaurant ›Kettenkasten‹ kommt er aber nicht mehr mit. Was da geredet wird, weiß man ja.« In der Woche darauf erhalte ich eine kryptische E-Mail von Kurt Scheel: »Gedenkfeier Michael Rutschky: Aus meinem Mail Buch«. Darunter folgt eine Liste mit sechzehn Namen, fünfzehn Männer und eine Frau. Die E-Mail ist an Jörg Lau adressiert, der, wie ich aus Scheels Blogbeiträgen weiß, Herrn Rutschkys »Universalerbe« sei. Ich bin cc gesetzt, so wie alle anderen in der Liste Genannten. Am selben Tag antworte ich ihm per E-Mail und bedanke mich für seinen Blogeintrag vom 22. März. Ich schildere meine Freude, dass Das Schema weiterlebt und von ihm so vortrefflich bespielt wird. Ich erzähle, dass ich gerade am Bücherkistenpacken bin, weil ich im Juli von Kanada aus zurück nach Deutschland ziehen werde und mich schon sehr auf meine Freunde und das Wiedersehen mit ihm freue.
Im Juni lese ich auf Das Schema von Kurt Scheels Arbeit am dritten Band der Tagebücher, der im kommenden Frühjahr wieder im Berenberg Verlag erscheinen soll und dessen Herausgabe Kurt Scheel betreut. Darin schreibt er über seine Empfindungen bei der Lektüre und verrät, »dass ich nach Michaels Tod beim Lesen der Tagebücher 1996 bis 2015 schockiert war, entsetzt, traurig, ich hatte keine Ahnung, wie finster ihm zumute, wie depressiv er war. Das hatte ich so nicht mitbekommen, das hatte niemand aus dem engeren Freundeskreis gewusst. Michael war mit sich und der Welt zerfallen, und er ist offenbar auch mit dem Altern noch schlechter fertig geworden als wir anderen, hat das aber gut zu kaschieren gewusst. Wütend war ich auch, gekränkt, dass er mir und anderen Freunden gegenüber in den Tagebuchaufzeichnungen häufig unwohlwollend, dieses Wort habe ich mir dann ausgedacht, entgegentritt.« Kurt Scheel bedauert, dass Herr Rutschky in den Tagebüchern nur Negatives notiert habe, über sich und seine Freunde: »Sicher sind seine Tagebücher eine psychologische Fundgrube und eine eindrucksvolle Selbstentblößung, vielleicht sind sie sogar, wie Michael offenbar glaubte, sein wichtigstes Werk, aber für jemanden, der ihn geschätzt und bewundert hat, ist es keine heitere Lektüre; für jemanden, der ihn geliebt hat, ist es eine herzzerreißende Lektüre – bleibt zu hoffen, dass der Rest der Menschheit das anders und entspannter sieht.«
Der Juli-Merkur enthält eine Herrn Rutschky gewidmete Rubrik. Im Editorial heben die Herausgeber seine Rolle für den Merkur hervor. »Wichtig war er zudem als Mentor von jüngeren Autorinnen und Autoren, von Rainald Goetz bis Kathrin Passig, von Gerhard Henschel bis Marc Degens.« Der Sonderteil besteht aus sechs Erinnerungen von Weggefährtinnen und Weggefährten. David schreibt über seinen letzten Spaziergang mit Herrn Rutschky und Kurt Scheel über die Seebestattung. Der letzte Beitrag stammt von Jörg Lau, seinem Nachlassverwalter, der auch auf Herrn Rutschkys hinterlassene Tagebücher zu sprechen kommt. »Herr Rutschky war, wie ich erstaunt feststelle, stark getrieben vom Neid auf weniger begabte, aber erfolgreichere Kollegen. Er registriert schonungslos die Wut auf seine Frau, die erfolgreich mit ihm als Autorin konkurriert, dabei jedoch unter schweren Arbeitsstörungen leidet, die sie fatalerweise mit Alkohol bekämpft.« Jörg Lau berichtet über seinen Schrecken beim Lesen, hält die Tagebücher, die auch offensichtlich für die Veröffentlichung bestimmt waren, trotzdem für Herrn Rutschkys Hauptwerk: »Die oft schockierende Indiskretion wird durch stilisierte Kühle erträglich.« Das Editorial endet mit dem Satz: »Wir, die Rutschky-Leser dürfen die postumen Tagebuch-Veröffentlichungen mit Spannung und wohl auch mit Bangen erwarten.«
Am 2. August erhalte ich die traurige Nachricht, dass Kurt Scheel gestorben ist. Auf taz.de lese ich den Nachruf von Jan Feddersen. David schreibt mir, dass Herr Scheel sich das Leben genommen habe. Traurig gehe ich auf den Balkon und rauche. Im Merkur-Blog lese ich später eine Erinnerung von Karl Heinz Bohrer an Kurt Scheel: »Er war im Leben und Tod einer der mir fremdesten Menschen, die ich kenne und gekannt habe. Oder sollte ich sagen: einer der ungewöhnlichsten?« Ich empfinde genauso. Ich habe Herrn Scheel sehr gemocht, seine Großzügigkeit, sein Schwärmen. Ich und John Wayne. Scheels Porträts in Rutschkys Home-Movie Die Lebensalter war mir eines der sympathischsten, wie er mit der Katze auf dem Bauch auf seinem Sofa lag und erzählte. Gleichzeitig gab es die Fremdheit. Einen Abstand, eine persönliche Distanz, die viel gravierender war und viel mehr ins Gewicht fiel als der Altersunterschied von knapp zweieinhalb Jahrzehnten.