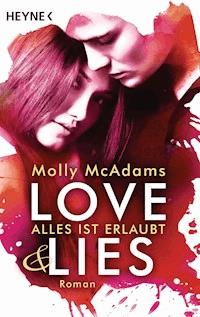Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Auch wenn immer wieder das Gegenteil behauptet wird: Die sexuelle Revolution der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat nicht alle Frauen Deutschlands erreicht. Leonore von Megenburg gehört dazu. Aufgewachsen in einem gutbürgerlichen und konservativen Elternhaus im Südwesten der Republik, geprägt von den Regeln und Verboten der katholischen Kirche, geht sie als Jungfrau in die Ehe und versucht auch dort, eine gottgefällige junge Frau zu sein und zu bleiben. Im Lauf der Jahre, nicht zuletzt unter dem Einfluss ihres Ehemanns und ihrer pubertierenden Kinder, kommen ihr zunehmend Zweifel an ihrem Verhalten, die sie allmählich ihre Einstellung zur Sexualität überdenken und letztendlich auch ändern lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Igittigitt
Zwiespalt
Höhepunkt
Alltag
Öffnung
Epilog
Die Autorin
Prolog
Sie haben es sich sicherlich schon gedacht: Leonore von Megenburg ist nicht mein wirklicher Name. Auch bin ich nicht adlig. Aber Sie werden nach der Lektüre des Buches verstehen, dass ich meinen wahren Namen nicht preisgeben will. Denn ich entstamme einer gutbürgerlichen Familie, und durch meine Heirat hat sich mein Status nicht geändert: Auch meine eigene Familie gehört dem gehobenen Mittelstand an. Ich würde also meiner ursprünglichen wie auch meiner jetzigen Familie Schmerz bereiten, wenn mein wahrer Name bekannt würde. Dabei ist das, was ich zu erzählen habe, aus heutiger Sicht keineswegs besonders: Ich bin weder ins Drogenmilieu noch in das Reich der Prostitution abgeglitten. Aber ich habe mich aufgrund meiner Herkunft und meiner Erziehung eigentlich mein ganzes Leben lang mit Sexualität schwergetan. Und jetzt, da ich meinen 60. Geburtstag seit einiger Zeit überschritten habe, möchte ich es mir von der Seele schreiben. Denn meiner Überzeugung nach ist meine Geschichte keineswegs derart außergewöhnlich oder einmalig, dass ich die Einzige wäre, der es so ergangen ist. Ich glaube vielmehr, dass es viele Leonores von Megenburg in (West-) Deutschland gegeben hat, Frauen, die in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts geboren wurden und an denen die Errungenschaften der sexuellen Revolution ohne größeren Einfluss einfach vorbeigezogen sind. Nicht dass sie nicht davon gehört hätten, aber ihre individuellen Umstände haben es ihnen aus welchen Gründen auch immer mehr oder weniger unmöglich gemacht, davon zu profitieren. All diesen Frauen möchte ich Gehör verschaffen.
Es kommt natürlich auf die Situation der einzelnen Frau an, und da hatte ich im Hinblick auf meine Sexualität nicht die besten Startchancen. Ich wurde im Süden von Rheinland-Pfalz geboren, einem eher landwirtschaftlich geprägten Gebiet, in dem Tradition und Religion zu dieser Zeit – wir reden hier von den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg – (noch) eine sehr große Rolle spielten. Meine Eltern entstammten einer Handwerker- und einer Winzerfamilie aus kleinen Dörfern in der Umgebung der Kreisstadt, in der ich die ersten Jahre meines Lebens verbrachte. Meine Mutter war strenggläubige Katholikin, mein Vater Protestant, der seine Religion allerdings auf Druck seiner späteren Frau noch vor der Hochzeit aufgegeben hatte und zur römisch-katholischen Kirche übergetreten war. Das war der ausdrückliche Wunsch – man konnte durchaus auch sagen, die Bedingung – meiner Mutter und ihrer Familie gewesen, damit an diese Eheschließung überhaupt nur zu denken war. Und wie ich später noch feststellen musste: Konvertierte Protestanten konnten noch katholischer als strenggläubige Katholiken sein; mein Vater war so einer.
Der katholische Glaube beziehungsweise die Anweisungen der Institutionen der katholischen Kirche prägten das familiäre Leben von Anfang an stark. Der sonntägliche Gottesdienst war Pflicht und in gewisser Hinsicht der Höhepunkt der Woche, selbstverständlich wurde vor jeder Mahlzeit und vor dem Zubettgehen gebetet, Vertreter der katholischen Kirche waren uneingeschränkte Autoritätspersonen, Priester, Diakone, selbst Gemeindeschwestern. Durch die Regeln der katholischen Kirche waren aber auch die Moralvorstellungen meiner Eltern geprägt. Selbstverständlich habe ich niemals mit meinen Eltern über Sexualität gesprochen – auch in der Zeit meiner Pubertät war dieses Thema tabu –, doch glaube ich im Lauf meines Lebens verstanden zu haben, dass für sie Geschlechtsverkehr ausschließlich der Fortpflanzung zu dienen hatte. Ein Indiz dafür war eine Bemerkung meiner Mutter kurz vor meiner Heirat, dass nach dieser, beginnend in der Hochzeitsnacht, »etwas« passieren werde, was man als Frau einfach über sich ergehen lassen müsse …
Unter diesen Rahmenbedingungen war es nicht weiter verwunderlich, dass meine Mutter innerhalb weniger Jahre fünfmal schwanger wurde. Eines der Kinder starb, ich war die Zweitgeborene: Drei Jahre vor mir wurde meine ältere Schwester geboren, nach mir kamen noch eine weitere Schwester und schließlich der heißersehnte Sohn. Danach passierte dann nichts mehr – und ich glaube, dass das auch wörtlich zu nehmen ist. Dabei spielte allerdings auch eine Rolle, dass mein Vater eine neue berufliche Tätigkeit innerhalb seines Konzerns aufgenommen hatte, die ihn zu einem eher seltenen Besucher in seiner eigenen Familie machte: Er war ständig in der gesamten Bundesrepublik unterwegs. Der gängige Spruch in meiner Familie war, dass unser Vater eigentlich nur in seinem Urlaub anwesend sei, »und diese Zeit geht auch vorüber«.
Im Rückblick kann ich guten Gewissens sagen, dass ich sehr behütet aufgewachsen bin. Meine Mutter führte ein strenges Regime, bemühte sich aber stets, dass es der Familie an nichts fehlte. Das war nicht immer einfach, nicht zuletzt weil meine Eltern schon zu Beginn ihrer Ehe ein Mehrfamilienhaus gebaut und damit enorme finanzielle Lasten übernommen hatten. Die ersten Jahre meines Lebens verbrachte die Familie selbst in diesem Haus, danach gab es einen berufsbedingten Wechsel in die Kreisstadt des Nachbarkreises.
Meine Eltern, das heißt vor allem meine Mutter, führten ein offenes Haus. Wir Kinder durften, wann immer wir wollten, Freunde mit nach Hause bringen, die von meiner Mutter stets mit offenen Armen empfangen wurden. Erst später fiel mir auf, dass Besuche unsererseits bei diesen Kindern sehr selten waren: Meine Mutter wollte also die Kontrolle über uns behalten. Das störte mich damals allerdings nicht; wir hatten nach unserem Umzug – ich war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt – ein großes Haus mit einem ausgedehnten Garten. Ich fühlte mich dort sehr wohl und verhielt mich bei den Spielen sowohl im Haus als auch im Garten eher wie ein Junge als wie ein Mädchen.
Was bei den Spielen kein Problem war, wurde es, sobald es mehr formal wurde, wie an den Wochenenden oder bei Verwandtschaftsbesuchen. Zu diesen Anlässen wurde ich, wie es in der damaligen Zeit üblich war, wieder als Mädchen herausgeputzt, mit süßen Kleidchen, Spängchen im Jahr und Lackschühchen. Davor stand allerdings die Säuberung, denn Spiele im Garten führen üblicherweise zu Verschmutzungen. Folgerichtig wurden vor dem Wochenende oder spätestens am Samstag alle Kinder in die Badewanne gesteckt. Auch dafür gab es feste Regeln, deren Sinn ich nicht immer verstand und die ich im Nachhinein für sehr seltsam halte. Hierzu gehörte, dass wir Mädchen nur mit einem Badeanzug und unser Bruder (später) nur mit Badehose in die Badewanne steigen durften. Damals dachte ich, dass das normal sei, heute finde ich das einfach nur verklemmt.
Und an eine weitere seltsame Episode erinnere ich mich noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Die Wochenenden, vor allem die Sonntagnachmittage, waren für Besuche bei der Verwandtschaft in der näheren Umgebung reserviert. Dabei kam es auch vor, dass nicht alle Kinder an den Besuchen teilnahmen, weil unser Auto – wir hatten ein Auto, solange ich zurückdenken kann – nur fünf Sitzplätze hatte und manchmal auch Verwandte mitfuhren. Bei wenigstens einer dieser Gelegenheiten saß ich mit einem meiner Onkel allein auf dem Rücksitz. Plötzlich fühlte ich seine Hand auf meinem Oberschenkel, die sich in den folgenden Minuten immer weiter nach oben in Richtung meiner kindlichen Scheide (damals kannte ich keinen anderen Begriff) bewegte. Ich war starr vor Entsetzen und schickte einen flehentlichen Blick in Richtung meiner Mutter, den sie als Fahrerin im Rückspiegel sehr wohl wahrzunehmen schien, denn sie blickte immer wieder nach hinten – auf den hin sie aber nichts unternahm. Ich konnte mir damals keinen Reim darauf machen, wagte aber auch nicht, meine Mutter darauf anzusprechen. Offensichtlich war so ein Verhalten normal oder wurde als normal angesehen. Dabei sind beide zu verurteilen, sowohl mein Onkel für die Tat als auch meine Mutter für ihre Passivität und Duldung – MeToo lässt grüßen. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob es häufiger zu solchen Vorfällen kam, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Im Lauf der Zeit habe ich sie vielleicht vergessen oder doch zumindest verdrängt.
Allerdings gab es ab meinem zwölften Lebensjahr auch deutlich weniger Gelegenheiten für derartigen Missbrauch – denn das war es, ganz egal was damals im Allgemeinen darüber gedacht wurde –, wir zogen berufsbedingt nämlich wieder um, dieses Mal in eine westdeutsche Großstadt in einem anderen Bundesland mit schon damals etwa einer halben Million Einwohnern. An unserem Familienleben änderte sich zunächst aber eigentlich nichts: Unter der Woche mussten wir Kinder zur Schule (mittlerweile waren alle Kinder der Familie schulpflichtig) und das Wochenende war dem Familienleben gewidmet, weiterhin stark beeinflusst durch die Regeln der katholischen Kirche. Gottesdienste waren Pflicht, und ansonsten mussten vor allem wir Mädchen zunehmend im Haushalt helfen. Zeit für uns selbst, und sei es nur für das Lesen eines Buches oder das Hören einer Musiksendung im Radio (unser Fernseher war für solche Vergnügungen natürlich tabu), gab es kaum. Und wenn uns unsere Mutter bei einer dieser Tätigkeiten »erwischte«, wurden wir sofort zu weiteren Hausarbeiten verdonnert – offensichtlich wussten wir ja nichts mit unserer Zeit anzufangen …
Durch das deutlich höhere Gehalt meines Vaters konnten wir uns wieder ein großes Haus leisten, das zwar keinen großen Garten mehr besaß, dafür aber eine zu einer Art Partykeller umgebauten Garage, in der sich zunächst nur meine Eltern mit Bekannten für gemütliche Stunden bei typischem Essen dieser Zeit und einem Glas Wein trafen. Ich konnte damit zunächst nicht viel anfangen, wohl aber meine ältere Schwester, die mittlerweile in die Pubertät gekommen war und begann, sich für Jungs zu interessieren. Unsere Mutter behielt auch in dieser für sie schwierigen Zeit ihr gewohntes Verhaltensmuster bei: Die Familie führte ein offenes Haus, und wir Kinder durften, wann immer wir wollten, andere Kinder zu uns einladen, wodurch sie weiterhin die Kontrolle über uns ausüben konnte. Dieses Schema wurde auch bestehen gelassen, als meine ältere Schwester mit Ideen kam, sich am Samstagabend irgendwo in der Großstadt zu amüsieren. Mit geschickten Argumenten und zur Not auch Bestechung oder Androhung von Strafen sorgte unsere Mutter dafür, dass Wünsche nach Vergnügungen außerhalb des Hauses so weit als irgend möglich im Keim erstickt wurden. Denn wozu hatten wir denn einen Partykeller? Und wenn trotz aller Bemühungen eine externe Veranstaltung besucht werden »musste«, dann am liebsten solche, die von der katholischen Kirchengemeinde organisiert wurden. Dass wir dann relativ zeitig nach Hause mussten (22 Uhr war das Höchste der Gefühle) und auch jedes, aber auch wirklich jedes Mal von unserer Mutter oder unserem Vater abgeholt wurden, versteht sich von selbst. Das ging auch einige Zeit gut, aber der Widerstand zunächst von meiner Schwester, später auch von mir wuchs – und außer Verboten fiel unseren Eltern auch nichts ein, wie sie damit umgehen sollten. Aber immerhin gab es noch unseren Partykeller, sodass wir nicht vollständig isoliert waren. Aber auch da gab es klare Verhaltensmuster, die üblicherweise unter dem Deckmantel besonderer Fürsorge daherkamen: Unsere Mutter und alle kleineren Geschwister versorgten die Gäste permanent mit kulinarischen Köstlichkeiten und (alkoholfreien) Getränken, was wiederholtes Erscheinen ihrerseits im Partykeller notwendig machte. Dass dabei keine besondere Stimmung unter den Jugendlichen aufkommen konnte, versteht sich von selbst. Nach einiger Zeit verliefen diese Partys dann auch im Sand, weil sich unsere Gäste nicht mehr ständig kontrollieren lassen wollten und sich daher bei uns nicht mehr wohlfühlten. Aber noch war es nicht so weit …
Igittigitt
Party time – it’s party time. Meine Schwester hatte wieder einmal eingeladen und der Partykeller war voll. Die Musik dröhnte, die Gäste, vor allem Jungs und Mädchen aus der Pfarrjugend, hingen auf der Couch und in den Sesseln ab, aßen die angebotenen Köstlichkeiten, tranken Limo und Wasser, einzelne tanzten, aber insgesamt war die Stimmung nicht gerade auf dem Siedepunkt. Meine kleineren Geschwister und ich waren erneut zur Kontrolle abgestellt. Eigentlich war alles wie immer, und doch war irgendetwas diesmal anders. Ich hatte es nicht gleich bemerkt, aber bei einem meiner »Kontrollbesuche« sah ich es: Plötzlich waren Flaschen mit Alkohol im Raum. Nein, nichts Hartes, aber für unser Haus war ja Sekt schon eine Ausnahme. Die Flaschen waren auf den ersten Blick auch nicht sichtbar, denn sobald die Tür zum Partykeller geöffnet wurde, verschwanden sie sofort unter dem Tisch, hinter einem Sessel oder in einem sonstigen Versteck. Bei einem meiner Besuche nahm mich meine große Schwester dann zur Seite, klärte mich auf und bat mich gleichzeitig darum, erstens den Mund zu halten und zweitens dafür zu sorgen, dass sich unsere kleineren Geschwister nicht mehr an der Versorgung der Gäste beteiligten. Mit einem verschmitzten Lächeln flüsterte sie mir zu, dass sie jetzt »Flaschendrehen« spielen wollten und ich gerne zusehen dürfe – schließlich sei ich ja schon alt genug dafür, wenn ich »zufällig« auch im Raum war …
Flaschendrehen – was war das denn? Ich hatte natürlich keine Ahnung, aber war mehr als neugierig, denn offensichtlich drehte es sich um etwas »Verbotenes« (denn warum sollten sonst die Kleinen davon nichts wissen?). Gleichzeitig hatte ich aber auch Angst, denn wenn es verboten war, konnte es Strafen nach sich ziehen. Andererseits: Meine Schwester trug das Hauptrisiko, warum sollte ich mir also allzu viele Sorgen machen? Und zur Not konnte ich mich immer noch herausreden, dass ich eigentlich gar nicht verstanden hätte, was da gerade abging! Ich versprach also, meinen Mund zu halten, und war gespannt wie ein Flitzebogen, was gleich in unserem Partykeller passieren würde.
Zurück im Wohnbereich zeigte ich ungewohnte Begeisterung für die weitere Versorgung der Party. Auch stellte ich klar, dass es für meine kleineren Geschwister allmählich Zeit sei, ins Bett zu gehen (was denen einerseits ganz recht war, denn dann mussten sie nicht mehr bedienen, andererseits