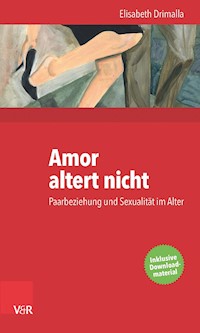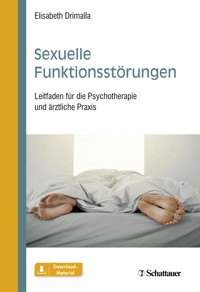
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Let's Talk About Sex! - Relevanz: Sexuelle Symptome kommen bei über der Hälfte der sich in Psychotherapie befindlichen Männer und Frauen vor - Last but not least: Im Anhang finden sich Formblätter für Therapieplanung und Dokumentation der Paarsitzung, Partnerfragebogen, Sexualmythenfragebogen, außerdem Literatur-, Roman- und Filmempfehlungen Unter PsychotherapeutInnen herrscht meist Unsicherheit, wie sie die mitschwingenden sexuellen Probleme ihrer PatientInnen ansprechen können. Erkenne ich die Symptomatik richtig und wie spielen die biopsychosozialen Ursachen zusammen? Das Buch der erfahrenen Paar- und Sexualtherapeutin Elisabeth Drimalla bietet vor und nach der Diagnostik Sicherheit durch breites Fach- und Praxiswissen. Hier finden Sie alles, was Sie wissen sollten über: - anatomische und physiologische Grundlagen, körperliche und medikamentöse Ursachen sexueller Funktionsstörungen - die Rolle intrapsychischer und interpersoneller Konflikte, der Lebensgeschichte, Lebenssituation und von Stress - Diagnostik von Lust- und Erregungsstörungen, Orgasmusstörungen, Vaginismus, Schmerzen beim Sex, u.v.m. Der therapeutische Teil beantwortet anhand zahlreicher Fallbeispiele, welches Vorgehen bei verschiedenen Ursachen und spezifischer Symptomatik sinnvoll ist. Wann reichen Beratung und Information? Wann sollten andere Fachdisziplinen hinzugezogen werden? Was funktioniert im Einzel- und was im Paarsetting? Wo liegen häufige Fallstricke? Wann ist eine zusätzliche medikamentöse Therapie sinnvoll und wie lässt sich deren Wirksamkeit verbessern? Die Autorin stellt Übungen und Maßnahmen zur Kommunikationsförderung und Stressbewältigung vor. Dabei vertritt sie einen psychodynamischen Ansatz für den Paarkonflikt und arbeitet mit tiefenpsychologisch fundierten Verfahren. Mit diesem Wissen sind Sie bestens gerüstet, um über Sex zu sprechen und sprechen zu lassen! Dieses Buch richtet sich an: PsychotherapeutInnen, die ihr sexualtherapeutisches Wissen verbessern möchten, da sexuelle Probleme in Therapien häufig vorkommen, in der Ausbildung aber zu wenig berücksichtigt werden. SexualtherapeutInnen, die praxisrelevante Hinweise und Anregungen für ihr therapeutisches Vorgehen suchen. ÄrztInnen zahlreicher Fachrichtungen wie HausärztInnen, InternistInnen, GynäkologInnen, UrologInnen und PsychiaterInnen, da sie nicht selten mit sexualtherapeutischen Fragen konfrontiert werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Elisabeth Drimalla
Sexuelle Funktionsstörungen
Leitfaden für die Psychotherapie und ärztliche Praxis
Impressum
Dr. Elisabeth Drimalla
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Psychotherapie
Marschnerstr. 9
30167 Hannover
www. praxis-drimalla.de
Die digitalen Zusatzmaterialien haben wir zum Download auf www.klett-cotta.de bereitgestellt. Geben Sie im Suchfeld auf unserer Homepage den folgenden Such-Code ein: OM40027
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Schattauer
www.schattauer.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © istock/Jay Yuno
Lektorat und Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani
Datenkonvertierung: Eberl & Kœsel Studio GmbH, Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608- 40027-4
E-Book: ISBN 978-3-608-12110-0
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20506-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Teil I
Der biopsychosoziale Ansatz als Grundlage von Diagnostik und Therapie sexueller Funktionsstörungen
1 Biologische Faktoren
1.1 Anatomische, physiologische und neurobiologische Grundlagen
1.2 Körperliche Erkrankungen als Ursachen
1.3 Medikamente als Ursachen
2 Psychische Faktoren
2.1 Lebensgeschichte
2.2 Kollusionsmodell
2.3 Bindungsstil
2.4 Strukturniveau
3 Soziale Faktoren
3.1 Soziokulturelle Normen und Sexualmythen
Die zwölf von B. Zilbergeld zusammengestellten Mythen lauten:
3.2 Lebensphasen und ihre spezifischen Herausforderungen
3.3 Stress
4 Zusammenwirken und gegenseitige Beeinflussung der biologischen, psychischen und sozialen Faktoren
Paar Herbst
Auflösung Paar Herbst
Biologische Faktoren
Psychologische Faktoren
Soziale Faktoren
Teil II
Diagnostik
5 Sexuelle Funktionsstörungen der Frau (Definition, Epidemiologie, Ätiologie)
5.1 Lust- und Erregungsstörung
Epidemiologie
Ätiologie
5.2 Orgasmusstörung der Frau
Ätiologie
5.3 Genito-Pelvine Schmerz-/Penetrationsstörung (Dyspareunie/Vaginismus)
Epidemiologie
Ätiologie
6 Sexuelle Funktionsstörungen des Mannes (Definition, Epidemiologie, Ätiologie)
6.1 Appetenzstörung
Ätiologie
6.2 Erektionsstörung
Prävalenz
6.3 Vorzeitige Ejakulation
Prävalenz
6.4 Verzögerte Ejakulation
Ätiologie
7 Der diagnostische Werkzeugkoffer
7.1 Szene
7.2 Übertragung/Gegenübertragung
7.3 Anamnese
7.4 Bindungsverhalten und Strukturniveau
Berücksichtigung des Strukturniveaus
7.5 Das sexuelle Symptom
7.6 Beziehungsmuster in der Sexualität
7.7 Funktion des Symptoms
Teil III
Therapie
8 Wirkfaktoren
9 Fallstricke
10 Der therapeutische Werkzeugkoffer
10.1 Therapiezielklärung
Wie sollte ein Therapieziel formuliert sein?
10.2 Beratung und Information
10.3 Bearbeitung der Paardynamik
10.4 Körperbezogene Übungen wie Sensualitätsübungen
10.5 Achtsamkeit
10.6 Förderung der Kommunikation
10.7 Zwiegespräche und Alternativen
10.8 Stressbewältigung
10.9 Spezifische Übungen und Besonderheiten bei den verschiedenen sexuellen Funktionsstörungen
Spezifische Übungen bei weiblichen Orgasmusstörungen
Besonderheiten und spezifische Übungen beim Vaginismus
Besonderheiten und spezifische Übungen bei Dyspareunie
Besonderheiten und spezifische Übungen bei Erektiler Dysfunktion
Ejaculatio praecox
Verzögerte Ejakulation
Appetenzstörung
Zusammenfassung möglicher Körperübungen für die einzelnen sexuellen Funktionsstörungen
Erektile Dysfunktion
Ejaculatio praecox
Weibliche Orgasmusstörung
Verlangensstörung
Vaginismus, Dyspareunie
Verzögerte Ejakulation
10.10 Kombination mit Medikamenten
Erektile Dysfunktion
Ejaculatio praecox
Appetenzstörung
10.11 Sexuelle Funktionsstörungen bei homosexuellen Paaren
Unterscheiden sich sexuelle Funktionsstörungen bei homosexuellen und heterosexuellen Patienten?
Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten sind bei den biopsychosozialen Faktoren und dem therapeutischen Vorgehen zu berücksichtigen?
11 Aufgaben der Therapeutin
12 Therapieplanung
Therapieplanung Formblatt Paar A./B.
1) Wichtiges aus der Lebensgeschichte
Rolle in der Herkunftsfamilie
Frühere Partnerbeziehungen
2) Strukturniveau
3) Bindungsstil
4) Hauptkonflikt, intrapsychisch
5) Kollusion, ggf. Konflikt interpersonell
6) Hauptabwehrformen
7) Sexuelles Symptom
8) Ursachen
9) Therapieziel
10) Kommunikation
11) Informationsdefizite
12) Stressbelastung
13) Ressourcen
Therapieplanung Paar Herbst
1) Wichtiges aus der Lebensgeschichte
Rolle in der Herkunftsfamilie
Frühere Partnerbeziehungen
2) Strukturniveau
3) Bindungsstil
4) Hauptkonflikt intrapsychisch
5) Kollusion, ggf. Konflikt interpersonell
6) Hauptabwehrformen
7) Sexuelles Symptom
8) Ursachen
9) Therapieziel
10) Kommunikation
11) Informationsdefizite
12) Stressbelastung
13) Ressourcen
Phasen des therapeutischen Prozesses bei primär psychosozialen Ursachen der Symptomatik
Anfangsphase
Mittlere Phase
Schlussphase
13 Therapeutischer Prozess
Therapieplanung Formblatt Paar Sturm
1) Wichtiges aus der Lebensgeschichte
Rolle in der Herkunftsfamilie
Frühere Partnerbeziehungen
2) Strukturniveau
3) Bindungsstil
4) Hauptkonflikt intrapsychisch
5) Kollusion, ggf. Konflikt interpersonell
6) Hauptabwehrformen
7) Sexuelles Symptom
8) Ursachen
9) Therapieziel
10) Kommunikation
11) Informationsdefizite
12) Stressbelastung
13) Ressourcen
Therapeutischer Prozess bei biologischer Ursache und Schicksalsschlag
Phasen des Prozesses bei überwiegend biologischen und/oder sozialen Faktoren
Anfangsphase
Mittlere Phase
Schlussphase
14 Einzel- oder Paartherapie?
Welche Werkzeuge der Paar-Sexualtherapie lassen sich auch in der Einzeltherapie einsetzen?
Anhang
Weiterführende Literatur
Für TherapeutInnen
Buchempfehlungen für TherapeutInnen und PatientInnen
Romanempfehlungen für TherapeutInnen und PatientInnen
Buchempfehlungen zu Coming out
Filmempfehlungen für TherapeutInnen und Paare
Filme zu Coming out
Partnerfragebogen
Therapieplanung Formblatt
1. Wichtiges aus der Lebensgeschichte
2. Strukturniveau
3. Bindungsstil
4. Hauptkonflikt, intrapsychisch
5. Kollusion, ggf. Konflikt interpersonell
6. Hauptabwehrformen
7. Sexuelles Symptom
8. Ursachen
9. Therapieziel
10. Kommunikation
11. Informationsdefizite
12. Stressbelastung
13. Ressourcen
Dokumentation Paarsitzung
Fragebogen für Männer zu den Sexualmythen
1) »Wir sind aufgeklärte Leute und fühlen uns wohl beim Sex.«
2) »Ein wirklicher Mann mag keinen ›Weiberkram‹ wie Gefühle und dauernd reden.«
3) »Jede Berührung ist sexuell oder sollte zu Sex führen.«
4) »Männer können und wollen jederzeit.«
5) »Beim Sex zeigt ein wirklicher Mann, was er kann.«
6) »Beim Sex geht es um einen steifen Penis und was mit ihm gemacht wird.«
7) »Sex ist gleich Geschlechtsverkehr.«
8) »Ein Mann muss seine Partnerin ein Erdbeben erleben lassen.«
9) »Zum guten Sex gehört ein Orgasmus.«
10) »Beim Sex sollten Männer nicht auf Frauen hören.«
11) »Guter Sex ist spontan, da gibt es nichts zu planen oder zu reden.«
12) »Echte Männer haben keine sexuellen Probleme«
13) »Die Frau ist beim Sex passiv und folgt dem, was der Mann bestimmt.«
14) »Die Frau ist zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse des Mannes da.«
15) »Eine Frau ist immer bereit und will immer.«
Fragebogen für Frauen zu den Sexualmythen
1) »Wir sind aufgeklärte Leute und fühlen uns wohl beim Sex.«
2) »Ein wirklicher Mann mag keinen ›Weiberkram‹ wie Gefühle und dauernd reden.«
3) »Jede Berührung ist sexuell und sollte zu Sex führen.«
4) »Männer können und wollen jederzeit.«
5) »Beim Sex zeigt ein wirklicher Mann, was er kann.«
6) »Beim Sex geht es um einen steifen Penis und was mit ihm gemacht wird.«
7) »Sex ist gleich Geschlechtsverkehr.«
8) »Ein Mann muss seine Partnerin ein Erdbeben erleben lassen.«
9) »Zum guten Sex gehört ein Orgasmus.«
10) »Beim Sex sollten Männer nicht auf Frauen hören.«
11) »Guter Sex ist spontan, da gibt es nichts zu planen oder zu reden.«
12) »Echte Männer haben keine sexuellen Probleme.«
13) »Die Frau ist beim Sex passiv und folgt dem, was der Mann bestimmt.«
14) »Die Frau ist zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse des Mannes da.«
15) »Eine Frau ist immer bereit und will immer.«
Fortführungsfragebogen
Literaturverzeichnis
Sachverzeichnis
Vorwort
Sexuelle Probleme von Patienten kommen in der psychotherapeutischen und ärztlichen Praxis häufig vor. Dieses Buch richtet sich daher an PsychotherapeutInnen und ÄrztInnen, die ihr sexualtherapeutisches Wissen verbessern möchten, ebenso aber auch an SexualtherapeutInnen. Sexuelle Funktionsstörungen haben eine Lebenszeitprävalenz von ca. 20 % und es besteht eine hohe Komorbidität zu Depressionen und Angststörungen. Gleichzeitig kann eine sexuelle Funktionsstörung Vorbote oder Folge einer körperlichen Erkrankung sein, die es auszuschließen und zu behandeln gilt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Fragen zur sexuellen Gesundheit in die Anamnese von PatientInnen zu integrieren (Kliesch 2020). In der Psychotherapieausbildung und auch im Medizinstudium werden sexuelle Funktionsstörungen aber nur wenig berücksichtigt. Gerade von meinen nicht »sexualtherapeutischen«, sondern »tiefenpsychologischen« SupervisandInnen höre ich, wie unsicher sie sich darin fühlen, nach sexuellen Problemen der PatientInnen zu fragen und die Symptomatik und das Zusammenspiel der biopsychosozialen Ursachen zu erkennen. Ebenso wünschen sich die KollegInnen nach erfolgter Diagnostik mehr Wissen über das weitere therapeutische Vorgehen. Wie können sie beispielsweise den einzelnen Patienten1 oder das spezifische Paar mit dieser Symptomatik am wirksamsten behandeln? Ist es sinnvoll, die Partnerin mit einzubeziehen? Was ist dabei zu beachten? Wann sollten andere Disziplinen (somatische Fachrichtungen und/oder auch SexualtherapeutInnen) mit einbezogen werden?
Die überwiegende Mehrheit der PatientInnen steht einem Gespräch mit ihren HausärztInnen über sexuelle Probleme positiv gegenüber. In einer Studie berichteten die meisten ÄrztInnen aber, Sexualität nur bei ca. einem Viertel ihrer PatientInnen zu thematisieren, aus Sorge, es könne diesen »unangenehm« sein, aber auch aus eigener Unsicherheit (Cedzich, Bosinski 2010). Entsprechend hielten beispielsweise 87 % der HausärztInnen die Informationen, die sie während des Studiums zu sexualmedizinischen Störungsbildern bekommen hatten, für unzureichend (Cedzich, Bosinski 2010). Die PatientInnen gehen nicht von vornherein zu SexualtherapeutInnen, sondern sie erzählen – wenn sie gefragt werden, in den letzten Jahren aber auch zunehmend von sich aus – ihren HausärztInnen, GynäkologInnen, UrologInnen, InternistInnen, PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen davon. Jetzt ist es wichtig, die richtigen Weichen zu stellen. Auch von ÄrztInnen, die in ihren Praxen mit sexuellen Funktionsstörungen konfrontiert sind, werde ich in Workshops, Intervisions- und Balintgruppen gefragt, welche möglichen psychosozialen Ursachen bei diesen Patienten zu berücksichtigen sind, was ihnen empfohlen werden kann, ob die Partnerin mit einbestellt werden sollte, was dabei beachtet werden muss, wann zu einer Sexualtherapie geraten werden sollte und wie diese den Patienten erklärt werden kann, damit sie auch angenommen wird.
Auf all diese Fragen will das vorliegende Buch Antworten geben.
Ich möchte den LeserInnen mit diesem Buch vermitteln, dass das Erkennen des Zusammenspiels der biopsychosozialen Ursachen wesentlich für eine erfolgreiche Behandlung sexueller Funktionsstörungen ist. Nicht jeder Patient, nicht jede Patientin muss zum/zur SexualtherapeutIn. Viele der Tools aus dem therapeutischen Werkzeugkoffer lassen sich in eine Psychotherapie und teilweise auch in eine Beratung bei den behandelnden ÄrztInnen integrieren. Die Sensualitätsübungen, die ein sehr wirksames therapeutisches Instrument sind, erfordern jedoch sexualtherapeutische Erfahrung und sollten zunächst auch von einer erfahrenen Sexualtherapeutin supervidiert werden.
Das Buch ist so geschrieben, dass es für LeserInnen mit psychotherapeutischer Ausbildung unterschiedlicher Schulen anwendbar ist, obwohl ich selbst tiefenpsychologisch arbeite und dieses Vorgehen in den Fallbeispielen auch deutlich wird. Ich habe mich aber besonders an den von Grawe und Wampold beschriebenen Wirkfaktoren für eine erfolgreiche Psychotherapie orientiert. Diese zu berücksichtigen, verbessert m. E. auch die Wirksamkeit somatischer und medikamentöser Therapien. Ausführlich habe ich die Bedeutung der Paardynamik für sexuelle Funktionsstörungen dargestellt, da jedes sexuelle Symptom, sofern eine Paarbeziehung besteht, mit dieser im Wechselspiel steht. Das Wissen über die Gestaltung und über mögliche Fallstricke(1) von Paarsitzungen ist für alle, die mit Patienten mit sexuellen Funktionsstörungen arbeiten, wesentlich. Ich bin überzeugt, dass die Einbeziehung der Partnerin in vielen Fällen auch die Wirksamkeit von Medikamenten, wie beispielsweise PDE-5-Hemmern, ebenso wie den Fortschritt der psychotherapeutischen Behandlung verbessern kann. Außerdem bestätigen zahlreiche Studien (Reynolds et al. 1994, Frisch et al. 2017), dass eine gute Paarbeziehung vor somatischen und psychischen Erkrankungen schützen und das Heilen von bereits vorhandenen Krankheiten unterstützten kann.
Da Alexithymie und fehlendes Körpererleben mit sexuellen Funktionsstörungen korrelieren, lege ich in der Psycho- und Sexualtherapie großen Wert auf die Wahrnehmung und Klarifizierung der Gefühle sowie auf das gleichzeitige Körpererleben.
Neben Fallbeispielen, die sexualtherapeutische Interventionen in Psychotherapie aber auch in somatischen Behandlungen zeigen, erläutere ich an zwei Patientenpaaren mein sexualtherapeutisches Vorgehen von der Terminvereinbarung bis zur letzten Sitzung. Damit möchte ich zum einen den PsychotherapeutInnen und somatischen KollegInnen den Ablauf von Sexualtherapien so schildern, dass sie ihre PatientInnen darüber informieren und ggf. dafür motivieren können. Zum anderen möchte ich SexualtherapeutInnen damit aber auch hilfreiche, praxisrelevante Hinweise und Anregungen zum sexualtherapeutischen Vorgehen geben.
Damit ein Buch entstehen kann, braucht es Menschen, die es wohlwollend und mit Zuversicht begleiten. Dafür danke ich besonders meinem Mann, der mich immer wieder ermutigt hat und ein kritischer und unterstützender Leser war. Außerdem bin ich ihm dankbar für seine Geduld und sein Verständnis, wenn ich mal wieder zum Schreibtisch entschwand.
Die gute und inspirierende Zusammenarbeit mit Frau Dr. Nadja Urbani von Schattauer/Verlag Klett-Cotta war ein Vergnügen. Dafür danke ich ihr herzlich, wie auch für die Idee zu diesem Buch und das einfühlsame und sorgfältige Lektorat. Den Kolleginnen und Kollegen meines Qualtitätszirkel Sexualmedizin danke ich für den langjährigen Zusammenhalt und die vielen anregenden Diskussionen. Ebenso danke ich meinen SupervisandInnen und Workshop-TeilnehmerInnen für ihre Fallschilderungen, ihre interessanten Fragen und Diskussionen.
Ganz besonders gilt mein Dank aber meinen PatientInnen und Paaren, von denen ich viel gelernt habe und ohne die dieses Buch nicht hätte entstehen können.
Elisabeth Drimalla
Hannover im Oktober 2020
Teil I
Der biopsychosoziale Ansatz als Grundlage von Diagnostik und Therapie sexueller Funktionsstörungen
Abb. 1-1 Biopsychosozialer Ansatz.
Die Sexualität(1) und sexuelle Funktion(1) eines Menschen werden(1) von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst, die sich wiederum wechselseitig aufeinander auswirken (Abb. 1-1). Biologische Faktoren(1), wie beispielsweise altersbedingte physiologische Veränderungen oder somatische Erkrankungen, können die sexuelle Funktion beeinträchtigen. Das kann Versagensangst(1) auslösen und/oder am Selbstwert kratzen, was wiederum zusätzlich zur beeinträchtigten sexuellen Funktion die Paarbeziehung beeinflusst und umgekehrt. Ebenso können soziale Ereignisse, zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch kulturelle Faktoren wie Darstellung und Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft eine Rolle für die sexuelle Funktion des Einzelnen und des Paares spielen. Das gleiche gilt natürlich auch für psychische Faktoren(1). Je nach Lebensgeschichte und Erfahrungen, Persönlichkeit, Strukturniveau(1) und Bindungssicherheit(1) werden wir uns Lebenspartner suchen, mit denen wir die Paarbeziehung(1) und die Sexualität leben, die uns beiden möglich ist, zusätzlich beeinflusst von unserer Lebenssituation und Gesundheit. Auch wie wir beispielsweise mit körperlicher Erkrankung oder Kündigung umgehen, wird von diesen psychischen Gegebenheiten und der Qualität der Paarbeziehung beeinflusst.
Sehen wir uns das Zusammenspiel dieser Faktoren an einem Beispiel an. Ist ein Mann an Diabetes mellitus erkrankt und er bemerkt ein Nachlassen der Erektionsfähigkeit, so kann es aufgrund von Gefäß- und/oder Nervenschäden zu der Erektionsstörung(1) gekommen sein; diese kann aber auch dadurch verstärkt oder sogar ausgelöst sein, dass er ein Nachlassen und Versagen lediglich befürchtet. Die Art und Weise, wie er auf die sexuelle Symptomatik reagiert, hängt von seiner eigenen psychischen Konstitution und Struktur sowie dem Verhalten seiner Partnerin ab. Für seine psychische, aber auch körperliche Gesundheit wäre es eine schlechte Lösung, wenn er sich jetzt aus der Beziehung und Sexualität zurückziehen würde, ohne die Problematik anzusprechen und wenn auch seine Partnerin dies geschehen ließe und es sogar noch auf die eigene vermeintlich fehlende Attraktivität zurückführen würde. Hoffen wir für diesen Patienten, dass die behandelnden Ärzte ihn auch nach seiner Sexualität und seinem häuslichen Umfeld fragen und die biopsychosozialen Ursachen der Erektionsstörung(1) abklären. Vielleicht beziehen sie sogar die Partnerin mit ein (mehr dazu auf Seite 30 ff., 140, 169 ff.) und suchen gemeinsam mit dem Paar nach Lösungsmöglichkeiten für den Umgang mit der belastenden Lebenssituation, so dass die Partner wieder körperlich und verbal ins Gespräch kommen. Das würde die Chancen des Patienten für mehr körperliches und psychisches Wohlbefinden verbessern.
Mittlerweile gibt es umfangreiche Daten, die zeigen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen der Qualität der Paarbeziehung(2) und der körperlichen und auch psychischen Gesundheit sowie der Lebenserwartung der Partner gibt (aktueller Überblick bei Frisch et al. 2017). In einer der größten jemals durchgeführten Metaanalysen (Roelf et al. 2011) mit Daten von mehr als 500 Millionen Menschen zeigte sich, dass Verheiratete gegenüber Alleinstehenden ein um 24 % niedrigeres Sterberisiko haben. Dabei spielt eine Rolle, dass die Partner eine gewisse soziale Kontrolle hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens(1) aufeinander ausüben und einander im Krankheitsfall beistehen. Es konnte auch ein Zusammenhang zwischen einer konflikthaften Belastung in der Paarbeziehung(1)(2) und negativer Auswirkung auf verschiedene Parameter des Immunsystems (Kiecolt-Glaser 1987, 1993, 2001, 2005 zit. nach Roesler 2018) oder auch einer Erhöhung des Risikos für Herzerkrankungen(1) (Devogli et al. 2007, 2018) nachgewiesen werden. Sich zunehmend verschlechternde Partnerschaften haben Einfluss auf die Entwicklung von Bluthochdruck und Arteriosklerose. Es ist bemerkenswert, dass beide Erkrankungen auch Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion(1)(1) sind.
Ein weiteres sehr wichtiges Argument für die Einbeziehung des Partners sowohl bei psychischen als auch bei schweren oder chronischen körperlichen Erkrankungen ist die unmittelbare Auswirkung auf die Verbesserung der körperlichen Symptomatik und die Überlebenswahrscheinlichkeit. Es kommt zu einer Reduktion von depressiven Symptomen, bei Herzerkrankungen kann die Mortalität gesenkt werden. Bei Frauen mit Brustkrebs konnte nachgewiesen werden, dass ihre Überlebenschancen signifikant höher sind, wenn sie von ihrem Partner emotionale Unterstützung erfahren (Reynolds et al. 1994). Auch zwischen Verlauf und Rückfallrisiko einer depressiven Erkrankung konnten Zusammenhänge mit der Qualität der Partnerschaft gezeigt werden (Bodenmann 2013).
Interessanterweise wird das problematische Interaktionsmuster in Partnerschaften depressiver Patienten auch für männliche Patienten mit Orgasmushemmung(1) beschrieben. Die Partner vermeiden nämlich, Ärger und Feindseligkeit zu kommunizieren (Fiedler et al. 1998, Reich 2003).
Aus verschiedenen Studien wissen wir, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten einem Gespräch über Sexualprobleme mit ihrem Hausarzt positiv gegenübersteht. Aber nur bei ca. jedem vierten ihrer Patienten thematisieren die Ärzte Sexualität, u. a. aus der Sorge heraus, es könne den Patienten unangenehm sein. Für diese Befürchtung finden sich in Studien keinerlei Belege (Cedzich & Bosinski 2010).
Stellen wir uns vor, der diabetische Beispielpatient hatte nicht das Glück, auf kompetente, nachfragende Ärzte zu treffen. Er entwickelt eine reaktive depressive Symptomatik und wird von der Hausärztin zur Psychotherapeutin überwiesen. Wenn diese dann auch nur nach seinen depressiven Symptomen, nicht aber nach der Sexualität fragt, weil sie glaubt, der Patient wolle nicht darüber sprechen oder weil es ihr unangenehm ist, wird eine weitere Chance vertan.
50–90 % der depressiven Patienten leiden an Beeinträchtigungen der Sexualität(1)(1). Weniger als 30 % der Patienten, die Antidepressiva einnehmen müssen, beenden die verordnete medikamentöse Therapie regulär – der wichtigste Grund für die Therapieabbrüche sind die sexuellen Nebenwirkungen(1). Bei den medikamentös unbehandelten depressiven Patienten leidet aber auch ein Drittel an Libidoverlust(1), verzögerter Ejakulation(1)(1), Anorgasmie und Erektionsstörungen (Hartmann 2007). Auch bei Angststörungen besteht eine Komorbidität mit sexuellen Funktionsstörungen(1)(1) bei Frauen besonders mit Erregungsstörungen(1) und genito-pelviner Schmerzstörung(1), aber auch mit Orgasmusproblemen(1) und Luststörungen(1). Basson & Gilks nehmen an, dass die Aktivierung des sympathischen Nervensystems bei sexueller Erregung durch die entsprechenden körperlichen Reaktionen, wie sie auch bei Angst auftreten (schnellere, flachere Atmung, Muskelanspannung), bei diesen Patientinnen als bedrohlich interpretiert werden und sie den Kontrollverlust fürchten (Basson & Gilks 2018). Auch bei 60–80 % der Patientinnen mit Psychosen(1) bestehen aus unterschiedlichsten Ursachen sexuelle Dysfunktionen (Basson & Gilks 2018).
Deshalb ist es sowohl in der somatischen Therapie als auch in der Psychotherapie so unerlässlich, nach der Sexualität zu fragen, die biopsychosozialen Faktoren(1)(1) und ihr Zusammenspiel zu eruieren, diagnostisch abzuklären und bei dem therapeutischen Vorgehen zu berücksichtigen.
Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen, dem DSM-5(1) (American Psychiatric Association 5. Auflage 2013; dt. Ausgabe 2015), wird das Zusammenwirken der biopsychosozialen Faktoren(1) ebenfalls aufgeführt. Bei allen sexuellen Funktionsstörungen sollen die fünf folgenden Faktoren berücksichtigt werden, die für die Entstehung, das individuelle Störungsbild und/oder die Behandlung relevant sein könnten:
Partnerfaktoren (z. B. sexuelle Probleme des Partners, Gesundheitszustand des Partners)
Beziehungsfaktoren (z. B. schlechte Kommunikation, Diskrepanzen im Verlangen nach sexueller Aktivität)(1)
individuelle Vulnerabilitätsfaktoren
z. B. negatives Körperbild(1), sexueller oder emotionaler Missbrauch(1)(1) in der Lebensgeschichte,
psychiatrische Komorbidität(1) (z. B. Depression(1), Angststörungen(1)) oder
Stress(1) (z. B. Arbeitsplatzverlust, Verlust eines geliebten Menschen)
kulturelle oder religiöse Faktoren (z. B. Hemmungen, die mit dem Verbot sexueller Aktivität oder sexuellem Genuss in Zusammenhang stehen, Einstellungen gegenüber Sexualität)
medizinische Faktoren, die relevant für die Prognose, den Verlauf oder die Behandlung sind.
Die Punkte 2, 3a und 3b könnten wir zu den psychischen Faktoren(2)(1)(1)(1) zählen, 1, 3c und 4 zu den sozialen und 5 zu den biologischen. Es kann hierbei Überschneidungen geben, die aber auch das enge Zusammenspiel verdeutlichen.
Sehen wir uns in den folgenden Kapiteln zunächst die wesentlichen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren genauer an, die für alle sexuellen Funktionsstörungen eine Rolle spielen können und berücksichtigt werden sollten. Das diagnostische Vorgehen, um diese möglichen Ursachen zu erfassen, wird im Kapitel 7 »Der diagnostische Werkzeugkoffer« beschrieben.
Sexualität und sexuelle Funktion eines Menschen werden von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst, die sich wiederum wechselseitig aufeinander auswirken.
Ärzte und Psychotherapeuten sollten ihre Patienten nach ihrer Sexualität und nach den biopsychosozialen Faktoren(2), die diese beeinflussen, fragen.
Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Qualität der Paarbeziehung und der körperlichen (und auch psychischen) Gesundheit der Partner.
Bei psychischen und schweren oder chronischen körperlichen Erkrankungen ist die Einbeziehung des Partners immer zu erwägen.
1 Biologische Faktoren
1.1 Anatomische, physiologische und neurobiologische Grundlagen
Für eine ungestörte(2)(2) sexuelle Funktion ist auf der körperlichen Ebene eine ungestörte hormonelle Regulation notwendig, die Hypothalamus, Hypophyse und Zielorgane (Hoden, Eierstöcke) betrifft. Außerdem sind eine intakte Funktion von Blutgefäßen und Nerven sowie intakte Genitalorgane erforderlich. Alle Erkrankungen oder auch toxischen Einflüsse, die zu Schäden an Blutgefäßen, Nerven oder der hormonellen Regulation führen, können deshalb sexuelle Funktionsstörungen bedingen. Am Ende dieses Kapitels sind die wichtigsten somatischen Ursachen aufgeführt.
Mit zunehmendem Alter kommt es aber auch zu physiologischen, nicht krankheitsbedingten Veränderungen dieser Funktionen. In der Altersphase um das 50. Lebensjahr werden zunehmend weniger Sexualhormone(1) produziert. Die physiologischen Veränderungen sind individuell unterschiedlich stark ausgeprägt, führen aber bei vielen Paaren zu Verunsicherungen, die dann die Sexualität und oft auch die Paarbeziehung(1) zusätzlich negativ beeinflussen. Diese Paare kommen deswegen nicht unbedingt in eine Sexualtherapie. Es lohnt sich aber, Patienten bei Arztbesuchen oder auch in psychotherapeutischen Behandlungen danach zu fragen. Oft sind sie sehr entlastet, darüber sprechen zu können und zu erfahren, dass diese Veränderungen nicht ungewöhnlich sind und es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. So können negative Auswirkungen auf die Paarbeziehung verhindert werden und es kann einer Chronifizierung(1) mit dem Übergang in eine sexuelle Dysfunktion entgegengewirkt werden. Deswegen möchte ich die für die Patienten wesentlichen Informationen der altersbedingten physiologischen Veränderungen hier zusammenfassen:
Beim Mann entwickeln sich die altersbedingten biologischen Veränderungen(1) allmählich ab circa dem 40. Lebensjahr, wobei große individuelle Unterschiede bestehen. Der Blutspiegel des männlichen Sexualhormons, des Testosterons, sinkt und bei älteren Männern nimmt der morgendliche Testosteronanstieg ab (Berberich 2009). Die Erektion(1) entwickelt sich langsamer und es ist eine längere und stärkere Stimulation dafür notwendig. Insgesamt wird sie auch störanfälliger. Die Gliedsteife ist weniger hart, kann schneller wieder abnehmen und manchmal auch ganz ausbleiben. Nach dem Orgasmus klingt sie schneller wieder ab und die Zeitspanne, bis der Penis erneut steif werden kann, die sogenannte Refraktärzeit(1), dauert länger. Auch die Plateauphase, also die Zeit bis zur Ejakulation, verlängert sich. Der Orgasmus(1) ist beim älteren Mann oft kürzer und weniger intensiv (Beier et al. 2001; Berberich 2009). Die Spermienproduktion und -qualität(1) nimmt ab und das Volumen des Samenergusses wird kleiner.
Bei den Frauen werden die Veränderungen nochmal besonders durch die Menopause, das Ausbleiben der monatlichen Regelblutung, markiert. In dieser Lebensphase stellen die Ovarien (Eierstöcke) ihre Funktion ein und schrumpfen. Die Östrogenproduktion nimmt ab. Dadurch geht die Dicke der Vaginalschleimhaut zurück und außerdem ist sie nicht mehr so stark durchblutet und weniger dehnbar. Auch die Lubrikation der Vaginalschleimhaut nimmt ab. Die sexuelle Lust wird aber durch die nachlassende Östrogenproduktion(1) nicht beeinflusst. Wenn die Frau allerdings Geschlechtsverkehr hat, ohne ausreichend feucht zu sein, können die dann auftretenden Schmerzen dazu führen, dass die Angst vor erneut (1)schmerzhaftem Koitus die Lust mindert. Außerdem schützen die dünner gewordenen Scheidenwände häufig die Harnröhre und -blase nicht mehr so gut wie früher vor mechanischer Reizung durch den Penis. Als Folge kann es häufiger zu Blasenentzündungen kommen. Bei vielen Frauen ist mit zunehmendem Alter die Beckenbodenmuskulatur(1) erschlafft, was zu unkontrolliertem Urinabgang(1) führen kann, was die Frauen in ihrer sexuellen Aktivität verunsichern und beeinträchtigen kann. Die Orgasmusfähigkeit(1) bleibt bis ins hohe Alter erhalten, allerdings verringert sich die Anzahl der Gebärmutterkontraktionen und auch die Brustvergrößerung und die Erektion der Brustwarzen können im Vergleich zu jüngeren Frauen vermindert sein. Die Klitoris kann in höherem Lebensalter durch ein leichtes Schrumpfen der kleinen Schamlippen weniger geschützt und dadurch empfindlicher sein.
Darauf, wie die Paare und jeder einzelne mit diesen Veränderungen umgehen kann, werde ich in Teil III Therapie. kurz eingehen, ausführlicher habe ich es in meinem Ratgeberbuch Amor altert nicht – Paarbeziehung und Sexualität im Alter ausgeführt.
1.2 Körperliche Erkrankungen als Ursachen
Als wichtigste somatische Ursachen für sexuelle Funktionsstörungen(1) seien hier genannt: (1)
Neurologische Erkrankungen wie Nervenläsionen(1), Querschnittslähmung, Bandscheibenvorfall, M. Parkinson(1), Multiple Sklerose(1)
Stoffwechselerkrankungen/endokrine Störungen wie Diabetes mellitus(1), Schilddrüsenfunktionsstörungen,(1) Hyperprolaktinämie(1), Fettstoffwechselstörungen, Störungen der Nebennierenrinden-Funktion, Hypogonadismus
Kardiovaskuläre Erkrankungen wie Hypertonie und Koronare Herzkrankheit
Urogenitale Fehlbildungen, Erkrankungen und Traumen
Operationen im Becken(1)- und Genitalbereich (wie bei Prostatakarzinom, Endometriumkarzinom, Rektumkarzinom, Zervixkarzinom)
Schwere Allgemeinerkrankungen
Toxische Einflüsse wie:
Alkohol und andere Drogen: Nicht selten wird Alkohol(1)(1) benutzt, um sexuelle Ängste und Hemmungen zu mindern. Höhere Dosen beeinträchtigen bei beiden Geschlechtern Erregung und Orgasmus(1). In frühen Stadien einer Abhängigkeit scheinen die Betroffenen den Alkohol für ihre sexuelle Funktionsfähigkeit zu benötigen und haben nur in alkoholisiertem Zustand Sex. Das wirkt sich auf längere Sicht meist negativ auf die sexuelle Beziehung und die Paarbeziehung überhaupt aus. Es führt aber auch zur Störung der sexuellen Funktionsfähigkeit ohne Alkohol. Dieses Phänomen ist auch bei anderen Drogen bekannt. In späteren Stadien kommt es zum Verlust des sexuellen Verlangens. Außerdem kann längere Alkoholabhängigkeit durch Testosteronmangel(1) und auch durch Polyneuropathie(1) die sexuelle Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Auch der Gebrauch von Drogen wie Heroin, Amphetamin und Ecstasy (MDMA) beeinflusst die Appetenz, die Erektionsfähigkeit(1)(1) und die Orgasmusfähigkeit negativ (Porst 2015).
Eine manifeste Abhängigkeit von Alkohol oder anderen Drogen ist eine Kontraindikation zur Einleitung einer Sexualtherapie. Zunächst muss die Suchterkrankung behandelt werden.
Nikotin: Es ist (1)für die meisten Patienten leicht nachvollziehbar, dass Nikotin durch seine gefäßschädigenden Wirkungen auch die sexuelle Funktion, besonders die Erektion, beeinträchtigen kann.
1.3 Medikamente als Ursachen
Am häufigsten werden sexuelle Funktionsstörungen(1) unter Antihypertensiva(1)(1)(1)(1) und Psychopharmaka (Antidepressiva und Neuroleptika) berichtet. Diese sollten aber nicht gleich zum »Hauptschuldigen« für die sexuelle Funktionsstörung gemacht werden, sondern als einer von vielen möglichen Faktoren berücksichtigt werden. Es kann dann mit den entsprechenden mitbehandelnden Fachkollegen besprochen werden, ob es unter Berücksichtigung des gesamten Krankheitsbildes Möglichkeiten gibt, die Medikation auf Substanzen umzustellen, die sich günstiger auf die sexuelle Funktion auswirken.
Für die einzelnen Störungen sind die somatischen Ursachen dann noch differenzierter zu betrachten. Ich werde darauf bei der Ätiologie in Kapitel 5 eingehen.
Alle Erkrankungen oder auch toxischen Einflüsse, die zu Schäden an Blutgefäßen, Nerven oder der hormonellen Regulation führen, können sexuelle Funktionsstörungen(1) bedingen.
Mit zunehmendem Alter kommt es aber auch zu physiologischen, nicht krankheitsbedingten Veränderungen dieser Funktionen. Das kann die Betroffenen verunsichern und zusätzlich die Sexualität und auch die Paarbeziehung negativ beeinflussen. Es entlastet die Patienten, wenn sie erfahren, wie sie mit diesen altersgemäßen Veränderungen umgehen können.
2 Psychische Faktoren
Abb. 2-1 Psychische Faktoren, die Einfluss auf die Sexualität und die Paarbeziehung haben können.
2.1 Lebensgeschichte
Zu den (1)psychischen Faktoren(1)(2), die die Sexualität und die Paarbeziehung beeinflussen, zählen die Lebensgeschichte jedes Einzelnen, seine Erziehung, seine Bindungserfahrung, seine Rolle in der Herkunftsfamilie, die Paarbeziehung der Eltern sowie der Umgang mit Sexualität in der Herkunftsfamilie. Auch die bisherigen Erfahrungen mit Sexualität wirken sich auf das sexuelle Erleben des Einzelnen aus, worunter natürlich auch Trauma- oder Missbrauchserfahrungen fallen. Diese Informationen können wir aus der Anamnese erfahren.
Um die psychischen Faktoren aber im ganzen Umfang und in ihrem Zusammenspiel zu erfassen, werden wir uns bei einem Paar auch fragen:
Gibt es intrapsychische Konflikte(1) in jedem Einzelnen, die interpersonell zwischen den Partnern ausgetragen werden und auch die sexuelle Symptomatik beeinflussen?
Sind die Partner sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent (ängstlich) oder desorganisiert gebunden?
Wie ist das Strukturniveau(2) und damit auch die Mentalisierungsfähigkeit(1) beider Partnerinnen?
Abbildung 2-1 verdeutlicht, wie die einzelnen psychischen Faktoren sich auf die Paarbeziehung und die Sexualität auswirken und sich auch gegenseitig beeinflussen. Nur wenn wir dies alles berücksichtigen und verstehen, werden wir den jeweiligen Patienten bzw. das Patientenpaar am besten therapeutisch erreichen.
Sehen wir uns dies am Fallbeispiel des Paares A./B. an und stellen wir uns dabei auch die drei oben genannten Fragen.
Fallbeispiel Paar A./B.2
Frau A. ist 32 Jahre, Buchhändlerin und lebt seit 6 Jahren mit Herrn B., ihrem ersten Partner zusammen. Nach ungefähr zwei Jahren habe sie keine Lust mehr auf Sex gehabt. Kuscheln und Nähe seien ihr aber schon immer wichtiger gewesen. Sie sei noch nie zum Orgasmus gekommen, auch nicht bei Selbstbefriedigung. Sie wünsche sich Kinder, aber es sei ihrem Partner zu früh. Vor drei Jahren sei Frau A. in verhaltenstherapeutischer Behandlung gewesen – wegen einer depressiven Symptomatik aufgrund einer Affäre von Herrn B. Von der Therapie damals habe sie gut profitiert, die depressiven Symptome seien vollständig abgeklungen und auch nicht wieder aufgetreten, aber die sexuellen Probleme hätten sich dadurch nicht verbessert. Frau A. ist schlank, unauffällig sportlich gekleidet, wirkt deutlich jünger, fast kindlich. Sie ist Einzelkind. Die Eltern hätten wenig Zeit gehabt. Bevor sie geboren wurde war ein Junge an plötzlichem Kindstod gestorben. Die Mutter litt immer wieder unter Depressionen, zog sich dann zurück und sei für Frau A. nicht erreichbar gewesen. Sonst sei die Mutter sehr fürsorglich, ängstlich, aber auch bestimmend gewesen. Bis heute glaube die Mutter zu wissen, was für Frau A. gut sei. Sie telefonieren täglich und Frau A. besuche sie mindestens zweimal pro Woche. Wenn die Patientin die Erwartungen der Mutter nicht erfüllte, fühlte diese sich schlecht und machte Frau A. Vorwürfe. Der Vater war herzlich, aber auch bestimmend. Die Eltern hätten viel gestritten. Die Mutter habe immer gesagt, Sex sei etwas, was man über sich ergehen lassen müsse, und das habe die Patientin manchmal im Kopf, wenn sie selbst Sex habe. Frau A. erzählt, die anderen würden ihr ständig sagen, wie sie sein solle, und damit es keinen Streit gäbe, passe sie sich an. Außerdem fürchte sie auch, »wenn sie was anders und falsch mache, könnte etwas Schlimmes passieren.« Auf meine Frage, was sie in Herrn B. verliebt gemacht habe, sagt sie: »Ich habe mich bei ihm sicher gefühlt, er wusste, was er wollte.«
Herr B. ist 37 Jahre, Bauingenieur in einer großen Firma. In seinem Auftreten wirkt er distanziert, bestimmend und fordernd. Frau A. ist seine zweite längere Partnerin, davor habe er einige nur ein paar Monate dauernde Beziehungen gehabt. In der ersten längeren Beziehung sei die Sexualität gut gewesen, aber die Partnerin sei egoistisch, unzuverlässig, wenig verbindlich gewesen. Er äußert sich gegenüber einer Sexualtherapie sehr skeptisch, wolle es aber mitmachen, weil die Beziehung sonst harmonisch sei und er Frau A. liebe. Seine Eltern haben sich getrennt, als er zwei Jahre alt war und er wuchs bei der Mutter auf. Die Mutter habe immer gearbeitet und hätte ihn machen lassen und hatte wenig Zeit, sich zu kümmern. Als er in der Schule einmal mit einem Lehrer Schwierigkeiten hatte, habe sie ihm keinen Halt gegeben. Er hätte sich insgesamt mehr Unterstützung gewünscht, aber so sei er früh selbstständig gewesen. Sein Vater sei sehr distanziert, er habe wenig Kontakt zu ihm. Herr B. sei gleich nach dem Abitur von zuhause ausgezogen, habe auch zu seiner Mutter wenig Kontakt, sie lebe weit entfernt.
Als ich ihn frage, was ihn in Frau A. verliebt gemacht hat, sagt er: »Sie hat schutzbedürftig gewirkt und ihre Verbindlichkeit.« Während der Beziehung mit Frau A. hatte er eine Außenbeziehung, da sei es nur um Sex gegangen, es habe Frau A. aber sehr verletzt.
Um zu verstehen, wie die intrapsychischen Konflikte beider Partner interpersonell ausgetragen werden, ist das Kollusionsmodell hilfreich.
2.2 Kollusionsmodell
Dieses Modell, das Jürg Willi zur Erklärung der Psychodynamik von Paarbeziehungen(1)(1) entwickelte, geht davon aus, dass wir bei der Partnerwahl(1) in einer vertrauten Situation (Beziehungsmuster aus der Ursprungsfamilie(1)) etwas Neues (die Erfüllung unserer bisher ungestillten Wünsche und die Bewältigung ungelöster Konflikte) suchen. Das führt dazu, dass die Partner durch ein gleichartiges, unbewältigtes inneres Konfliktthema verbunden sind. Das bedeutet: Das Paar trägt den gleichen ungelösten intrapsychischen Konflikt(2) in sich. Dieser besteht wie jeder Konflikt aus gegensätzlichen Wünschen und Ängsten.
Beim (analen) Autonomie-Grundkonflikt(1) wie bei unserem Paar A./B. zum Beispiel ist es auf der einen Seite der Wunsch nach Autonomie, Dominanz und Selbstbestimmung und auf der anderen Seite nach Abhängigkeit, steuerndem Halt und Schutz. Dazu gehören die entsprechenden Ängste, wie die Angst davor, bestimmt zu werden, ausgeliefert zu sein oder vor Trennung. Wenn die Partner dann versuchen, den inneren Konflikt zu lösen, indem jeder nur noch die eine Seite des Konfliktes lebt, die Seite der Wünsche,(1) die ihm weniger Angst macht und die andere in den Partner delegiert, spricht Willi von Kollusion. Es handelt sich dabei um eine interpersonale Abwehrform(1). Die ängstigenden Wünsche werden dann im Partner bekämpft oder in Identifikation mit dem anderen gelebt. Dabei übernimmt einer die Kindrolle (regressive) und der andere die Elternrolle (progressive). Nach OPD formuliert (Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik(1)), einem Manual für Diagnostik und Therapieplanung psychodynamischer Therapien, befinden sie sich im aktiven oder passiven Modus. Die Rollen werden nicht mehr flexibel im Wechsel ausgefüllt. Der passive Partner zeigt sich gefügig und abhängig, während der Aktive Autonomie und Dominanz lebt. Dadurch kann der Dominierende eigene Trennungsängste(1) und Abhängigkeitswünsche(1) in den unterwürfigen Partner delegieren und dieser umgekehrt seine Autonomiewünsche in den aktiven Partner. Indem der abhängige »Untertan« sich unterwirft, kann er einen Teil seiner eigenen Autonomiewünsche(1) in der Identifikation mit dem Partner befriedigen. Oder er kann diese auch im anderen bekämpfen und dem Partner vorwerfen, alles zu bestimmen. Entsprechendes gilt umgekehrt für den autonomen »Herrscher«. Wenn allerdings die in den Partner delegierten Anteile beispielsweise durch äußere Auslöser oder eine veränderte Lebenssituation im eigenen Selbst wieder hochkommen, kann aus der Kollusion ein interpersoneller Konflikt werden.
Anders als bei dem Paar A./B. kann die progressive oder die regressive Position auch nach außen verlagert werden. Ein Beispiel wäre ein Paar mit (oralem) Grundkonflikt(1) (Autarkie versus Versorgung(1)), in dem die Sekretärin des Mannes3 seine Versorgungswünsche(1) erfüllt. Probleme wird es erst dann geben, wenn der Mann pensioniert wird und jetzt erwartet, dass seine Frau die Versorgungswünsche übernimmt.
Es kann aber auch die regressive Position nach außen verlagert werden, wenn das Paar sich um die hilfsbedürftigen Eltern oder ein schwieriges Kind kümmern muss, so dass beide Partner die aktive Rolle übernehmen. Drittpersonen können auch als »Außenfeind« oder »einseitiger Bündnispartner« eine Funktion für eine Paarbeziehung haben. Einseitiger Bündnispartner könnte zum Beispiel der Bruder der Frau sein, mit dem sie alle Eheprobleme bespricht, anstelle dies in der Paarbeziehung zu tun. Ein Außenfeind schweißt das Paar zusammen, indem es in ihn alles Negative hineinprojiziert. In dem Fallbeispiel von Paar A./B. waren das die bestimmenden Eltern von Frau A. Es können aber auch der fordernde Chef oder die faulen Kollegen sein.
Eine Drittperson kann auch eine »Aufgabenteilung« in einer ehelichen Dreiecksbeziehung(1) ermöglichen. So könnte eine Geliebte beispielsweise als versorgende Ersatzmutter dienen, wenn die Ehefrau diese fürsorgliche Seite nicht lebt, oder sie könnte Distanz schaffen, wenn beide Partner zu viel Nähe und Intimität nicht ertragen.
Wenn die interpersonale Abwehr(2)konstellation eines Paares wie oben erwähnt etwa durch ein äußeres Ereignis aus dem Gleichgewicht gerät, kann an deren Stelle auch die psychosomatische Abwehr(1) (Liz 1969 zit. nach Mentzos 1988) zum Beispiel in Form einer sexuellen Funktionsstörung treten. Ein sexuelles Symptom kann für die Paarkollusion ebenfalls die Bedeutung äqivalent einer Drittperson haben. Dazu passt auch, dass wir von Patienten mit einer sexuellen Funktionsstörung nicht selten den Satz hören: »Unsere Beziehung ist so harmonisch, wenn nur das sexuelle Problem nicht wäre.«
Aber auch Medikamente wie PDE-5-Hemmer (Phosphodiesterase-5-Hemmer)(1)(1) gegen die Erektionsstörungen können die Bedeutung vergleichbar mit Drittpersonen in einem Paarkonflikt haben.
Einige meiner Patienten haben mir erzählt, ihre Frauen sollten nicht wissen, dass sie PDE-5-Hemmer nehmen, es gäbe ihnen ein Stück Abgrenzung. Man muss sich dabei fragen, welche Angst dahintersteckt, welche Leistungsvorstellungen und welche Scham, nicht dem Selbstbild vom potenten Mann zu entsprechen. Es erscheint dann nicht unwahrscheinlich, dass die Versagensangst(1)(1) auch eine Rolle für die Erektionsstörung spielt. Andere Männer hatten die Pillen in der Nachttischschublade, was den Partnerinnen auch bekannt war, aber die Frauen durften nicht wissen, wann sie die Tabletten nahmen und wann nicht. Es war ein Stück Unabhängigkeit. Mit der Bedeutung der Tabletten für die Partnerinnen werden wir uns noch im Abschnitt III. Therapie beschäftigen, wie auch mit der Rolle der Therapeutin als Drittperson in einem Paarkonflikt(1).
Willi ging 1975 bei der Entwicklung seines Kollusionsmodells von den 4 Grundkonflikten(1)(1) der Psychoanalyse aus. M. E. lässt sich das Modell auch gut auf alle OPD-Konflikte(1) (Unterwerfung vs. Kontrolle(1); ödipaler Konflikt(1); Versorgung vs. Autarkie(1); Abhängigkeit vs. Individuation(1); Identitätskonflikt(1); Selbstwertkonflikt(1); Schuldkonflikt(1)) anwenden, die besonders die gegenwärtigen beobachtbaren Bewältigungsmuster(1) erfassen. Dabei sollte aber hinterfragt werden, ob es sich psychogenetisch nicht auch um einen – von einem anderen Grundkonflikt – abgeleiteten Konflikt bzw. um eine Konfliktlösung handelt. Das war bei dem Paar Herbst der Fall, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden.
Für die Therapieplanung einer Symptomatik, die durch Paarkonflikte(1) ausgelöst ist, erscheint es mir hilfreich, einen Beziehungsfokus im Sinne der OPD zu erarbeiten. Also anhand der erzählten Beziehungsepisoden zu klären, wie die Patientin sich selbst erlebt, wie sie andere erlebt, wie andere (Partner, Therapeutin) die Patientin erleben, wie andere (Partner, Therapeutin) sich im Kontakt mit der Patientin erleben.
Schulz von Thun (1989) hat in seinem Buch Miteinander reden 2 die Kommunikationsstile verschiedener Kollusionsmuster(1) und die sich daraus ergebenden Teufelskreise anschaulich dargestellt. Wir werden im Therapieteil noch darauf zurückkommen.
Wenn der sexuellen Funktionsstörung(1)(3) ein intrapsychischer Konflikt zugrunde liegt, kann die sexuelle Symptomatik durch Konversion(1) und/oder durch Somatisierung(1) entstanden sein. Bei der Konversion stellt die Sexualstörung den körperlichen Ausdruck (»Gebärdensprache«) einer unbewussten Fantasie oder einer verdrängten Vorstellung dar, ist symbolischer Ausdruck eines unbewältigten Konfliktes(1). So könnte es sich beispielsweise bei einem sekundär auftretenden Vaginismus(1) einer Frau, nachdem sie von der Affäre ihres Mannes erfahren hat, um eine Konversionsstörung(1) handeln. Sie verschließt sich ihm. Bei der Somatisierung werden anstelle der ängstigenden Affekte(1) nur noch die körperlichen Begleitsymptome (Affektäquivalent(1)e) wahrgenommen. So kann zum Beispiel aus Verlustangst(1) nicht die Wut auf die Partnerin gespürt, sondern nur die Erektionsstörung bemerkt werden. In beiden Fällen hat das Symptom eine Funktion für den Einzelnen. Wenn aus den intrapsychischen Konflikten beider Partner ein interpersoneller Konflikt(1) entstanden ist, kann das sexuelle Symptom eine Funktion für das Paar haben. Es könnte zum Beispiel verhindern, dass die Partner mit den ängstigenden Wünschen konfrontiert werden. Wie wir diese Funktion erkennen können, werden wir uns in Kapitel 7 Der diagnostische Werkzeugkoffer ansehen.
Neben diesen Kollusionen mit komplementärer Beziehungsstruktur gibt es auch Kollusionen(1)(1) mit symmetrischer Beziehungsstruktur, wenn zum Beispiel beide Partner aufgrund eines narzisstischen Grundkonfliktes(1)(1) sehr leistungsorientiert und rivalisierend sind. Mentzos (1988) weist darauf hin, dass es in einer Beziehung auch eine größere Anzahl von asymmetrischen und symmetrischen Teilbeziehungen geben kann. Der eine ist dann auf diesem Gebiet der Abhängig-Unterlegene, der andere auf einem anderen Gebiet und in jeder dieser einzelnen Teilbeziehungen sind besondere interpersonale Abwehrkonstellationen(3) enthalten, die dann auch mit dem Paar analysiert werden sollten. Auf diese Unterschiede in den einzelnen Gebieten hinzuweisen entlastet meiner Erfahrung nach die Paare und sie sind eher bereit, sich in die Position des anderen einzufühlen.
Betrachten wir nun die Paarbeziehung von Frau A. und Herrn B. mithilfe des Kollusionsmodells.
Die vertraute Situation, das Beziehungsmuster, das Frau A. aus ihrer Herkunftsfamilie kennt, ist, dass der andere sich ihr gegenüber gleichzeitig bestimmend und fürsorglich verhält. Für Herrn B. ist eine vertraute Situation, dass er sich um alles allein kümmern muss und selbst entscheidet.
Das Neue, nämlich die Hoffnung, es würden sich in dieser Beziehung endlich die ungestillten Wünsche erfüllen, erfährt die Therapeutin oft, wenn sie danach fragt, was die Partner ineinander verliebt gemacht hat. Diese Frage gibt auch oft eine Antwort darauf, welche Seite des Konfliktes in den anderen delegiert wird. Frau A. sagt: »Er beschützt mich und er weiß, was zu tun ist. Er ist zuverlässig und immer gut drauf.« Herr B. sagt: »Sie ist schutzbedürftig und verlässlich.« Der gemeinsame intrapsychische Konflikt könnte bei diesem Paar ein analer Autonomie-Grundkonflikt(2) (zwischen Macht und Ohnmacht, OPD: Unterwerfungs-Kontroll-Konflikt(2)) sein. Wir benötigen, um das entscheiden zu können, aber weitere diagnostische Werkzeuge.
Als die beiden die Rollen aufteilen, übernimmt Frau A. die Rolle der Ängstlichen, Abhängigen, die sich nach einem »steuernden Objekt« sehnt. Herr B. hingegen sagt, was zu tun ist und kann seine eigenen Wünsche nach Halt gebender Sicherheit in Identifikation mit Frau A. leben, ohne selbst abhängig und schwach sein zu müssen. Er übernimmt auch einen Stellvertreterkampf gegenüber ihren ansprüchlichen und dominanten Eltern.
Als Frau A. gern heiraten und Kinder haben möchte und Herr B. das ablehnt, zeigt sie zunächst Verständnis, aber sie verliert die sexuelle Lust. Die Situation verschärft sich, als Herr B. kurze Zeit später eine Außenbeziehung beginnt.
Die Beziehungsdynamik der Kollusion zeigt sich auch in den Antworten auf die folgenden Fragen:
Welche Entwicklung ermöglichte Herr B. seiner Partnerin?
Sie konnte sich scheinbar von den Eltern lösen, mit ihm im Hintergrund traute sie sich zu widersprechen. Ihm wiederum ermöglichte sie das Gefühl von Sicherheit und Halt, ohne das Gefühl, abhängig zu sein.
Welche Entwicklung beim Partner verhinderten beide?
Herr B. brauchte sich nicht seinem Wunsch nach Bindung und der dann auftretenden Angst des Ausgeliefertseins zu stellen, Frau A. musste sich nicht mit ihren Wünschen nach Eigenständigkeit und der dann auftretenden Trennungs- und Versagensangst auseinandersetzen.
Wir werden diesem Paar im Abschnitt II. Diagnostik wiederbegegnen und uns verschiedene Werkzeuge ansehen, mit denen sich das Kollusionsmuster erkennen lässt: Fragen zur Beziehungsdynamik, Szene, Übertragung-Gegenübertragung und Therapiezieldiskussion. Auch die Frage nach der Funktion des Symptoms werden wir dann noch einmal aufgreifen. Wahrscheinlich haben Sie aber schon jetzt Vermutungen dazu.
Beim Kollusionsmodell(2) nach J. Willi wird davon ausgegangen, dass das Paar den gleichen intrapsychischen Grundkonflikt(4) hat, der als interpersonelle Kollusion(1) mit aufgeteilten Rollen (regressive Kindrolle und progressive Elternrolle) gelebt wird. Das Paar kann die progressive oder regressive Position auch nach außen auf Dritte verlagern. Das sexuelle Symptom kann die Funktion haben zu verhindern, dass die Partner mit den ängstigenden Wünschen konfrontiert werden.
2.3 Bindungsstil
Ausgangspunkt der Bindungstheorie(1) ist das von Bowlby angenommene angeborene primäre Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit spendenden Anderen, das von den Bezugspersonen(1) unterschiedlich befriedigt wird (Bowlby 1988, 1995). Aus diesen frühen und auch späteren Interaktionserfahrungen von Säuglingen und Kleinkindern entwickeln diese ein bestimmtes Bindungsmuster(1)(1)(1)(1). Es wird dabei zwischen sicher und unsicher gebunden unterschieden. Zu den unsicheren Bindungsmustern zählen die ambivalente (hyperaktivierte), die vermeidende (desaktivierte) und die desorganisierte(1) Form (Ainsworth et al. 1978). Diese Bindungsstile sind Anpassungsstrategien an die nicht idealen frühen Bezugspersonen(1). Langfristig schränken sie aber die Beziehungsgestaltung ein. Das führt im Verlauf der Kindheit zu sicheren oder verschiedenen unsicheren Überzeugungen (inneren »Arbeitsmodellen(1)«), inwieweit hilfreiche äußere und in der Folge auch innere Instanzen vorhanden sind, um Belastungen zu bewältigen. Für unsicher-ambivalent gebundene Menschen gilt die Einstellung: »Ich bin sehr auf Hilfe/Begleitung angewiesen, kann mir aber nie sicher sein, dass diese gegebenenfalls auch trägt.« Unsicher-vermeidende(1) Menschen haben das innere Arbeitsmodell: »Es gibt sowieso niemanden, der mir helfen kann, insofern bleibe ich lieber auf Distanz.«
Die sichere Haltung beinhaltet: »Ich bin nicht allein in meiner Not, die anderen sind verlässlich und werden mir helfen können.« (Bowlby 1988, 1995; Übersicht z. B. bei Spangler und Reiner 2017; Behringer 2017). Das Ausmaß der Bindungssicherheit(1) wird aber auch von genetischen Faktoren mitbestimmt (Schauenburg 2018).
Patienten, die unsicher-ambivalent gebunden sind, haben oft Schwierigkeiten, ihre Emotionen(1) zu regulieren. Sie mögen sich in einem Moment hilflos, überfordert und anklammernd verhalten und im nächsten Moment vorwurfsvoll, feindselig und abweisend (Slade 1999; Strauß 2000, 2006). Sie haben in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass die Bindungspersonen für ihre Bedürfnisse und Bindungssignale hin und wieder erreichbar waren, allerdings nicht verlässlich. So haben sie die Strategie entwickelt, ihre Bindungssignale(1) und Emotionen bis zur Dramatisierung zu verstärken, um den anderen zu erreichen und zu Reaktionen auf ihre Gefühle zu bewegen. Das kann aber dazu führen, dass diese unsicher-ambivalent (ängstlich) gebundenen Personen dann durch die eigenen Emotionen überflutet werden und diese schlecht regulieren können. Außerdem neigen sie dazu, verstärkt und kontrollierend auf emotionale Signale des Partners in der Beziehung zu reagieren, insbesondere auf solche, die sie als Zurückweisung oder Nichtbeachtung erleben.
Patientinnen mit einem unsicher-vermeidendenden(2) Bindungsstil gestalten die Interaktion emotionsarm und versachlichend und neigen dazu, eigene Bedürftigkeit und Bedeutung von Beziehungen zu leugnen. Sie erscheinen unnahbar, fragen selten nach Hilfe oder lehnen diese ab (Slade 1999). Sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie ihre Emotionen, besonders negative Affekte und eigene Bedürftigkeit, herunterregulieren oder unterdrücken müssen, weil die Bindungspersonen auf diese emotionalen Signale ohnehin nicht reagieren. Wenn durch heftige Emotionen oder gar Forderungen ihres Gegenübers die eigenen Emotionen aktiviert werden, neigen sie dazu, sich zurückzuziehen, da sie nicht wissen, wie sie in einer Beziehung Emotionen regulieren können. Sie kennen nur die Strategie der Selbstregulation(1) und Herunterregulierung ihrer Gefühle.
Das desorganisierte Bindungsverhalten(1) ist verwirrend und widersprüchlich. Es werden traumatische Erlebnisse in der Kindheit vermutet, die zu diesem Bindungsmuster führen.
Sicher gebundene Paare verbinden sich(2) nach dem Motto »Gleich und Gleich gesellt sich gern«, bei den unsicher gebundenen Paaren gilt »Gegensätze ziehen sich an« (Grau 1997). Bei in Streit verstrickten Paaren gibt es oft die Kombination unsicher-vermeidend(3) (häufiger der Mann) und unsicher-ambivalent(1) (häufiger die Frau), die dann zur Verfolgerin wird und Nähe will, während der Mann sich zurückzieht. Vermutlich folgen bis zu 60 % der Paare, die sich in einer Paartherapie vorstellen, diesem Muster (Johnson 2014, zit. nach Roesler 2018). Banale Situationen können bei diesen Paaren zu großen Missverständnissen und emotional geladenen Streits führen. Nicht selten habe ich erlebt, wie diese Paare nach einem Wochenendausflug wütend aufeinander in die Therapiesitzung kamen. Sie hatten beispielsweise einen gemeinsamen Spaziergang im Wald oder auch am Meer gemacht, die Sonne schien und der vermeidende Partner genoss das gemeinsame Schweigen und fühlte sich seiner Partnerin so nah, wie es ihm möglich war. Sie hingegen wartete darauf, dass er etwas sagte, am besten noch über seine Gefühle spricht. Zurück zuhause wirft seine enttäuschte und ob der Bindung ängstlich verunsicherte Partnerin ihm vor, sie hätten sich nichts mehr zu sagen und hat die Trennung vor Augen. Den Partner trifft es im wahrsten Sinne aus heiterem Himmel. Er ist sich keiner Schuld bewusst, die heftigen Affekte der Partnerin machen ihn hilflos und er zieht sich zurück, was bei ihr die Verlassenheitsangst verstärkt und sie dazu bringt, ihn umso heftiger emotional zu verfolgen.
Wie von v. Sydow (2017) beschrieben lässt sich in den Paartherapien(1)(1) beobachten, dass unsicher-vermeidende Partner (von neutralen Beobachtern) als ruhiger wahrgenommen wurden, wenn die Partnerin weniger emotionale und mehr instrumentelle Zuwendung zeigt, wie beispielsweise konkrete Ratschläge und intellektuelle Diskussion des Problems. Für bindungsängstliche Partner ist die emotionale Rückversicherung und Zugänglichkeit des Partners hilfreich. Wir werden im Therapieteil darauf zurückkommen.
Nach Roesler (2018) finden sich Personen mit einem desorganisiert-verstrickten(1) Bindungsmuster meist mit ebensolchen Partnerinnen zusammen. Diese Beziehungen sind von heftigen Auseinandersetzungen und Verletzungen, dramatischen Konflikten und häufigen Trennungsdrohungen gekennzeichnet. Oft werden diese auch vollzogen, dann aber häufig nach nur wenigen Tagen wieder zurückgenommen. Bei extrem eskalierenden Streitpaare(1)n sollten diese desorganisierten Bindungsmuster in Erwägung gezogen werden.
Es wird kontrovers diskutiert, ob Sexualität(1)(1) und Bindung nicht letztlich getrennte Systeme sind. In neurowissenschaftlichen Studien mit bildgebenden Methoden konnte gezeigt werden, dass Sexualität und Bindung sich tatsächlich unterschiedlicher neuronaler Substrate(1) bedienen, wenn gleich es Überlappungen gibt und in beiden Fällen Belohnungssysteme(1)