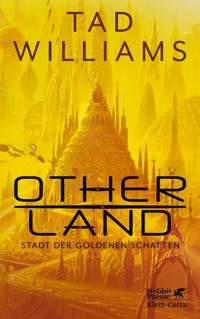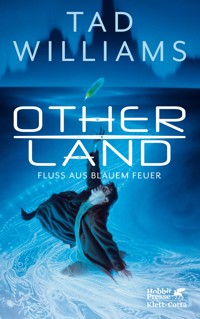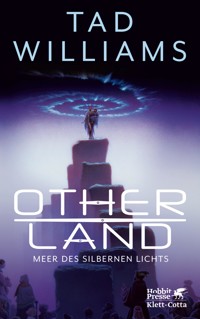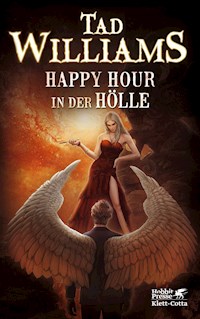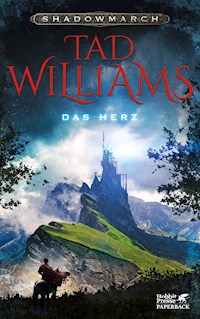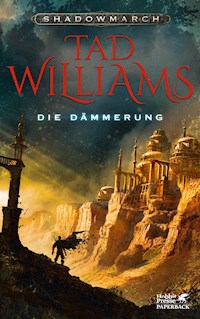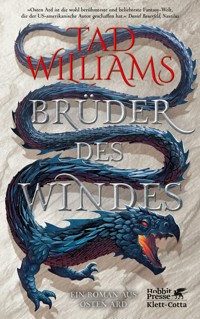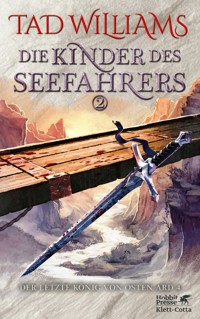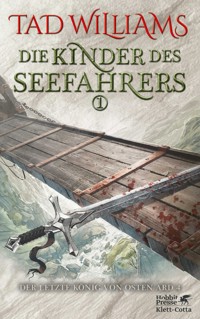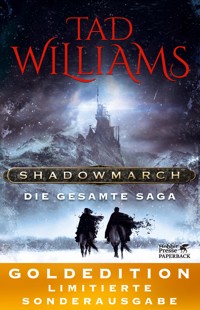
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Shadowmarch
- Sprache: Deutsch
Tad Williams erzählt auf knapp 3200 Seiten ein Epos um Eifersucht, Herschafft und dunkle Mächte. Vielschichtig und fesselnd knüpft er mit der Tetralogie an seinen ersten großen Erfolg »Das Geheimnis der Großen Schwerter« an. Die Hobbit Presse Gold Edition umfasst alle vier Teile der Saga und ist nur begrenzte Zeit lieferbar. Das Schicksal des Landes Eion lastet schwer auf den Schultern der königlichen Zwillinge Barrick und Briony, denn aus dem Süden und dem Norden nähert sich der Feind. Während sich in der Nebelwelt der Zwielichtzone ein riesiges Elbenheer bereit macht, das Land zurück zu erobern, aus dem das Volk von den Menschen vertrieben wurde, sammelt im Süden ein machtbesessene Herrscher seine Heere um sich. Als Barrick gefangen genommen wird, muss seine Schwester Briony aus der Südmarkfeste fliehen und in der Fremde nach Unterstützung suchen, um das Land zu befreien. Kann die Welt der Menschen gerettet werden oder wird sie inmitten der Armeen der Elben und der Autarchen zu Grunde gehen? Dieses E-Book enthält: - Die Grenze - Das Spiel - Die Dämmerung - Das Herz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 5198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
GOLDEDITION
DIE GESAMTE SAGA
Inhalt
Dieses E-Book enthält die folgenden Bände aus der Reihe »Shadowmarch«:
Die Grenze (Band 1)
Das Spiel (Band 2)
Die Dämmerung (Band 3)
Das Herz (Band 4)
BAND 1
DIE GRENZE
Aus dem Englischen vonCornelia Holfelder-von der Tann
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Wer gern den genauen Überblick über das Wer, Was und Wo hat, findet mehrere Karten und am Ende des Buchs ein Verzeichnis der Personen, Orte und sonstigen wichtigen Dinge.
Die Karten beruhen auf einem umfangreichen Korpus von Reiseberichten, auf nahezu unleserlichen alten Dokumenten, Transskripten mündlicher Äußerungen, gehauchten letzten Worten sterbender Eremiten sowie einem alten Kasten voller Grundbuch-Akten, der auf einem syannesischen Flohmarkt auftauchte. Ähnlich geheime Quellen und mühselige Forschungen stecken auch hinter der Erstellung des Registers. Möge der Leser weisen Gebrauch davon machen und stets bedenken, dass manch einer sein Leben gegeben oder zumindest sein Augenlicht und seine wissenschaftliche Reputation aufs Spiel gesetzt hat, um ihm diese Hilfsmittel verfügbar zu machen.
Hobbit Presse Paperback
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Shadowmarch Volume One«
im Verlag DAW Books New York
© 2004 by Tad Williams
Für die deutsche Ausgabe
© 2005, 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: Birgit Gitschier, Augsburg
Unter Verwendung einer Illustration von Max Meinzold, München
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94956-8
E-Book: ISBN 978-3-608-10159-1
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Dieses Buch widme ich meinen Kindern, Connor Williams und Devon Beale, die jetzt, da ich dies schreibe, noch klein, aber schon von unglaublicher Power sind. Sie versetzen mich jeden Tag in Erstaunen.
Ich hoffe, irgendwann, wenn sie erwachsen und ihre Mutter und ich bereits in den jenseitigen Gefilden sind, wird es sie wärmen, zu wissen, wie sehr wir sie geliebt haben, und es wird ihnen ein ganz klein wenig peinlich sein, dass sie diesen Umstand so schamlos ausgenutzt haben – bezaubernde, lustige kleine Kerlchen, die sie sind.
Inhalt
Kurze Geschichte Eions
Vorspiel
ERSTER TEIL BLUT
1 Eine Lindwurmjagd
2 Ein Felsklotz im Meer
3 Ein rechter Blauquarz
4 Ein überraschender Vorschlag
5 Lieder vom Mond und den Sternen
6 Blutsbande
7 Die Schwestern vom Bienentempel
8 Das Versteck
9 Weiße Schwingen
10 Brennende Hallen
11 Die Braut des Gottkönigs
12 In Stein gebettet
ZWEITER TEIL MONDLICHT
13 Vansens Auftrag
14 Weißfeuer
15 Der Frauenpalast
16 Der Hochedle Riecher
17 Schwarze Blumen
18 Ein Gast weniger
19 Der Gottkönig
20 Im Land des Mondes
21 Die Münze des Schankknechts
22 Die Ernennung
23 Der Sommerturm
24 Leoparden und Gazellen
25 Spiegel
26 Entscheidungen
DRITTER TEIL FEUER
27 Milnersford
28 Der Abendstern
29 Der Leuchtende Mann
30 Erwachen
31 Nächtlicher Besuch
32 In dieser Welt
33 Die bleichen Wesen
34 Auf einem Feld in Marrinswalk
35 Die seidene Schnur
36 Zu Füßen des Riesen
37 Die dunkle Stadt
38 Stumm
39 Winterfest
40 Zorias Flucht
Personen
Orte
Dinge und Tiere
Dank
Kurze Geschichte Eions
Unter besonderer Betrachtung des Aufstiegs der nördlichen Markenlande
dargestellt von dem Gelehrten Finn Teodorus
nach Clemons »Geschichte unseres Kontinentes Eion und seiner Völker«
auf Geheiß des hohen Herrn Avin Brone,
Graf von Landsend, Konnetabel von Südmark,
vorgelegt am 13. Tag des Enneamene im Jahre 1316 des Heiligen Trigon.
Im Jahrtausend vor unserem gegenwärtigen Zeitalter des Trigonats wurde Geschichte allein in den alten Königreichen Xands geschrieben, jenes südlichen Kontinents, der die erste Heimstatt der Zivilisation war. Die Xander wussten nur wenig über ihre nördlichen Nachbarn, die Bewohner unseres Weltteils Eion, da sich dessen Inneres zumeist hinter unpassierbaren Bergen und dichten Wäldern verbarg. Die Südländer trieben lediglich mit einigen hellhäutigen wilden Küstenbewohnern Handel und besaßen so gut wie keine Kenntnisse über jenes geheimnisvolle Zwielichtvolk, das mit gelehrtem Namen »Qar« hieß und über ganz Eion verstreut lebte, vor allem aber im äußersten Norden unseres Kontinents, wo es bis heute existiert.
Als sich über die Generationen der xandische Handel mit Eion ausweitete, erlebte auch Hierosol, der größte unter den neuen Handelshäfen an der eionischen Küste, ein stetes Wachstum, bis es schließlich mit Abstand die einwohnerreichste Stadt des gesamten nördlichen Weltteils war. Zwei Jahrhunderte vor Beginn der gesegneten Ära des Trigon konnte es Hierosol an Größe und kultureller Verfeinerung bereits mit vielen der dekadenten Hauptstädte des südlichen Kontinentes aufnehmen.
Zunächst war Hierosol eine Stadt mit vielerlei Göttern und vielerlei konkurrierenden Priesterschaften, und Glaubensstreitigkeiten und Götterrivalitäten wurden oft durch Verleumdung, Brandstiftung und blutige Straßenkämpfe ausgetragen. Dann jedoch schlossen die Anhänger der drei mächtigsten Gottheiten – die da waren: Perin, Herr des Himmels, Erivor, Herr der Wasser, und Kernios, Herr der schwarzen Erde – einen Pakt. Dieses Trigon, das Bündnis der drei Götter und ihrer Anhänger, erhob sich schon bald über alle anderen Priesterschaften und deren Tempel. Sein oberster Priester nannte sich fortan Trigonarch, und er und seine Nachfolger wurden die mächtigsten Glaubensfürsten in ganz Eion.
Jetzt, da reiche Warenströme durch seine Häfen flossen, da sein Heer und seine Flotte immer größer wurden und die Glaubensautorität sich in den Händen des Trigonats konsolidierte, wurde Hierosol zur beherrschenden Macht nicht allein Eions, sondern, da die Reiche des südlichen Kontinents Xand unaufhaltsam in Dekadenz versanken, der gesamten bekannten Welt. Die Vormachtstellung Hierosols währte fast sechshundert Jahre, bis das Imperium schließlich unter seiner eigenen Last zusammenbrach und den Raubzügen, die in Wellen von der krakischen Halbinsel und dem südlichen Kontinent hereinbrachen, anheimfiel.
Aus der Asche des hierosolinischen Reichs erhoben sich jüngere Königreiche im Herzland Eions. Syan überflügelte alle anderen, vereinnahmte im neunten Jahrhundert sogar das Trigonat selbst und verlegte die Trigonarchie samt ihrer hohen Priesterschaft von Hierosol nach Tessis, wo sie bis heute residiert. Syan wurde für ganz Eion zum Zentrum der Mode und Gelehrsamkeit und ist in vielerlei Hinsicht noch heute die führende Macht unseres Kontinents, doch seine Nachbarn haben den Mantel des syannesischen Imperiums längst abgeschüttelt.
Seit vorgeschichtlichen Zeiten teilen die Menschen Eions ihre Lande mit den sonderbaren, heidnischen Qar, im Volksmund auch »das Zwielichtvolk«, »die Zwielichtler«, »das stille Volk« oder, häufiger noch, »das Elbenvolk« genannt. Wenn auch die Sage von einer riesigen Qar-Siedlung im Norden Eions geht, einer düsteren, uralten Stadt von üblem Ruf, so lebten die Qar doch zunächst in ganz Eion, wenngleich nie in solcher Dichte wie die Menschen und vorwiegend in abgeschiedenen ländlichen Gegenden. Als sich die Menschen immer weiter über Eion verbreiteten, zogen sich viele Qar in die Hügel und Berge und dichten Wälder zurück. Mancherorts blieben sie aber auch und lebten sogar in Frieden mit den Menschen. Das wechselseitige Vertrauen war jedoch gering, und der unausgesprochene Nichtangriffspakt zwischen den beiden Völkern, der fast das gesamte erste Jahrtausend des Trigonats währte, beruhte vor allem auf der geringen Zahl der Zwielichtler und ihrer abgeschiedenen Lebensweise.
Mit dem Nahen des Jahrs 1000 kam der Große Tod, eine schreckliche Pest, die zuerst in den südlichen Seehäfen auftrat, sich dann aber über das ganze Land ausbreitete und großes Elend brachte. Die Krankheit tötete binnen Tagen, und nur wenige, die mit ihr in Berührung kamen, überlebten. Bauern ließen ihre Felder im Stich, Eltern ihre Kinder. Heilkundige weigerten sich, den Todkranken beizustehen, und selbst die Priester des Kernios waren nicht länger bereit, Zeremonien für die Toten abzuhalten. Am Ende des ersten Pestjahrs hieß es, ein Viertel aller Bewohner der südlichen Städte Eions sei der Seuche erlegen, und als die Geißel mit dem warmen Frühlingswetter wiederkehrte und noch mehr Menschen dahinraffte, glaubten viele das Ende der Welt gekommen. Das Trigon und seine Priester erklärten, die Seuche sei die Strafe für den Unglauben der Menschen, aber die meisten Leute bezichtigten zunächst Fremde und vor allem Südländer, die Brunnen vergiftet zu haben. Bald jedoch wurden näherliegende Schuldige ausgemacht – die Qar. Vielerorts galten die geheimnisvollen Zwielichtler ohnehin schon als Unholde, daher griff die Idee, dass die Pest ihr böses Werk sei, unter den verängstigten Menschen rasch um sich.
Die Angehörigen des Elbenvolks wurden erschlagen, wo immer man sie fand, ganze Stämme gefangen genommen und vernichtet. Die Raserei erfasste ganz Eion, angeführt von Kämpferscharen, die sich »Säuberer« nannten und sich zum Ziel gesetzt hatten, die Qar auszurotten, wenngleich in Zweifel steht, ob sie nicht mehr Menschen als Elben töteten, denn viele Menschendörfer, in denen ohnehin bereits der Große Tod gewütet hatte, wurden von Säuberern niedergebrannt, all jenen zur Mahnung, die sich womöglich ihrer »heiligen Mission« in den Weg zu stellen trachteten.
Die verbliebenen Zwielichtler flohen nordwärts, sammelten sich dann aber zu einer Abwehrschlacht bei einer Qar-Siedlung namens Kaltgraumoor, keinen Tagesmarsch vom heutigen Südmark, wo ich jetzt diese Chronik verfasse. (»Kaltgrau« war, wenngleich eine zutreffende Beschreibung des Kampfplatzes, doch offenbar eine Verballhornung von Qul Girah, was, laut Clemon, in der Sprache des Elfenvolks »Ort des Wachsenden« bedeutet, wobei mir die Quellen, auf die er dies gründet, nicht bekannt sind.) Es war eine furchtbare Schlacht, aber die Qar wurden geschlagen, nicht zuletzt dank der Ankunft eines Heeres, das von Anglin geführt wurde, dem Herrscher des Inselreichs Connord, der ein entfernter Verwandter der syannesischen Königsfamilie war. Die Zwielichtler wurden gänzlich aus den Menschenlanden vertrieben, hinauf in die trostlosen, dicht bewaldeten Regionen des Nordens.
Neben Tausenden, deren Namen weniger berühmt sind, fiel auch König Karal von Syan in der Schlacht bei Kaltgraumoor, doch sein Sohn, der ihm als Lander III. auf den Thron nachfolgte und später als »Lander der Gute« oder »Lander Elbenbanner« berühmt werden sollte, gab Anglin die nördlichen Grenzlande zum Lehen, auf dass er und seine Nachkommen fortan als Vorposten gegen die Qar die Grenze der Menschenwelt hüteten. So wurde Anglin von Connord der erste Markenkönig.
Nach Kaltgraumoor erlebte der Norden ein vergleichsweise friedliches Jahrhundert, wenngleich die Grauen Scharen, Söldnertruppen, die in den wirren Zeiten nach dem Großen Tod und dem Zusammenbruch des syannesischen Reiches an Zulauf gewonnen hatten, eine große Gefahr blieben. Diese gesetzlosen Ritter verdingten sich bei verschiedensten Despoten, um deren Nachbarn zu unterwerfen, oder aber sie suchten sich wehrlosere Opfer, indem sie Lösegeld für entführte Edelleute erpressten und raubend und mordend über die Bauern herfielen.
Anglins Nachkommen hatten das Grenzland in vier Marken aufgeteilt – die Nordmark, die Südmark, die Ostmark und die Westmark, die jedoch alle der Krone des Königreichs Südmark unterstanden –, und sie und ihre Blutsverwandten regierten diese Markenlande in weitgehender Harmonie. Doch dann, im Jahr 1103 des Trigonats, brach plötzlich und ohne Vorwarnung ein Qar-Heer von Norden über die Marken herein. Anglins Nachkommen kämpften erbittert, wurden aber aus dem größten Teil ihres Gebietes vertrieben und bis an die südliche Grenze zurückgedrängt. Nur der Beistand der kleinen Fürstentümer jenseits der Grenze (bekannt als »die Neun«) ermöglichte es den Markenländern, die Qar aufzuhalten, während sie auf Hilfe aus den großen südlichen Königreichen warteten – Hilfe, die quälend lange auf sich warten ließ. Es heißt, in diesen schrecklichen Kämpfen sei unter den Nordleuten erstmals ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl – und ein gewisses Misstrauen gegen die südlichen Reiche – erwachsen.
Nur der grimme Winter jenes Jahres erlaubte es den Menschen, die Qar in den Markenlanden in Schach zu halten. Im Frühling trafen dann endlich Heere aus Syan, Jellon und dem Stadtstaat Krace ein. Obwohl die Menschen den Zwielichtlern zahlenmäßig weit überlegen waren, wogte der Kampf im Norden lange Jahre hin und her. Als die Markenlande und ihre Verbündeten die Eindringlinge im Jahr 1107 endlich entscheidend schlugen und in ihre eigenen Gebiete zurückzutreiben suchten, um die Gefahr ein für alle Mal zu bannen, beschworen die zurückweichenden Zwielichtler einen Nebelwall herauf, der zwar die Menschen nicht gänzlich abzuhalten vermochte, aber doch jeden, der ihn passierte, verwirrte und verhexte. Nachdem mehrere bewaffnete Trupps verschwunden und nur einige wenige dem Wahnsinn verfallene Überlebende zurückgekehrt waren, gaben die Bündnisheere der Sterblichen auf und erklärten den Nebelwall, den sie die Schattengrenze nannten, zur neuen Grenze der Menschenlande.
Die Feste Südmark wurde vom Trigonarchen selbst wiedergeweiht – die Qar hatten sie während des Krieges als Bastion genutzt –, aber die Schattengrenze zerschnitt jetzt die Markenlande, und die gesamte Nordmark sowie große Teile der Ost- und Westmark lagen jetzt auf der anderen Seite. Doch obwohl ihre nördlichen Lehenslande und Burgen verloren waren, lebte Anglins Blutslinie fort: in seinem Urgroßneffen Kellick Eddon, dessen Tapferkeit im Kampf gegen das Elbenvolk jetzt schon Legende war. Als die angrenzenden »Neun« sich zusammenschlossen und dem neuen König von Südmark Gefolgschaft schworen (nicht zuletzt um des Schutzes vor den raubgierigen Grauen Scharen willen, die im Chaos nach dem Krieg gegen die Qar neu erstarkten), war der König der Markenlande wieder der mächtigste Herrscher im Norden Eions.
Die Gegenwart
aus persönlicher Sicht des Finn Teodorus und ohne Berufung auf
den seligen Magister Clemon von Anverrin
Heute, im Jahr 1316 des Trigon, dreihundert Jahre nach Kaltgraumoor und zwei Jahrhunderte nach dem Verlust der nördlichen Markenlande und der Erschaffung des Nebelwalls, hat sich der Norden kaum verändert. Die Schattengrenze ist geblieben und markiert aufs wirksamste das Ende der bekannten Welt – selbst Schiffe, die in nördlichen Gewässern vom Kurs abkommen, kehren kaum je zurück. Südmark aber wurde von da an im Volksmund auch Shadowmarch oder Schattenmark genannt, und dieser Name hat sich hartnäckig gehalten.
Syan hat die Macht über sein einstiges Imperium fast völlig eingebüßt und ist jetzt nur noch das einflussreichste unter mehreren großen Königreichen im Herzland Eions, aber es gibt andere Bedrohungen. Die Macht des Autarchen, des Gottkönigs von Xis auf dem südlichen Kontinent, wächst beständig. Zum ersten Mal seit beinahe tausend Jahren kontrollieren die Xander Teile des nördlichen Kontinents. Viele Länder an den südlichsten Küsten Eions zollen dem Autarchen bereits Tribut oder werden von Herrschern regiert, die seine Marionetten sind.
Das ruhmreiche Haus Eddon herrscht bis heute in Südmark, und unser Markenkönigreich ist die einzig echte Macht im Norden – Brenland und Settland sind, wie allgemein bekannt, kleine, bäuerliche, in sich gekehrte Länder –, doch die Nachfahren des großen Markenkönigs und ihre treuen Gefolgsleute erfüllt bereits die Sorge, wie weit der Arm des Autarchen noch nach Eion hineinlangen und welches Unheil das für uns bedeuten wird – wie das unselige Schicksal unseres geliebten Monarchen, König Olin, zeigt. Wir können nur beten, dass er unversehrt zu uns zurückkehrt.
Dies ist meine Chronik, auf Euer Geheiß verfasst, Herr. Ich hoffe, Ihr seid zufrieden.
(unterzeichnet) Finn Teodorus
Gelehrter und getreuer Untertan Seiner Majestät Olin Eddon
Vorspiel
Komm, Träumer, komm fort. Bald wirst du Zeuge von Dingen werden, die nur Schläfer und Zauberkundige sehen. Besteige den Wind und lass dich von ihm tragen – ja, er ist ein schnelles und furchterregendes Ross, aber vor dir liegen Meilen und Abermeilen, und die Nacht ist kurz.
Höher als ein Vogel fliegst du dahin, über die dürren Lande des südlichen Kontinents Xand, über den gewaltigen Tempelpalast des Autarchen, der sich Meile um Meile die steinernen Kanäle des großen Xis entlang zieht. Du hältst nicht inne – nicht sterblichen Königen gilt heute dein Interesse, nicht einmal dem mächtigsten von allen. Du fliegst vielmehr über den Ozean zum nördlichen Kontinent Eion, über das zeitlose Hierosol, einst Zentrum der Welt, jetzt aber Spielzeug von Räubern und Kriegsherren, doch auch hier säumst du nicht. Du willst weiter, saust über Fürstentümer hinweg, die bereits den Legionen des Autarchen tributpflichtig sind, und über andere, die es noch nicht sind, aber bald sein werden.
Jenseits der himmelhohen Berge, die den Südteil Eions vom Rest abgrenzen, jenseits der weglosen Wälder nördlich der Berge, erreichst du die grünen Lande der Freien Königreiche und schwingst dich tief über Felder und Fluren, über das blühende Herzland des mächtigen Syan (das einst noch viel mächtiger war), über weite Äcker und vielbereiste Straßen, über den bröckelnden Stein alter Adelssitze und weiter bis in die Marken, die an das graue Land jenseits der Schattengrenze stoßen und die nördlichsten noch von Menschen bewohnten Gefilde sind.
An der Schwelle zu jenen verlorenen, nicht zur Menschenwelt gehörigen Regionen des Nordens, im Königreich Südmark, steht hoch über einer weiten Bucht eine alte Burg, eine Feste, ringsum geschützt von Wasser, so würdevoll und schweigend wie eine Königin, die ihren königlichen Gemahl überlebt hat. Sie ist von prächtigen Türmen gekrönt, und die Dächer der niedrigeren Gebäude bilden ihren kunstvollen Flickenrock. Ein schmaler Dammweg zieht sich von der Burg zum Festland wie eine Schleppe, fächert sich dann auf zum Festlandsteil der Stadt, der in den Hügelfalten und am Buchtufer liegt. Die alte Festung ist jetzt Wohnstatt von Menschen, wirkt aber dennoch zuweilen wie etwas anderes, etwas, das sich an diese Sterblichen gewöhnt hat und sich sogar herablässt, ihnen Schutz zu gewähren, sie aber nicht wirklich liebt. Dennoch fehlt es ihr nicht an Schönheit, dieser imposanten Stätte mit ihren stolzen, windgezausten Fahnen und ihren sonnenlichtgefleckten Straßen. Doch obwohl diese Felsenburg der letzte helle und einladende Ort ist, den du siehst, ehe du in das Land der Stille und des Nebels gelangst, und obwohl das, was du dort in Kürze sehen wirst, finstere Folgen für diesen Ort haben wird, endet deine Reise nicht hier in Südmark – noch nicht. Heute ruft es dich anderswohin.
Du suchst den Spiegelbildzwilling dieser Burg, weit droben im Norden, die mächtige Festung der unsterblichen Qar.
Und jetzt, so plötzlich, als trätest du über eine Schwelle, bist du in deren Zwielichtland. Und obgleich die Feste Südmark, nur einen kurzen Ritt hinter dir, jenseits der Schattengrenze, noch von heller Nachmittagssonne beschienen ist, liegt diesseits des nebligen Grenzwalls alles in ewiger Abendstille. Die Wiesen sind hoch und dunkel, das Gras glänzt von Tau. Tief über den Hals des Windes gebeugt, bemerkst du, dass die Straßen unter dir so bleich wie Aalfleisch schimmern und ein kompliziertes Muster zu bilden scheinen, als ob ein Gott sein geheimes Tagebuch in den nebelverhangenen Erdboden geschrieben hätte. Du fliegst hoch über sturmwolkenverhüllte Berge hinweg und über Wälder, so weit wie Königreiche. Im Dunkel unter den Bäumen glühen Augen, und Stimmen wispern durch leere Schluchten.
Und jetzt endlich erblickst du dein Ziel, hoch und rein und stolz am Ufer eines dunklen Binnenmeers. Wenn die Südmarksfeste schon etwas Anderweltliches hatte, scheint an dieser Festung kaum etwas von deiner Welt: eine Million Millionen Steine sind hier aufeinandergetürmt, Onyx auf Jaspis, Obsidian auf Schiefer, und obgleich diesen Türmen eine raffinierte Symmetrie innewohnt, ist es doch eine Art von Symmetrie, die Sterblichen auf den Magen schlägt.
Du landest jetzt, steigst endlich vom Wind, um durch die labyrinthischen, oft engen Gänge zu eilen, wobei du dich aber an die breitesten und bestbeleuchteten hältst: Es ist nicht gut, unvorsichtig durch Qul-na-Qar zu wandern, dieses älteste aller Bauwerke (dessen Steine, wie es heißt, vor so vielen Ewigkeiten gebrochen wurden, dass die junge Erde noch warm war), und außerdem hast du nicht viel Zeit.
Das Schattenvolk der Qar hat ein altes Sprichwort, das da, grob übersetzt, lautet: »Selbst das Buch der Trauer beginnt mit einem Wort.« Das heißt, dass auch die wichtigsten Dinge einen simplen Anfang haben, wenn man ihn manchmal auch erst viel, viel später benennen kann – einen ersten Schwertstreich, ein Saatkorn, ein nahezu lautloses Luftholen, ehe ein Lied ertönt. Deshalb hast du es jetzt so eilig: Die Abfolge von Geschehnissen, die schließlich nicht nur Südmark, sondern die gesamte Welt bis in die Grundfesten erschüttern wird, beginnt hier und jetzt, und du wirst Zeuge sein.
In den Tiefen von Qul-na-Qar liegt eine Halle. Natürlich gibt es in Qul-na-Qar viele Hallen, so viele wie Zweige an einem alten, abgestorbenen Baum – ja, selbst in einem ganzen Garten solcher Bäume –, aber selbst jene, die Qul-na-Qar nur während des unruhigen Schlafs einer schlimmen Nacht geschaut haben, wüssten, welche Halle es ist. Sie ist dein Ziel. Komm weiter. Die Zeit wird knapp.
Die Halle ist so groß, dass es eine Stunde dauern würde, sie zu durchmessen, oder jedenfalls wirkt es so. Erhellt ist sie von zahllosen Fackeln, aber auch von anderen, ungewöhnlicheren Lichtern, die wie Glühwürmchen unter dem dunklen, zum Abbild von Stechpalmenund Schwarzdornästen geschnitzten Gebälk glimmen. An beiden Längswänden reihen sich Spiegel, jedes Oval so dick mit Staub bedeckt, dass man kaum damit rechnen würde, darin auch nur den schwächsten Widerschein der Funkellichter und Fackeln zu erblicken, aber noch erstaunlicher ist, dass in dem trüben Glas auch andere, dunklere Formen erkennbar sind. Diese Schemen sind auch dann da, wenn die Halle leer ist.
Jetzt ist die Halle nicht leer, sondern voller Wesen, schöner und schauriger. Wenn du in diesem Moment über die Schattengrenze zurückversetzt würdest, auf einen der großen Märkte der südlichen Hafenstädte, und dort Menschen aus der ganzen, weiten Welt in all ihren unterschiedlichen Gestalten, Größen und Farben an einem Ort sähst, würdest du doch über ihre Einförmigkeit staunen, nachdem du die Qar in ihrer hohen, dunklen Halle versammelt gesehen hast. Manche sind so überwältigend schön wie junge Götter, so groß und wohlgestaltet wie die majestätischsten Königinnen und Könige der Menschen. Andere sind so klein wie Mäuse. Wieder andere sind Wesen aus den Albträumen Sterblicher, klauenfingrig, schlangenäugig, bedeckt mit Federn, Schuppen oder öligem Pelz. Sie füllen die Halle vom einen Ende zum anderen, gestaffelt nach komplizierten, uralten Rangordnungen, tausend verschiedene Gestalten, geeint nur durch die heftige Abneigung gegen die Menschen und, in diesem Moment, durch tiefes Schweigen.
Am Kopfende des langen, spiegelgesäumten Raums sitzen zwei Gestalten auf hohen Steinthronen. Beide sind von menschenähnlichem Aussehen, aber mit einem so übernatürlichen Einschlag, dass nicht einmal ein betrunkener Blinder sie tatsächlich für Menschen halten könnte. Beide sitzen ganz still, aber bei der einen fällt es schwer zu glauben, dass sie keine Statue aus hellem Marmor ist, so steinern wie der Stuhl, auf dem sie sitzt. Ihre Augen sind offen, aber so leer wie gemalte Puppenaugen, als ob die Seele aus dem anscheinend jungen, weißgewandeten Körper entflohen und so weit davongeflogen wäre, dass sie nicht mehr zurückfindet. Die Hände liegen in ihrem Schoß wie tote Vögel. Sie hat sich seit Jahren nicht mehr bewegt. Nur das kaum merkliche Heben und Senken der Brust in quälend langen Abständen verrät, dass sie atmet.
Ihr Gefährte ist zwei Handbreit größer als ein durchschnittlicher Sterblicher, aber das ist auch schon das Menschenhafteste an ihm. Das blasse Gesicht, das einst überwältigend schön war, ist über die Jahrhunderte so hart und scharf geworden wie ein windgeschliffener Felsgrat. Er ist immer noch von einer schrecklichen Schönheit, so gefährlich anziehend wie die Gewalt eines Sturms, der übers Meer braust. Seine Augen, da bist du dir sicher, wären so klar und tief wie der Nachthimmel, unendlich kühl und weise, aber sie verbergen sich unter einem Tuch, das am Hinterkopf geknotet und von seinem langen, mondsilbernen Haar verhangen ist.
Es ist Ynnir, der blinde König, aber die Blindheit ist nicht nur auf seiner Seite. Nur wenige Sterbliche haben ihn geschaut, und kein lebender Mensch, ob Mann oder Frau, hat ihn je außerhalb von Träumen erblickt.
Der Herrscher des Zwielichtvolkes hebt die Hand. Es war bereits still in der Halle, aber jetzt wird die Stille noch tiefer. Ynnir flüstert, aber alles im Raum hört ihn.
»Bringt das Kind.«
Vier kapuzenverhüllte, menschenähnliche Gestalten bringen eine Trage aus dem Schattendunkel hinter den Zwillingsthronen und setzen sie zu Füßen des Königs ab. Darauf liegt, zusammengekrümmt, etwas, das aussieht wie ein männliches Menschenkind; das feine, strohblonde Haar klebt in feuchten Kringeln um das schlafende Gesicht. Der König beugt sich vor, als ob er trotz seiner Blindheit das Kind betrachten und sich seine Züge einprägen wollte. Er greift in seine grauen Gewänder, die einst prächtig waren, jetzt aber sonderbar fadenscheinig und fast so staubig wie die großen Spiegel sind, und zieht einen kleinen Beutel an einer Schnur hervor, die Art Säckchen, in der ein Sterblicher vielleicht ein Amulett oder heilkräftige Kräuter um den Hals tragen würde. Ynnirs lange Finger streifen dem Knaben behutsam die Schnur über den Kopf, schieben dann den Beutel unter sein grobes Hemd, auf die schmale Kinderbrust. Dabei singt der König leise und monoton vor sich hin. Nur die letzten Worte sind laut genug, dass man sie versteht.
Bei Stern und Stein, es ist getan
Nicht Stein noch Stern vereiteln soll den Plan
Ynnir schweigt eine ganze Weile, ein Zögern, das fast schon menschlich wirkt. Doch als er dann spricht, sind seine Worte klar und bestimmt. »Bringt ihn weg.« Die vier Gestalten heben die Trage an. »Passt auf, dass euch im Sonnenland niemand sieht. Reitet schnell hin und zurück.«
Der Anführer der Vermummten neigt einmal kurz den Kopf, dann sind sie mit ihrer schlafenden Last verschwunden. Der König wendet sich kurz der blassen Frau an seiner Seite zu, fast als würde er erwarten, dass sie ihr langes Schweigen bricht. Aber sie rührt sich nicht, geschweige denn, dass sie spräche. Er wendet sich an die übrigen Anwesenden, all die begierigen Augen, die tausend gespannten Gestalten – und auch an dich, Träumer. Nichts, was die Schicksalsgöttinnen bereits gewoben haben, bleibt Ynnir verborgen.
»Es beginnt«, sagt er. Jetzt ist die Stille der Halle gebrochen. Gemurmel erfüllt den spiegelgesäumten Raum, eine Flut von Stimmen, die immer mehr anschwillt, bis sie von dem dunklen, zu Dornzweigen geschnitzten Gebälk widerhallt. Als sich schließlich lautes Singen und Rufen durch die endlosen Gänge von Qul-na-Qar ergießt, lässt sich schwer sagen, ob dieser schreckliche Lärm ein Triumph- oder ein Klagegesang ist.
Der blinde König nickt langsam. »Jetzt endlich beginnt es.«
Denk daran, Träumer, wenn du siehst, was folgen wird. Wie der blinde König sagte: Dies ist ein Beginn. Was er nicht sagte, was aber dennoch wahr ist: Das, was hier beginnt, ist das Ende der Welt.
ERSTER TEILBlut
»So wie der Jäger, der seine Schlingen legt, nicht immer weiß, was er fangen wird«, sprach der große Gott Kenios zu dem Weisen, »so mag auch der Gelehrte erkennen müssen, dass ihm seine Fragen unvorhergesehene und gefährliche Antworten eingebracht haben.«
Aus: Kompendium der bekannten Dinge, Buch des Trigon
1 Eine Lindwurmjagd
Der Weg, der sich verengt:
Unter Stein ist Erde,
Unter Erde sind Sterne, unter Sternen ist Schatten,
Unter Schatten sind alle bekannten Dinge.
Aus: Das Knochenorakel, Buch der Trauer (QAR)
Das Gebell der Hunde verlor sich bereits in den Senken, als er endlich kam. Sein Pferd war unruhig, brannte darauf, der Jagd zu folgen, aber Barrick Eddon riss am Zügel, um das tänzelnde Tier zurückzuhalten. Sein ohnehin schon blasses Gesicht wirkte jetzt vor Erschöpfung fast durchscheinend, und seine Augen glänzten fiebrig. »Reite weiter«, forderte er seine Schwester auf. »Du kannst sie noch einholen.«
Briony schüttelte den Kopf. »Ich lass dich nicht allein. Ruh dich aus, wenn du eine Pause brauchst. Dann reiten wir beide weiter.«
Er schaute mit der ganzen Verächtlichkeit eines Fünfzehnjährigen drein, wie ein Gelehrter unter Dummköpfen, ein Edelmann unter schlammfüßigen Bauern. »Ich brauche keine Pause, Strohkopf. Ich habe nur keine Lust.«
»Du bist ein elender Lügner«, beschied sie ihren Bruder sanft. Als Zwillinge waren sie sich ähnlich nah wie Liebende.
»Und außerdem kann sowieso niemand einen Drachen mit dem Speer töten. Wieso haben ihn denn die Wachen an der Schattengrenze durchgelassen?«
»Vielleicht ist er ja bei Nacht herübergekommen, und sie haben ihn nicht gesehen. Und es ist ja gar kein richtiger Drache, nur ein Lindwurm – viel kleiner. Shaso sagt, bei so einem reicht ein ordentlicher Knüppelhieb auf den Kopf.«
»Was wisst ihr denn von Lindwürmern, du und Shaso?«, fragte Barrick spöttisch. »Die kommen doch nicht jeden Tag über die Hügel getrottet. Das sind doch keine blöden Kühe.«
Briony nahm es als schlechtes Zeichen, dass er sich den verkrüppelten Arm rieb, ohne auch nur den Versuch zu machen, es vor ihr zu verbergen. Er wirkte noch blutleerer als sonst: die Schatten unter den Augen blau, das Fleisch so dünn, dass sein Gesicht an manchen Stellen regelrecht ausgezehrt schien. Sie fürchtete, dass er wieder geschlafwandelt war, und schon bei dem Gedanken schauderte es sie. Sie war auf der Südmarksfeste aufgewachsen, ging aber immer noch nicht gern nach Einbruch der Dunkelheit durch die hallenden, labyrinthischen Gänge.
Sie lächelte gezwungen. »Natürlich sind es keine Kühe, du Witzbold, aber der Jagdmeister hat Chaven gefragt, bevor wir losgeritten sind, weißt du nicht mehr? Und Shaso sagt, es gab hier schon einmal so ein Biest, zu Großvater Ustins Zeiten – es hat auf einem Gehöft in Landsend drei Schafe gerissen.«
»Drei Schafe! Himmel, was für ein Ungeheuer!«
Das Gekläff der Meute wurde plötzlich schriller, und beide Pferde traten jetzt nervös auf der Stelle. Jemand blies ein Horn, dessen klagender Ton kaum durch die Bäume drang.
»Sie haben etwas gesehen.« Auf einmal packte sie Angst. »Oh, barmherzige Zoria! Wenn dieses Untier den Hunden etwas tut?«
Barrick schüttelte verächtlich den Kopf, wischte sich dann eine schweißfeuchte Locke tiefroten Haars aus den Augen. »Den Hunden?«
Aber Briony hatte wirklich Angst um die Hunde – zwei von den Hetzhunden, Rack und Dado, hatte sie eigenhändig aufgezogen, und in gewisser Weise waren der Königstochter diese beiden Tiere näher als die meisten Menschen. »Ach, komm mit, Barrick, bitte! Ich reite gern langsam, aber ich lass dich nicht allein hier zurück.«
Sein spöttisches Lächeln verflog. »Selbst mit einer Hand – dir reite ich jederzeit davon.«
»Dann tu’s doch!«, rief sie lachend und sprengte den Hang hinab. Sie tat ihr Bestes, ihn aus seiner Verdrossenheit zu reißen, aber diese kalte, starre Maske kannte sie nur zu gut: Nur die Zeit und vielleicht das Jagdfieber würden ihr wieder Leben einhauchen können.
Briony sah sich um und bemerkte erleichtert, dass Barrick ihr folgte, ein schmaler Schatten auf dem grauen Pferd, ganz in Schwarz, als trüge er Trauer. Aber so kleidete sich ihr Zwillingsbruder jeden Tag.
Oh, bitte, Barrick, lieber, zorniger Barrick, verliebe dich nicht in den Tod. Sie staunte selbst über diese extravaganten inneren Worte – poetische Inbrunst erzeugte bei Briony Eddon normalerweise nur ein Gefühl, als ob es sie irgendwo juckte, wo sie sich nicht kratzen konnte –, und als sie sich geistesabwesend wieder umdrehte, hätte sie beinah eine kleine Gestalt niedergeritten, die sich gerade noch ins lange Gras werfen konnte. Ihr Herz pochte wild. Sie parierte Schneeflocke und sprang ab, sicher, dass sie um ein Haar irgendein Kätnerskind getötet hätte.
»Bist du verletzt?«
Es war ein kleiner, schon etwas ergrauter Mann, der sich aus dem strohigen Gras aufrappelte. Er ging ihr gerade bis an den Sattelgurt – ein älterer Funderling mit kurzen, aber muskulösen Armen und Beinen. Er zog den formlosen Filzhut und machte eine kleine Verbeugung. »Alles heil, edles Fräulein. Danke der gütigen Nachfrage.«
»Ich habe Euch nicht gesehen …«
»Das tut kaum jemand, edles Fräulein.« Er lächelte. »Und ich hätte auch besser …«
Barrick donnerte vorbei, ohne einen Blick für seine Schwester und ihr Beinahe-Opfer übrig zu haben. Bei aller Entschlossenheit schonte er doch den schmerzenden Arm, und sein Sitz war erschreckend wacklig. Briony kletterte so schnell wieder auf Schneeflocke, dass sich ihr Reitrock verwurstelte.
»Verzeiht mir«, bat sie den kleinen Mann, beugte sich dann tief über Schneeflockes Hals und jagte hinter ihrem Bruder her.
Der Funderling half seiner Frau auf. »Gerade wollte ich dich der Prinzessin vorstellen.«
»Red kein dummes Zeug.« Sie wischte sich Kletten vom dicken Rock. »Wir können von Glück sagen, dass ihr Pferd uns nicht zu Mus zerstampft hat.«
»Trotzdem. Es war vielleicht deine einzige Chance, ein Mitglied der Königsfamilie kennenzulernen.« Er schüttelte theatralisch-betrübt den Kopf. »Unsere letzte Chance, es zu etwas zu bringen, Opalia.«
Sie kniff die Augen zusammen, weigerte sich zu lächeln. »Ich wäre schon froh, wenn wir genügend Kupferstücke hätten, um dir neue Stiefel zu kaufen, Chert, und mir einen hübschen Winterschal. Dann könnten wir zu den Zunftversammlungen gehen, ohne wie Bettelkinder auszusehen.«
»Ist lange her, dass wir wie irgendwelche Kinder ausgesehen haben, mein alter Schatz.« Er klaubte eine weitere Klette aus ihrem graugesträhnten Haar.
»Und es wird noch länger hin sein, dass ich einen neuen Schal kriege, wenn wir jetzt nicht machen, dass wir weiterkommen.« Aber sie war es, die noch stehen blieb und fast schon wehmütig den Pfad entlangschaute. »War das wirklich die Prinzessin? Was glaubst du, wo die beiden so eilig hinwollten?«
»Der Jagdgesellschaft hinterher. Hast du nicht die Hörner gehört? Trara, trara! Heute sind die hohen Herrschaften unterwegs, um irgendeine arme Kreatur über die Hügel zu hetzen. In den schlimmen alten Zeiten wäre vielleicht einer von uns das Wild gewesen!«
Sie fand wieder zu sich und schnaubte verächtlich. »Das schert mich alles nicht, und wenn du klug bist, scherst du dich auch nicht drum. Wie mein Vater immer gesagt hat: Lass dich nicht mit den Großwüchsigen ein, wenn es nicht sein muss, und zieh nicht unnötig ihre Aufmerksamkeit auf dich. Das bringt nichts Gutes. Und jetzt lass uns wieder an die Arbeit gehen, Alter. Ich will mich nicht mehr in der Nähe der Schattengrenze herumtreiben, wenn es dunkel wird.«
Chert Blauquarz schüttelte den Kopf, jetzt wieder ganz ernst. »Ich auch nicht, mein Schatz.«
Die Hunde zögerten sichtlich, in das Gehölz vorzudringen, was ihrer Lautstärke jedoch keinen Abbruch tat. Der Lärm war fürchterlich, aber auch die eifrigsten Jäger beschieden sich offenbar gern damit, ein Stück höher am Hang zu warten, bis die Hunde das Wild ins Freie getrieben hatten.
Der Reiz der Jagd lag für die meisten ohnehin nicht in der Beute, nicht einmal dann, wenn es um ein so ungewöhnliches Wild ging. Mindestens zwei Dutzend hoher Damen und Herren und ein Vielfaches an Bediensteten schwärmten über den Hang. Die Edelleute lachten und schwatzten und bewunderten die Pferde und Kleider ihrer Standesgenossen (oder taten zumindest so). Soldaten und Dienstleute stapften hinterher oder lenkten Ochsenkarren, bepackt mit Speisen und Getränken, Geschirr und selbst den zusammengefalteten Zeltpavillons, in denen die Jagdgesellschaft das Morgenmahl zu sich genommen hatte. Viele Edelleute führten Ersatzpferde mit, denn es passierte nicht selten, dass bei einer besonders aufregenden Jagd ein Reitpferd mit einem Beinbruch liegenblieb oder mit geborstenem Herzen zusammenbrach. Kein Jäger wollte nur wegen eines toten Pferdes den krönenden Abschluss der Jagd verpassen und auf einem Karren nach Hause rumpeln müssen. Zwischen Freileuten und höheren Bediensteten liefen Fußsoldaten mit Piken oder Hellebarden, Pferdeknechte, Hundeführer in verdreckten, zerrissenen Kleidern, etliche Priester – da die geringeren wie die Soldaten zu Fuß gehen mussten – und selbst Puzzle, der hagere Hofnarr des Königs, der auf seiner Laute eine wenig überzeugende Jagdweise spielte, während er sich verzweifelt auf seinem gesattelten Esel zu halten versuchte. Tatsächlich schien es, als wäre in den stillen Hügeln unterhalb der Schattengrenze ein ganzes Dorf auf Wanderschaft.
Briony war immer froh, dem Burggemäuer – diesem Steinlabyrinth, aus dem die Türme an manchen Tagen die Sonne ganz auszusperren schienen – zu entkommen, aber am allermeisten hatte sie die kurze Absonderung von diesen Menschenscharen und die damit einhergehende Stille genossen. Sie fragte sich, wie es wohl bei einer Jagd am riesigen Hof von Syan oder Jellon zugehen mochte – dort zogen sich, wie sie gehört hatte, solche Vergnügungen manchmal über Wochen hin! Sie kam allerdings nicht lange zum Nachdenken.
Shaso dan-Heza löste sich aus der Menge und ritt den Zwillingen entgegen, kaum dass sie über die Hügelkuppe waren. Der Waffenmeister schien als einziger Höfling wirklich für das tödliche Handwerk des Jagens gerüstet: Er trug keine Prunkkleidung, wie sie die meisten Edelleute für die Jagd anlegten, sondern seinen alten schwarzen Lederharnisch, der kaum dunkler war als seine Haut. Sein mächtiger Kriegsbogen hing an seinem Sattel, gespannt und schussbereit, als rechnete Shaso jeden Moment mit einem Angriff. Briony erschienen der Waffenmeister und ihr verdrossener Bruder Barrick wie zwei Gewitterwolken, die aufeinander zutrieben, und sie machte sich auf den Donner gefasst. Der ließ auch nicht lange auf sich warten.
»Wo wart ihr, ihr zwei?«, herrschte Shaso sie an. »Warum habt ihr eure Wachen weiterreiten lassen?«
Briony beeilte sich, die Schuld auf sich zu nehmen. »Wir wollten nicht so lange wegbleiben. Wir haben einfach nur geredet, und Schneeflocke hat ein bisschen gelahmt …«
Der alte Tuani-Krieger ignorierte sie, durchbohrte nur Barrick mit seinem harten Blick. Shaso wirkte unverhältnismäßig zornig, als hätten die Zwillinge mehr verbrochen, als sich nur ein Weilchen dem Menschengewimmel zu entziehen. Er glaubte doch wohl nicht, dass sie hier in Gefahr waren, nur ein paar Meilen von der Burg, in dem Land, das die Eddons seit Generationen regierten? »Ich habe gesehen, wie du einfach der Jagd den Rücken gekehrt hast und ohne ein Wort davongeritten bist«, sagte er. »Was hast du dir dabei gedacht, Junge?«
Barrick zuckte die Achseln, aber auf seinen Wangen waren jetzt hochrote Flecken. »Nennt mich nicht ›Junge‹. Und was geht Euch das überhaupt an?«
Der alte Mann fuhr zusammen, und seine Hand zuckte hoch. Briony fürchtete schon, er würde Barrick schlagen. Er hatte dem Jungen im Lauf der Jahre manchen Hieb verpasst, aber immer im Zuge der Unterweisung, legitime Zweikampftreffer. Ein Mitglied der königlichen Familie in der Öffentlichkeit zu schlagen, wäre etwas ganz anderes. Shaso war nicht sonderlich beliebt – viele Edelleute behaupteten ganz offen, es schicke sich nicht, dass ein dunkelhäutiger Südländer, ein ehemaliger Kriegsgefangener, ein so hohes Amt in Südmark bekleide. Dass die Sicherheit des Königreichs in den Händen eines Fremden liege. An Shasos kämpferischem Können und an seiner Tapferkeit zweifelte niemand – damals in der Schlacht von Hierosol, wo er und der junge König Olin aufeinandergetroffen waren, hatte der Tuani-Krieger, obschon bereits entwaffnet, so erbitterten Widerstand geleistet, dass es ein halbes Dutzend Männer brauchte, um ihn gefangen zu nehmen. Und auch dann noch hatte er es geschafft, sich lange genug loszureißen, um Olin mit einem Hieb seiner Hammerfaust vom Pferd zu fällen. Doch statt den Gefangenen zu bestrafen, hatte Olin den Mut des Südländers bewundert, und als Shaso dann in Südmark fast zehn Jahre Gefangenschaft überlebte, ohne ausgelöst zu werden, war er in Olins Achtung immer weiter gestiegen und schließlich, gegen das Ehrenwort, dem Haus Eddon zu dienen, freigelassen und mit einer verantwortlichen Stellung betraut worden. In den gut zwanzig Jahren seit der Schlacht von Hierosol hatte Shaso dan-Heza seine Pflichten aufs ehrenhafteste und tüchtigste und mit fast schon übertriebener Strenge erfüllt und alle anderen Edelleute so gründlich in den Schatten gestellt, dass er schließlich bis ins hohe Amt des Waffenmeisters, des königlichen Kriegsministers für sämtliche Marken, aufgestiegen war – was ihm seiner Hautfarbe wegen erst recht verübelt wurde. Solange der Vater der Zwillinge auf dem Thron gesessen hatte, war der ehemalige Gefangene unantastbar gewesen, doch jetzt fragte sich Briony, ob Shasos Stellung – oder auch nur Shaso selbst – die rauhen Zeiten der Abwesenheit König Olins überdauern würde.
Als ginge Shaso Ähnliches durch den Kopf, ließ er die Hand sinken. »Du bist ein Prinz von Südmark«, erklärte er Barrick scharf, aber ruhig. »Wenn du ohne Not dein Leben riskierst, schadest du nicht mir.«
Ihr Zwillingsbruder starrte zurück, aber die Worte des alten Mannes kühlten sein Gemüt doch etwas ab. Briony wusste, Barrick würde sich nicht entschuldigen, aber es würde auch keine Handgreiflichkeiten geben.
Die Hunde bellten jetzt noch wilder. Kendrick, der ältere Bruder der Zwillinge, der sich weiter unten am Hang mit Gailon Tolly, dem jungen Herzog von Gronefeld, unterhielt, winkte die beiden zu sich. Briony ritt los, und Barrick folgte ihr. Shaso ließ ihnen ein paar Schritt Vorsprung, ehe auch er sich in Bewegung setzte.
Gailon von Gronefeld – nur ein halbes Dutzend Jahre älter als Barrick und Briony, aber von einer überförmlichen Art, die, wie sie wusste, nur seinen Ärger über gewisse ungewöhnliche Verhaltensweisen ihrer Familie überspielte – zog seinen grünen Filzhut und verbeugte sich. »Prinzessin Briony, Prinz Barrick. Wir waren um Euer Wohl besorgt.«
Sie bezweifelte, dass das die ganze Wahrheit war. Die Tollys standen in der Thronfolge gleich hinter den Eddons selbst und waren bekanntermaßen ehrgeizig. Gailon hatte es zwar bisher geschafft, wenigstens den Schein gebührender Unterordnung zu wahren, aber Briony bezweifelte, dass das für seine jüngeren Brüder, Caradon und den unheimlichen Hendon, ebenfalls galt. Briony konnte nur froh sein, dass die übrigen Tollys offenbar lieber über ihre ausgedehnten Ländereien in Gronefeld herrschten, als hier in Südmark die ergebenen Gefolgsleute zu spielen, und diese Aufgabe ihrem Bruder Gailon überließen.
Brionys Bruder Kendrick schien erstaunlich gut gelaunt, angesichts der Bürde der Regentschaft, die in Abwesenheit seines Vaters auf seinen jungen Schultern lastete. Anders als König Olin vermochte Kendrick seine Sorgen lange genug zu vergessen, um eine Jagd oder ein Schaugepränge zu genießen. Sein Rock aus feinstem sessianischem Tuch war offen, sein goldenes Haar vom Wind verstrubbelt. »Da seid ihr ja«, rief er. »Gailon hat recht – wir haben uns Sorgen um euch gemacht. Es ist so gar nicht deine Art, Briony, dir spannende Dinge entgehen zu lassen.« Er musterte Barricks Trauerstaat und riss verwundert die Augen auf. »Ist die Bußprozession dieses Jahr vorverlegt worden?«
»Oh, ja, ich sollte mich wohl für meinen Aufzug entschuldigen«, knurrte Barrick. »Wie geschmacklos von mir, mich zu kleiden, als ob unser Vater irgendwo in Gefangenschaft säße. Aber, Moment mal – unser Vater ist wirklich in Gefangenschaft. Wer hätte das gedacht?«
Kendrick zuckte zusammen und sah Briony fragend an. Sie machte ein Gesicht, das besagte: Er ist heute mal wieder schwierig. Der Prinzregent wandte sich an seinen jüngeren Bruder und fragte: »Möchtest du lieber nach Hause?«
»Nein!« Barrick schüttelte wütend den Kopf, brachte dann aber ein nicht sonderlich überzeugendes Lächeln zustande. »Nein. Alle sind immer viel zu besorgt um mich. Ich will ja nicht unhöflich sein, wirklich nicht. Mein Arm tut einfach nur manchmal weh. Ein bisschen.«
»Er ist ein tapferer Bursche«, sagte Herzog Gailon ohne jeden Spott in der Stimme, aber Briony sträubten sich dennoch die Nackenhaare wie einem ihrer geliebten Hunde. Letztes Jahr hatte Gailon um ihre Hand angehalten. Er sah auf seine langkinnige Art ganz gut aus, und die Besitzungen seiner Familie in Gronefeld standen nur hinter Südmark selbst zurück, aber sie war doch froh, dass ihr Vater es nicht eilig gehabt hatte, sie zu verheiraten. Sie hatte das sichere Gefühl, dass Gailon Tolly seiner Gemahlin nicht so viel Freiheit lassen würde wie König Olin seiner Tochter – er würde bestimmt dafür sorgen, dass Briony nicht in einem zweigeteilten Rock auf die Jagd zog, rittlings auf dem Pferd wie ein Mann.
Die Hunde kläfften jetzt noch schriller, und ein Raunen ging durch die auf dem Hügel versammelte Jagdgesellschaft. Briony drehte sich um und sah Bewegung in den Bäumen drunten in der Senke, ein Aufleuchten von Rot und Gold wie Herbstlaub, das in einem reißenden Bach dahinwirbelte. Dann brach etwas aus dem Unterholz, ein mächtiges, schlangenartiges Wesen, das fünf, sechs Herzschläge lang frei sichtbar war, ehe es in hohem Gras verschwand. Die Hunde stürzten bereits hinterher.
»O Götter!«, sagte Briony, von jäher Angst erfasst, und etliche Leute um sie herum schlugen das Dreifingerzeichen des Trigon auf der Brust. »Das Biest ist ja riesig!« Sie sah Shaso vorwurfsvoll an. »Habt Ihr nicht gesagt, bei so einem reicht ein ordentlicher Schlag auf den Kopf?«
Selbst der Waffenmeister schien erschrocken. »Der damals … er war kleiner.«
Kendrick schüttelte den Kopf. »Das Vieh misst gut und gern zehn Ellen, oder ich bin ein Skimmer.« Er schrie einem Jagdpagen zu: »Bringt die Saufedern!«, und sprengte dann den Hang hinab. Gailon von Gronefeld jagte neben ihm her, und die anderen Edelleute sputeten sich, ihre Plätze in unmittelbarer Nähe des jungen Prinzregenten einzunehmen.
»Aber …«, Briony verstummte. Sie wusste nicht, was sie hatte sagen wollen – wozu waren sie denn hier, wenn nicht, um einen Lindwurm zu erlegen? –, aber plötzlich war sie sich ganz sicher, dass Kendrick in Gefahr war, wenn er dem Biest zu nahe kam. Seit wann bist du ein Orakel oder eine weise Frau, fragte sie sich. Aber die Angst war sonderbar stark, die Verdichtung von etwas, das sie schon den ganzen Tag beunruhigt hatte wie ein Schatten am Rand ihres Gesichtsfelds. Da war diese seltsame Präsenz der Götter in der Luft, dieses Gefühl, von den Unsichtbaren umgeben zu sein. Vielleicht war es ja gar nicht so, dass Barrick den Tod suchte – vielleicht war ja diese finstere Gottheit, der Erdvater selbst, hinter ihnen her.
Sie versuchte, den Schauer abzuschütteln. Dummes Zeug, Briony. Dumme, schwarze Gedanken. Es musste an Barricks düsteren Worten über die Gefangenschaft ihres Vaters liegen. Es konnte doch keine Gefahr drohen, an einem solchen Tag, spät im Dekamene, dem zehnten Monat, aber von einer so kräftigen Sonne durchstrahlt, als wäre noch Hochsommer – wie konnten die Götter da zürnen? Die gesamte Jagdgesellschaft folgte jetzt Kendrick. Die Pferde donnerten den Hügel hinab, und die Pagen und Diener rannten aufgeregt schreiend hinterher, und plötzlich wollte sie dort vorn sein, bei Kendrick und den anderen Edelleuten, allen Schatten und allen Ängsten davongaloppieren.
Diesmal werde ich nicht zurückbleiben wie ein kleines Mädchen, dachte sie. Ich will den Lindwurm sehen, wie eine richtige Edelfrau.
Und wenn ich ihn am Ende töte? Nun ja, warum nicht?
Jedenfalls musste sie auf ihre beiden Brüder aufpassen. »Los, Barrick«, rief sie. »Keine Zeit zum Trübsalblasen. Wenn wir jetzt nicht losreiten, verpassen wir alles.«
»Das Mädchen, die Prinzessin – sie heißt doch Briony, oder?«, fragte Opalia, nachdem sie fast eine Stunde weitergewandert waren.
Chert verbarg ein Grinsen. »Sprichst du von den Großwüchsigen? Ich dachte, mit denen sollten wir uns gar nicht befassen.«
»Mach dich nicht über mich lustig. Mir gefällt es hier gar nicht. Obwohl die Sonne noch hoch steht, hat man das Gefühl, dass es dunkel ist. Und das Gras ist so nass! Das macht mich ganz kribbelig.«
»Tut mir leid, meine Liebe. Mir gefällt es hier auch nicht besonders, aber am äußersten Rand findet man nun mal die interessanten Dinge. Fast jedes Mal, wenn sich die Schattengrenze zurückzieht, ist da irgendwas Neues. Weißt du noch, dieser faustgroße Edri-Ei-Kristall? Der lag einfach im Gras, wie etwas, das die Flut angeschwemmt hat.«
»Das alles hier – das ist doch nicht natürlich.«
»Natürlich ist es nicht natürlich. Nichts an der Schattengrenze ist natürlich. Deshalb haben die Qar sie ja hinterlassen, als sie vor den Heeren der Großwüchsigen zurückgewichen sind. Nicht nur als Grenze zwischen ihrem Land und unserem, sondern als … Warnung, ja, so kann man’s wohl nennen. Bleibt draußen. Aber du hast gesagt, heute willst du mit, also bist du jetzt hier.« Er sah hinauf zu der Nebelfront, die sich über die grasbewachsenen Hügel zog, am dichtesten in den Senken, aber auch auf den Kuppen noch wie Eiderdaunen. »Wir sind gleich da.«
»Das sagst du schon die ganze Zeit«, brummte sie erschöpft.
Chert schämte sich plötzlich, dass er sein braves Weib so spöttisch behandelte. Sie konnte ganz schön herb sein, ja, aber auch ein Apfel war nicht immer süß und trotzdem gesund. »Und übrigens, auf deine Frage, ja. Das Mädchen heißt Briony.«
»Und dieser Junge, der ganz in Schwarz. Das ist der andere Bruder?«
»Ich glaube ja, aber ich habe ihn noch nie von nahem gesehen. Sie halten nicht viel von öffentlichen Auftritten, die jetzigen Eddons. Der alte König, Ustin, der liebte Feste und Umzüge, weißt du noch? Kaum ein Feiertag ohne …«
Historische Betrachtungen schienen Opalia nicht zu interessieren. »Er sah so traurig aus, dieser Junge.«
»Na ja, sein Vater ist in Gefangenschaft, und das Königreich kann das Lösegeld nicht aufbringen. Und er selbst hat einen kaputten Arm. Das ist doch vielleicht Grund genug.«
»Was ist ihm widerfahren?«
Chert winkte ab, als wäre er niemand, der Gerüchte weitertratschte, aber das war natürlich nur Theater. »Es heißt, ein Pferd sei auf ihn draufgefallen. Aber der alte Pyrit behauptet, sein Vater habe ihn die Treppe runtergestoßen.«
»König Olin? Der würde so was doch nie tun!«
Ihr entrüsteter Ton hätte Chert beinah wieder ein Grinsen entlockt: Dafür, dass sie behauptete, das Tun und Lassen der Großwüchsigen kümmere sie nicht, hatte seine Frau ganz schön feste Meinungen über sie. »Scheint ziemlich weit hergeholt«, gab er zu. »Und jeder weiß, dass der alte Pyrit viel daherredet, wenn er genug Moosbräu getrunken hat …« Er verstummte und runzelte die Stirn. Es war immer schwer zu sagen, hier am Rand, wo das Auge so leicht trog, was Entfernungen anging, aber irgendetwas stimmte ganz und gar nicht.
»Was ist?«
»Sie … sie hat sich verschoben.« Sie waren jetzt nur noch ein paar Dutzend Schritt von der Grenze – so nah dran, wie er sich irgend traute. Er starrte erst auf den Boden, dann auf das vertraute Grüppchen Wintereichen. Die Bäume waren gerade noch zu erahnen, so blass und verschwommen wie Geister. Zum ersten Mal, solange er denken konnte, war die unnatürliche Nebelsuppe zwischen die Stämme vorgedrungen. Chert sträubten sich die Nackenhaare. »Sie hat sich wirklich verschoben!«
»Aber sie verschiebt sich doch dauernd. Das hast du doch selbst gesagt.«
»Ja, indem sie sich ein Stückchen zurückzieht und dann wieder bis an die alte Stelle vorrückt, so wie Ebbe und Flut«, flüsterte er. »Wie ein atmendes Wesen. Deshalb finden wir hier ja Sachen, wenn sich die Grenze zum Schattenland hin verschoben hat.« Die Luft hatte etwas Schweres, das selbst für diese gespenstische Gegend ungewöhnlich war, und irgendwie fühlte sich Chert beobachtet: Er traute sich kaum zu reden. »Aber seit sie die Zwielichtler vor zweihundert Jahren hergezaubert haben, hat sie sich nie in die andere Richtung bewegt, Opalia. Bis heute.«
»Was willst du damit sagen?«
»Sie hat sich zu uns hin verschoben.« Er wollte es selbst nicht glauben, aber er kannte diese Hügel in- und auswendig. »Wie Hochwasser, das über die Ufer tritt. Sie ist mindestens ein Dutzend Schritt näher, als ich sie je gesehen habe.«
»Weiter nichts?«
»Weiter nichts? Weib, die Zwielichtler haben diese Nebelgrenze erschaffen, um die Leute aus dem Schattenland fernzuhalten. Wer sie überschreitet, kehrt nie mehr zurück, jedenfalls nicht dass ich wüsste. Und in den ganzen zweihundert Jahren hat sie sich nie auch nur einen Zoll auf die Burg zu bewegt!« Er war ganz atemlos vor Aufregung. »Ich muss es ihnen sagen.«
»Du? Wieso willst gerade du dich da einmischen, Alter? Haben die Großwüchsigen denn keine Wachen an der Schattengrenze?«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Doch, du hast sie ja gesehen, als wir an ihrem Posten vorbeigekommen sind. Aber sie haben uns nicht gesehen oder nicht weiter beachtet. Die könnten ebensogut den Mond bewachen! Sie achten auf gar nichts, und für diese Posten nehmen sie immer die jüngsten und unerfahrensten Soldaten. Hier hat sich so lange nichts verändert, dass schon gar niemand mehr glaubt, es könnte sich was verändern.« Er schüttelte den Kopf, alarmiert durch ein kaum hörbares Geräusch, ein Beben in der Luft. Ferner Donner? »Ich kann es ja selbst kaum glauben, und ich wandere seit Jahren in diesen Hügeln herum.« Das ferne Grollen wurde immer lauter, und schließlich begriff Chert, dass es kein Donner war. »Felsriss und Firstenbruch!«, fluchte er. »Das sind Pferde. Sie kommen auf uns zu!«
»Die Jagd?«, fragte sie. In dem nebelfeuchten Gras und den dichtstehenden Bäumen schien sich so ziemlich alles verbergen zu können. »Du hast doch gesagt, heute ist eine Jagd im Gang.«
»Es kommt nicht aus der Richtung – und sie würden sich nie so weit hierher wagen, so nah an die …« Sein Herz stolperte. »Götter der rohen Erde – es kommt aus dem Schattenland!«
Er packte seine Frau an der Hand und zerrte sie über den Hang, weg von der Nebelgrenze. Ihre kurzen Beine mühten sich verzweifelt, aber sie rutschten immer wieder auf dem nassen Gras aus, während sie den schützenden Bäumen entgegenstrebten. Der Hufdonner war jetzt unglaublich laut, als wären die Pferde unmittelbar über den stolpernden Funderlingen.
Chert und Opalia erreichten das Wäldchen und warfen sich ins stachlige Unterholz. Chert presste seine Frau zu Boden und spähte hinaus auf den Hang, wo jetzt vier Reiter aus dem Nebel auftauchten und ihre stampfenden Schimmel zügelten. Die Tiere, groß und mager und irgendwie anders als alle Pferde, die Chert je gesehen hatte, blinzelten, als seien sie nicht einmal so gedämpftes Sonnenlicht gewohnt. Die Reiter trugen Kapuzenmäntel, die auf den ersten Blick dunkelgrau oder gar schwarz schienen, tatsächlich aber schillerten wie ölige Pfützen. Die Gesichter konnte Chert daher nicht sehen, aber die Männer schienen ebenfalls über die Helligkeit hier draußen erschrocken. Eine Nebelzunge wand sich um die Fesseln der Pferde, als wollte das Schattenland sie nicht gänzlich gehen lassen.
Einer der Reiter drehte sich langsam zu den Bäumen hin, wo die beiden Funderlinge am Boden lagen. Nur das Funkeln des Augenpaars in der dunklen Tiefe der Kapuze zeigte an, dass diese nicht leer war. Einen ewig scheinenden Augenblick starrte der Reiter einfach nur herüber, oder vielleicht lauschte er auch, und obwohl ihm jede Faser seines Körpers befahl, aufzuspringen und davonzurennen, blieb Chert so still liegen, wie er irgend konnte, und umklammerte Opalia so fest, dass er fühlte, wie sie stumm gegen seinen schmerzhaften Griff ankämpfte.
Endlich wandte sich die vermummte Gestalt wieder ab. Einer der anderen Reiter hievte etwas hinter sich vom Sattel und ließ es zu Boden fallen. Die Reiter verharrten noch einen Moment und blickten über das Tal auf die fernen Türme der Südmarksfeste, warfen dann lautlos ihre geisterhaft weißen Pferde herum und verschwanden wieder in der schwadigen Nebelwand.
Chert wartete noch ein Dutzend hämmernde Herzschläge lang, ehe er seine Frau losließ.
»Du hast mir die Innereien zerquetscht, du alter Narr«, stöhnte sie und stemmte sich auf Hände und Knie empor. »Wer war das? Ich konnte nichts sehen.«
»Ich … ich weiß nicht.« Es war alles so schnell gegangen, dass es ihm beinah wie ein Traum vorkam. Er stand auf, fühlte, wie all seine Gelenke von der blinden Flucht schmerzhaft zu pochen begannen. »Sie sind einfach nur rausgekommen und dann wieder umgekehrt und zurückgeritten …« Er hielt inne und starrte auf das dunkle Bündel, das die Reiter abgeworfen hatten. Es bewegte sich.
»Chert, wo willst du hin?«
Er hatte natürlich nicht vor, es anzufassen – kein Funderling war so dumm, etwas aufzusammeln, was selbst die jenseits der Schattengrenze nicht haben wollten. Im Näherkommen merkte er, dass aus dem großen Sack leise, ängstliche Laute drangen.
»Da ist was drin«, rief er Opalia zu.
»In allem Möglichen ist was drin«, sagte sie und stapfte grimmig auf ihn zu. »Nur nicht in deinem Schädel. Lass das bloß liegen und komm hier weg. Da kann nichts Gutes rauskommen.«
»Es … es ist lebendig.« Ihm kam ein Gedanke. Das war bestimmt ein Elbe oder irgendein anderes Zauberwesen, das sie aus dem Land jenseits der Schattengrenze verbannt hatten. Elben erfüllten Wünsche, so hieß es in den alten Märchen. Und wenn er den Elben befreite, hätte er dann nicht auch ein paar Wünsche frei? Einen neuen Schal …? Opalia konnte einen ganzen Schrank voller Kleider haben, wie eine Königin, wenn sie wollte. Aber vielleicht würde ihn der Kobold ja auch zu einer Feuergoldader führen, und dann würden die Vorsteher der Funderlingszünfte bald vor Cherts Tür stehen, die Mütze in der Hand, und ihn um Hilfe anbetteln. Selbst sein ach so stolzer Bruder …
Der Sack zappelte und kippte um. Etwas darin fauchte wütend.
Natürlich kann es auch einen Grund haben, dachte er, dass sie dieses Etwas über die Schattengrenze geschafft und weggeworfen haben, so wie man Knochen auf den Misthaufen wirft. Vielleicht ist es ja etwas sehr Unangenehmes.
Jetzt kamen noch seltsamere Laute aus dem Sack.
»Oh, Chert.« Die Stimme seiner Frau klang auf einmal anders. »Da ist ein Kind drin! Hör doch – es weint!«
Er rührte sich immer noch nicht. Jedermann wusste, dass es selbst diesseits der Schattengrenze böse Kobolde und Geister gab, die Stimmen nachahmten, um Wanderer vom Weg abzubringen und ins sichere Verderben zu locken. Warum also einem Etwas, das aus dem Inneren des Schattenlands kam, Besseres zutrauen?
»Willst du denn nichts tun?«
»Was denn? Wir wissen doch nicht, was für ein Dämon da drin steckt, Weib.«
»Das ist kein Dämon, das ist ein Kind – und wenn du dich nicht traust, es herauszulassen, Chert Blauquarz, dann tue ich es.«
Diesen Ton kannte er nur zu gut. Er murmelte ein Gebet zu den Göttern der Tiefe und näherte sich dann dem Sack, als handelte es sich um eine zusammengerollte Giftschlange, setzte die Füße ganz vorsichtig, damit das zappelnde Ding nicht gegen ihn rollte und ihn womöglich biss. Der Sack war mit einem grauen Strick zugebunden. Vorsichtig berührte er den Knoten: Der Strick war so glatt wie polierter Speckstein.
»Beeil dich, Alter.«
Er funkelte sie wütend an, pulte vorsichtig an dem Knoten herum und wünschte sich, er hätte etwas Schärferes dabei als nur sein altes, vom Steineausgraben stumpfes Messer. Trotz der Nebelkühle standen ihm Schweißperlen auf der Stirn, als er es endlich schaffte, den Knoten zu lösen. Der Sack lag schon eine ganze Weile stumm und reglos da. Er fragte sich, halb darauf hoffend, ob das Wesen darin wohl erstickt war.
»Was ist drin?«, rief seine Frau, aber ehe er ihr erklären konnte, dass er das verdammte Ding noch nicht mal richtig offen hatte, schoss etwas aus dem Sack wie ein Stein aus einer Muskete und warf ihn um.
Chert wollte schreien, aber das Etwas umkrallte mit feuchten Händen seinen Hals und versuchte, ihn durch das dicke Wams in die Brust zu beißen. Er war so damit beschäftigt, um sein Leben zu kämpfen, dass er gar nicht registrierte, wie sein Widersacher aussah, bis sich plötzlich eine dritte Gestalt ins Getümmel warf und das Würgemonster von ihm herunterzerrte, dabei aber selbst auf ihn plumpste.
»Bist du … verletzt …?«, fragte Opalia.
»Wo ist dieses Ungeheuer?« Chert schaffte es, sich halb aufzurichten. Der Inhalt des Sacks kauerte ein Stückchen weiter am Boden und starrte ihn mit zusammengekniffenen blauen Augen an. Es war ein schmalgliedriger Junge von fünf oder sechs Jahren, verschwitzt und zerzaust. Seine Haut war leichenblass und sein Haar fast weiß, als hätte er schon seit Jahren in dem Sack gesteckt.
Opalia setzte sich auf. »Ein Kind! Ich hab’s doch gesagt.« Sie musterte den Jungen. »Einer von den Großwüchsigen. Armes Kerlchen.«
»Armes Kerlchen?« Chert betastete vorsichtig die Kratzer an seinem Hals und auf seinen Wangen. »Das kleine Biest wollte mich umbringen.«
»Ach, sei still. Du hast ihn erschreckt, das ist alles.« Sie streckte die Hand nach dem Jungen aus. »Komm her – ich tu dir nichts. Wie heißt du, Kleiner?« Als der Junge nicht antwortete, kramte sie in den weiten Taschen ihres Kleids und förderte einen dunklen Brotkanten zutage. »Hast du Hunger?«
Nach dem Glitzern in seinen Augen zu urteilen, war der Junge höchst interessiert, aber er kam dennoch keinen Zoll näher. Opalia beugte sich vor und legte das Brot ins Gras. Er musterte erst den Kanten, dann sie, grabschte sich dann das Brot, stopfte es sich in den Mund und schlang es, ohne sich lange mit Kauen aufzuhalten, hinunter. Als der Kanten weg war, sah der Junge Opalia gierig an. Sie lachte bedauernd und suchte in ihren Taschen herum, bis sie ein paar Stücke Dörrobst fand, die sie ebenfalls ins Gras legte. Sie verschwanden noch schneller als das Brot.
»Wie heißt du?«, fragte sie den Jungen.
Er forschte mit der Zunge im Mund herum, ob ihm vielleicht ein Krümel entgangen war, und sah Opalia einfach nur an.
»Stumm, wie’s aussieht«, sagte Chert. »Oder jedenfalls spricht er nicht unsere …«
»Wo ist das hier?«, fragte der Junge.
»Wie … wo … was meinst du?«, fragte Chert verdutzt.
»Wo ist das hier …?« Der Junge deutete mit einer ausholenden Handbewegung auf die Bäume, den grasbewachsenen Hang, den nebelverhangenen Wald. »Das … alles hier. Wo sind wir?« Er klang älter, als er war, aber auch jünger, so als wäre das Sprechen für ihn etwas Neues.
»Wir sind am Rand von Südmark – Schattenmark, wie es auch genannt wird, wegen der Schattengrenze da.« Chert deutete auf die Nebelbarriere, drehte sich dann um und zeigte in die Gegenrichtung. »Die Burg ist dort drüben.«
»Schatten … grenze?« Der Junge sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Burg?«
»Er braucht noch mehr zu essen.« Opalias Ton klang nach einer unumstößlichen Entscheidung. »Und Schlaf. Du siehst doch, er fällt fast um.«
»Und was heißt das?« Aber Chert ahnte schon, was es hieß, und es behagte ihm gar nicht.
»Das heißt natürlich, wir nehmen ihn mit nach Hause.« Opalia stand auf und klopfte sich Gras vom Kleid. »Und geben ihm was zu essen.«
»Aber … aber er gehört doch sicher jemandem! Einer der Großwüchsigenfamilien.«
»Und die haben ihn in einen Sack gesteckt und hier hingeworfen?« Opalia lachte verächtlich. »Dann warten sie ja wohl nicht gerade sehnlich darauf, dass er zurückkommt.«
»Aber er ist … er kommt doch …« Chert sah zu dem Knaben hinüber, der an seinen Fingern saugte und die Landschaft studierte. Er senkte die Stimme. »Er ist doch von drüben gekommen.«
»Jetzt ist er hier«, sagte Opalia. »Guck ihn doch an – meinst du wirklich, er ist irgendein Unhold? Er ist ein kleiner Junge, der sich ins Zwielichtland verirrt hat und den sie wieder rausgeworfen haben. Wir beide sollten doch am besten wissen, dass nicht alles, was mit der Schattengrenze zu tun hat, von Übel sein muss. Willst du vielleicht die Edelsteine, die du hier gefunden hast, auch wieder rüberwerfen? Nein, er kommt sicher aus einem anderen Dorf in der Nähe der Grenze – irgendwo ganz weit weg! Sollen wir ihn vielleicht hier verhungern lassen?« Sie patschte sich auf den Oberschenkel, lockte dann mit dem Zeigefinger. »Komm mit uns, Kleiner. Wir nehmen dich mit nach Hause und geben dir was Ordentliches zu essen.«